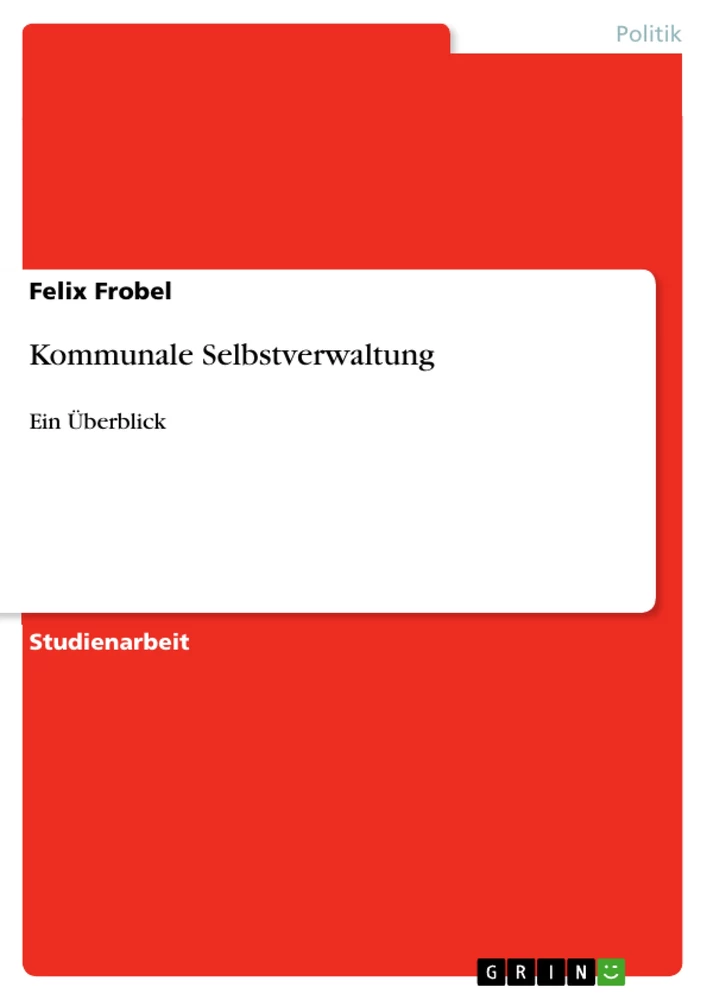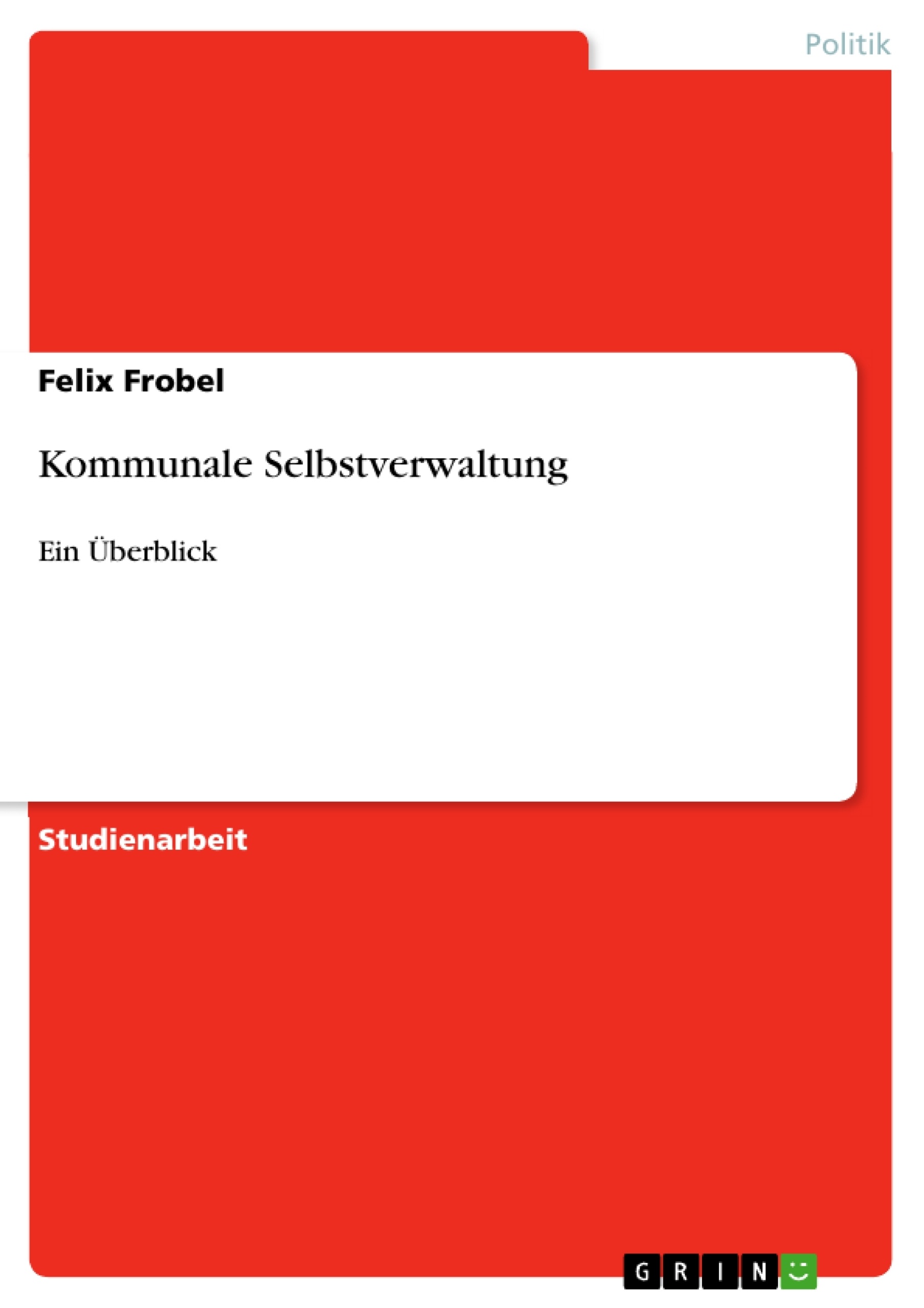In der Literatur wird die Idee der Selbstverwaltung antiken Stadtstaaten und Gilden zugeschrieben. Auffällig oft wird in diesem Zusammenhang das germanische Dorf und die Stadt im Mittelalter erwähnt: „Die ersten dörflichen Siedlungsgemeinschaften hatten genossenschaftlichen Charakter. Die Genossenschaft entwickelte sich auf der Grundlage gemeinsamen Grundbesitzes und sesshaften Ackerbaus sowie aus dem Bedürfnis, sich gemeinsam vor fremden Angreifern zu schützen und sich im Alltag gegenseitig Hilfe zu leisten.“ Wichtige Angelegenheiten und Bedürfnisse der dörflichen Gemeinschaft wurden von einer Versammlung stimmberechtigter Bauern entschieden. Besonders die Nutzung von Grundvermögen, die Ordnung des Zusammenlebens und die Dorfverteidigung sind Bereiche, die von der Dorfversammlung geregelt wurden. Ein gewählter Vorsteher erledigte die Geschäfte der Dorfgemeinschaft. Die Freiheit der Dorfgemeinschaft ging mit dem Erstarken des Grundherrentums und des Lehenswesens im frühen Mittelalter weitgehend verloren, die Bauern wurden von den Grundherren abhängig.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Geschichtliche Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung
- 1.1 Die Ursprünge der kommunalen Selbstverwaltung im germanischen Dorf und in der mittelalterlichen Stadt
- 1.2 Moderne Selbstverwaltung
- 1.3 Städte- und Gemeindeordnungen Preußens
- 1.4 Zu Zeiten der Weimarer Reichsverfassung
- 1.5 Kommunalrecht während des Nationalsozialismus
- 2. Die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeinde
- 2.1 Die verschiedenen Gemeindeverfassungen
- 3. Aufgaben der Gemeinde
- 3.1 Politisch-wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- 3.2 Dienstleistungspaket für den Bürger
- 4. Finanzierungsschema der Gemeindeaufgaben
- 5. Anhang
- 5.1 Anlage
- 5.2 Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der kommunalen Selbstverwaltung und bietet einen umfassenden Überblick über dessen geschichtliche Entwicklung, gegenwärtige Aufgaben und Herausforderungen. Ziel ist es, ein tiefergehendes Verständnis der Struktur und Funktionsweise der kommunalen Selbstverwaltung zu vermitteln und die Bedeutung für die Gesellschaft aufzuzeigen.
- Geschichtliche Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung
- Politische Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeinde
- Aufgaben der Gemeinde
- Finanzierungsschema der Gemeindeaufgaben
- Rechtliche Rahmenbedingungen der kommunalen Selbstverwaltung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Geschichtliche Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung
Kapitel 1 beleuchtet die Ursprünge der kommunalen Selbstverwaltung, beginnend mit der germanischen Dorfgemeinschaft und der mittelalterlichen Stadt. Es wird die Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung im Wandel der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse dargestellt, insbesondere die Bedeutung der Städte- und Gemeindeordnungen Preußens und die Auswirkungen der Weimarer Reichsverfassung sowie des Nationalsozialismus.
2. Die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeinde
Kapitel 2 fokussiert auf die verschiedenen Formen der Gemeindeverfassungen und die Organisation der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung auf Gemeindeebene. Es werden die verschiedenen Formen der Gemeindeorgane und deren Aufgabenbereiche behandelt.
3. Aufgaben der Gemeinde
Kapitel 3 befasst sich mit den Aufgaben der Gemeinde im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Dabei werden die politisch-wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Dienstleistungen für die Bürger beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der kommunalen Selbstverwaltung. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Gemeinde, Kommune, Selbstverwaltung, Recht, Geschichte, Aufgaben, Finanzen, politische Willensbildung, Entscheidungsfindung, Dienstleistungen, Bürger.
Häufig gestellte Fragen
Wo liegen die Ursprünge der kommunalen Selbstverwaltung?
Die Ursprünge werden in antiken Stadtstaaten, Gilden, germanischen Dorfgemeinschaften und den Städten des Mittelalters gesehen.
Was kennzeichnete das germanische Dorf in Bezug auf Selbstverwaltung?
Frühe Siedlungsgemeinschaften hatten genossenschaftlichen Charakter; wichtige Entscheidungen wurden von einer Versammlung stimmberechtigter Bauern getroffen.
Wie entwickelte sich das Kommunalrecht im Nationalsozialismus?
Während dieser Zeit wurde die kommunale Selbstverwaltung weitgehend abgeschafft und durch das Führerprinzip und staatliche Kontrolle ersetzt.
Welche Aufgaben haben moderne Gemeinden heute?
Gemeinden erbringen Dienstleistungen für die Bürger, regeln das Zusammenleben vor Ort und verwalten ihre eigenen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze.
Wie werden Gemeindeaufgaben finanziert?
Die Finanzierung erfolgt über ein komplexes Schema aus eigenen Steuern (z. B. Gewerbesteuer), Zuweisungen vom Land und Gebühren für Dienstleistungen.
Was ist die Bedeutung der Preußischen Städteordnung?
Sie gilt als wichtiger Meilenstein für die Entwicklung der modernen kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland im 19. Jahrhundert.
- Quote paper
- Felix Frobel (Author), 2001, Kommunale Selbstverwaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161230