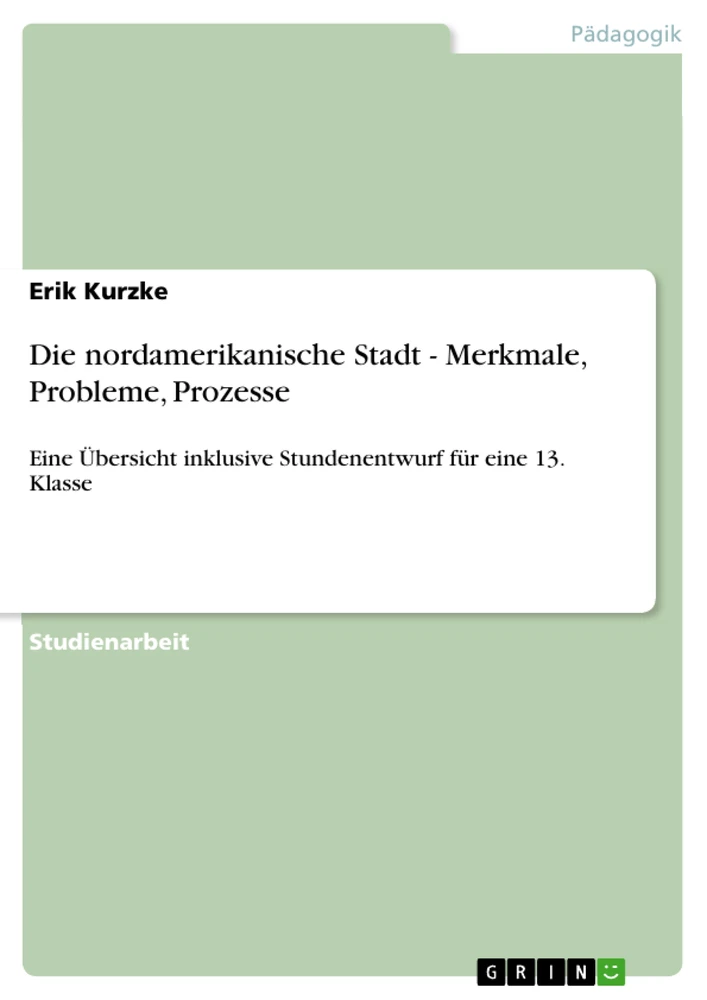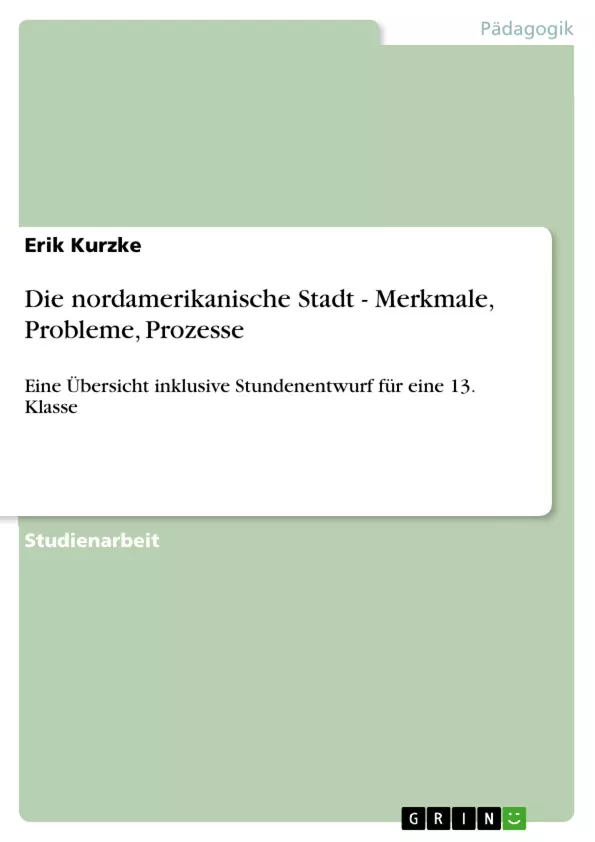1. Einleitung
Die nordamerikanische Stadt ist ein komplexes System aus vielen dynamischen Prozessen und Problemen. Es soll im Folgenden versucht werden, einen allgemein und lebhaften Über-blick über Physiognomie und Prozesse dieses Stadttypen zu geben. Außerdem werden ver-schiedene Probleme erläutert, bspw. infrastrukturelle und fiskalische. Jedoch bestimmen die Menschen, die in ihr wohnen das Leben und letztendlich auch das Stadtbild. Somit ist es unabdingbar, einen gesellschaftlichen Einblick zu bekommen, speziell über Probleme wie Armut, sozialer Verfall und Viertelbildung (Ghettoisierung).
In Anbetracht des Rahmens dieser Arbeit lässt sich vermuten, dass sich kein ausführliches, detailliertes Bild der nordamerikanischen Stadt zeichnen lässt. Es gibt zu viele Elemente, die sich gegenseitig beeinflussen, sowohl negative, als auch positive. Somit werden viele ver-schiedene Elemente skizziert, sodass ein Bild dieser Komplexität des Systems entsteht.
Es handelt sich in der vorliegenden Arbeit um eine Referatsverschriftlichung im Rahmen des fachdidaktischen Hauptseminars „Ausgewählte Themen der Sek. II“, geleitet von Frau Dr. Karin Richter. Das bedeutet, dass nicht nur der fachliche Teil wichtig ist, sondern ebenso der didaktische. Darum findet sich im Anhang ein Stundenentwurf für eine 13. Klasse für 90 Mi-nuten mit allen Unterrichtsmaterialien. In diesem wird ebenso versucht, die Komplexität einer Stadt (New York) in den Vordergrund zu stellen, um einen gedanklichen Brückenbau in viele Großstädte der USA zu schlagen, d.h. es soll erkannt werden, dass viele dieser Eigen-schaften in anderen US-amerikanischen Städten und nicht nur New York vorherrschen ohne dass man jede Stadt einzeln behandelt. „New York – Metropole mit Kontrasten“ lautet das Stundenthema. Im Grunde ist es ein flexibel einsetzbares Stundenthema, dass jedoch wohl am besten im Rahmen der Behandlung der USA passt: „Die USA in der Weltwirtschaft“. Be-vor man die kontinentale und wirtschaftliche Rolle der USA behandelt, bietet sich ein Blick in das Leben einer nordamerikanischen Stadt an, auf dessen Erkenntniswert man gegebenfalls Städte anderer Regionen der Erde in folgenden Stunden vergleichen kann. Im Wesentlichen sollen die Schüler in einem Gruppenpuzzle (spezielle Form der Gruppenarbeit) die verschie-denen Prozesse und Probleme der nordamerikanischen Stadt erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die nordamerikanische Stadt
- Aufbau
- Merkmale
- Junges Alter
- Physiognomische Besonderheiten
- Funktionsverlust des CBD
- Entwicklung von Ghettos und Slums
- Gated Communities
- Besondere Prozesse
- Massive Suburbanisierung der Wohnbevölkerung / Bildung von edge cities
- Invasion und Sukzession
- Gentrification
- Business Improvement Districts
- Klassische Probleme der nordamerikanischen Stadt
- Fiskalische Probleme
- Infrastrukturprobleme
- Armut und Verfall von Stadtvierteln
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der nordamerikanischen Stadt als einem komplexen System mit dynamischen Prozessen und Problemen. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die Physiognomie und die Entwicklungsprozesse dieses Stadttyps zu geben. Darüber hinaus werden verschiedene Probleme, wie z. B. infrastrukturelle und fiskalische Herausforderungen, beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die sozialen Aspekte der Stadt gelegt, insbesondere auf Probleme wie Armut, sozialer Verfall und Viertelbildung (Ghettoisierung). Die Arbeit stellt zudem einen Bezug zur Didaktik her und beinhaltet einen Stundenentwurf für eine 13. Klasse zum Thema „New York - Metropole mit Kontrasten“.
- Physiognomie und Struktur der nordamerikanischen Stadt
- Entwicklungsprozesse wie Suburbanisierung, Invasion und Sukzession, Gentrification
- Soziale Probleme wie Armut und Ghettoisierung
- Fiskalische und infrastrukturelle Herausforderungen
- Didaktische Einbindung und Unterrichtsgestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung liefert einen Überblick über die Thematik der nordamerikanischen Stadt und die Ziele der Arbeit. Sie betont die Komplexität des Systems und die Bedeutung sozialer Faktoren im städtischen Kontext.
- Die nordamerikanische Stadt: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau der nordamerikanischen Stadt, mit Fokus auf den Central Business District (CBD), die Übergangszone und das Umland. Es beleuchtet Merkmale wie das junge Alter der Stadt, die physiognomischen Besonderheiten und die Entwicklung von Ghettos und Slums.
- Besondere Prozesse: Dieses Kapitel untersucht Prozesse wie Suburbanisierung, Invasion und Sukzession, Gentrification und Business Improvement Districts, die die Entwicklung der nordamerikanischen Stadt prägen.
- Klassische Probleme der nordamerikanischen Stadt: Dieses Kapitel widmet sich zentralen Problemen der nordamerikanischen Stadt, wie z. B. fiskalischen Herausforderungen, Infrastrukturproblemen und Armut sowie dem Verfall von Stadtvierteln.
Schlüsselwörter
Nordamerikanische Stadt, Central Business District (CBD), Übergangszone, Umland, Suburbanisierung, Edge Cities, Invasion und Sukzession, Gentrification, Ghettoisierung, Armut, Fiskalische Probleme, Infrastrukturprobleme, Didaktik, Unterrichtsgestaltung, New York, Metropole mit Kontrasten.
- Quote paper
- Erik Kurzke (Author), 2010, Die nordamerikanische Stadt - Merkmale, Probleme, Prozesse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161279