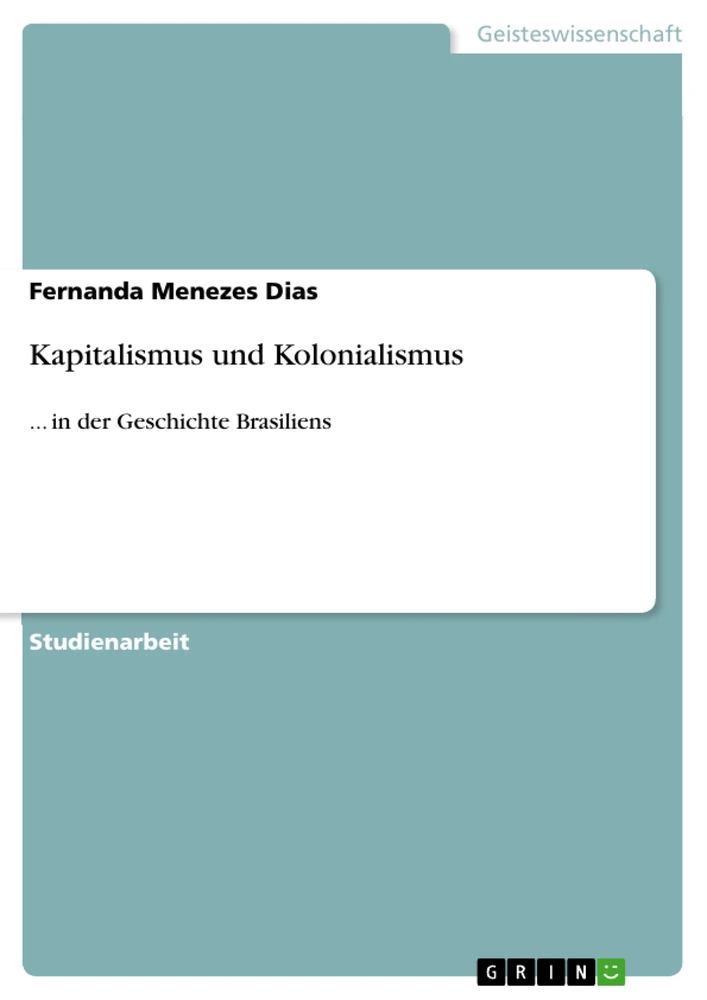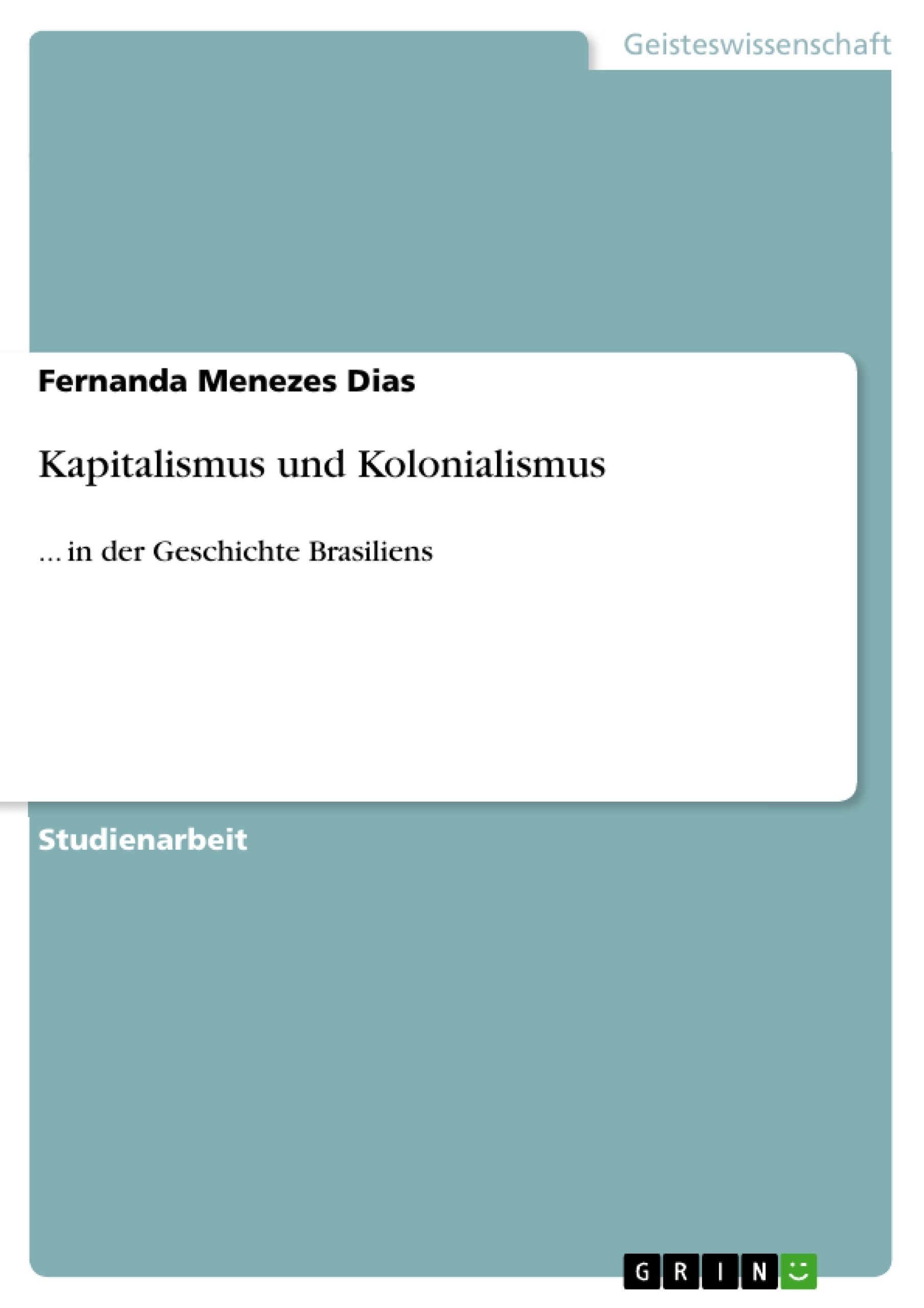In der vorliegenden Hausarbeit soll das Thema „Kapitalismus und Kolonialismus“ anhand der Geschichte Brasiliens dargestellt werden. Es versteht sich daher von selbst, dass hier wirtschaftliche
Aspekte verstärkt im Mittelpunkt stehen. Nach kurzem Einarbeiten in die Materie fel die Entscheidung auf Brasilien, da es ein Land ist, das seit seiner Entdeckung auf Produktion und Export aufgebaut worden ist. Dass das Land den Untergang Portugals zwar nicht verhindern konnte, ihn aber um einige Jahrzehnte nach hinten verschob, zeigt die enorme Abhängigkeit der Alten Welt von der Neuen. Eine Tatsache die auch heute noch sehr aktuell ist und sich nicht nur auf Brasilien und Portugal bezieht. Die Arbeit ist chronologisch aufgebaut. Politische Ereignisse werden nur erwähnt, sofern sie für die wirtschaftliche Entwicklung entscheidend sind. Auch kulturelle Aspekte, unter denen z.B. die Jesuiten fallen, sind außen vor geblieben. Um all diesen Themen hier Platz einräumen zu können, hätte ich die wirtschaftlichen Aspekte oberfächlicher behandeln müssen, wogegen ich mich
jedoch entschieden habe. Größtenteils habe ich aus der Perspektive Brasiliens geschrieben. Dies erwies sich jedoch bis zum Kapitel „Brasilien seit der Unabhängigkeit“, als nicht immer möglich. Um bestimmte Handlungen verständlich darzustellen, musste ich in einigen Fällen auf politische und wirtschaftliche Verhältnisse Portugals
eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Entdeckung Brasiliens
- Die Kolonialzeit
- Brasilien seit der Unabhängigkeit
- Abschaffung der Sklaverei und Republik
- Wirtschaftliche Entwicklungen seit Vargas
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte Brasiliens im Kontext von Kapitalismus und Kolonialismus, wobei der Fokus auf wirtschaftliche Aspekte gelegt wird. Die Analyse zeigt, wie Brasilien seit seiner Entdeckung durch Portugal auf Produktion und Export aufgebaut wurde und wie die Neue Welt für die Alte Welt von immenser Bedeutung war.
- Die Rolle Brasiliens in der portugiesischen Kolonialpolitik
- Die Entwicklung der brasilianischen Wirtschaft im Laufe der Geschichte
- Die Auswirkungen des Sklavenhandels auf die brasilianische Gesellschaft und Wirtschaft
- Die Herausforderungen der brasilianischen Wirtschaft in der Post-Unabhängigkeitsphase
- Die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Brasilien und Portugal
Zusammenfassung der Kapitel
Die Entdeckung Brasiliens
Das Kapitel beschreibt die Entdeckung Brasiliens durch Pedro Àlvares Cabral im Jahr 1500 und den Vertrag von Tordesillas, der Portugal das Besitzrecht an dem Land zusprach. Es werden die ersten Eindrücke der Portugiesen von Brasilien, insbesondere die Beschreibung der indigenen Bevölkerung, sowie die anfängliche wirtschaftliche Bedeutung des Brasilholzes für Portugal dargestellt.
Die Kolonialzeit
Dieses Kapitel beleuchtet die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens unter portugiesischer Herrschaft, insbesondere die Ausweitung des Zuckeranbaus und den Beginn des Sklavenhandels. Es wird die Bedeutung der Zuckerproduktion für die portugiesische Wirtschaft und die sozialen Folgen der Sklaverei für Brasilien diskutiert.
Brasilien seit der Unabhängigkeit
Dieses Kapitel beleuchtet die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens nach der Unabhängigkeit von Portugal, mit einem Fokus auf die Abschaffung der Sklaverei und die Herausforderungen der Republik. Es werden die wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen seit der Ära von Getúlio Vargas und die Herausforderungen der brasilianischen Wirtschaft im globalen Kontext beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert zentrale Begriffe wie Kapitalismus, Kolonialismus, Sklaverei, Zuckerproduktion, Brasilholz, Wirtschaftsentwicklung, Export, Brasilien, Portugal, Geschichte, Wirtschaftsethnologie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte der Kolonialismus für Brasiliens Wirtschaft?
Brasilien wurde seit seiner Entdeckung als Exportökonomie für Rohstoffe wie Brasilholz und Zucker konzipiert, was Portugal wirtschaftlich stabilisierte.
Wie beeinflusste die Sklaverei die Entwicklung Brasiliens?
Der Sklavenhandel war das Rückgrat der Zuckerproduktion und prägte die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen des Landes bis weit nach der Unabhängigkeit.
Was war die Bedeutung des Brasilholzes?
In der Frühzeit der Kolonialisierung war Brasilholz das erste große Exportgut, das dem Land seinen Namen gab und für Portugal von hohem wirtschaftlichem Wert war.
Wie entwickelte sich Brasilien nach der Unabhängigkeit?
Nach 1822 stand das Land vor Herausforderungen wie der Abschaffung der Sklaverei, dem Übergang zur Republik und der Industrialisierung unter Getúlio Vargas.
Warum war Portugal so abhängig von Brasilien?
Die Reichtümer aus der Kolonie (Zucker, Gold) verzögerten den wirtschaftlichen und politischen Niedergang Portugals um mehrere Jahrzehnte.
- Quote paper
- Fernanda Menezes Dias (Author), 2007, Kapitalismus und Kolonialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161333