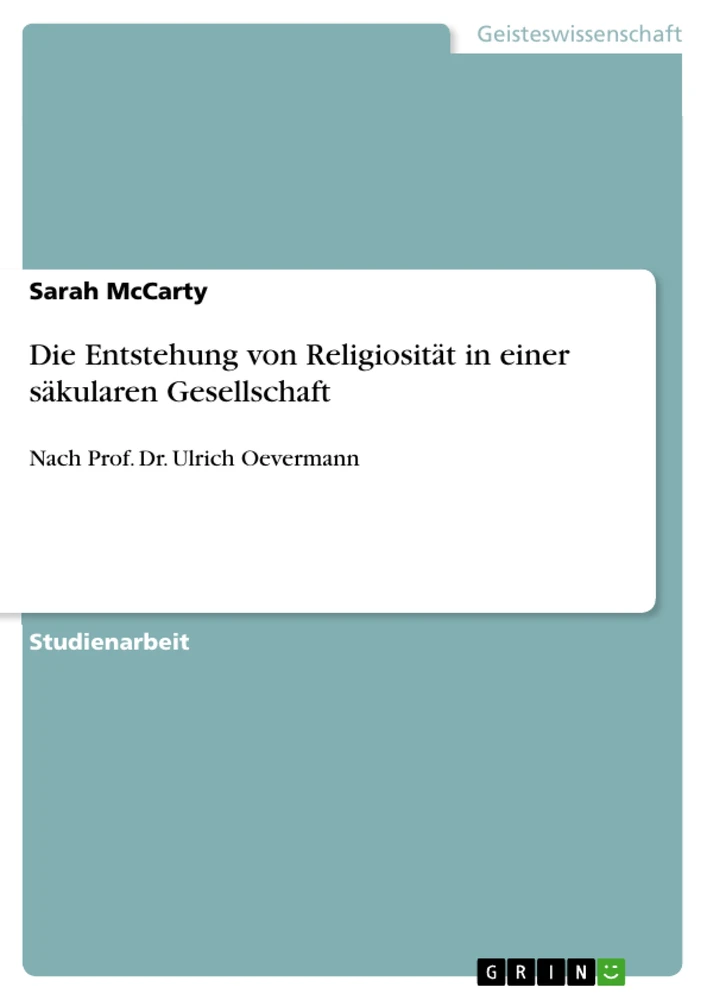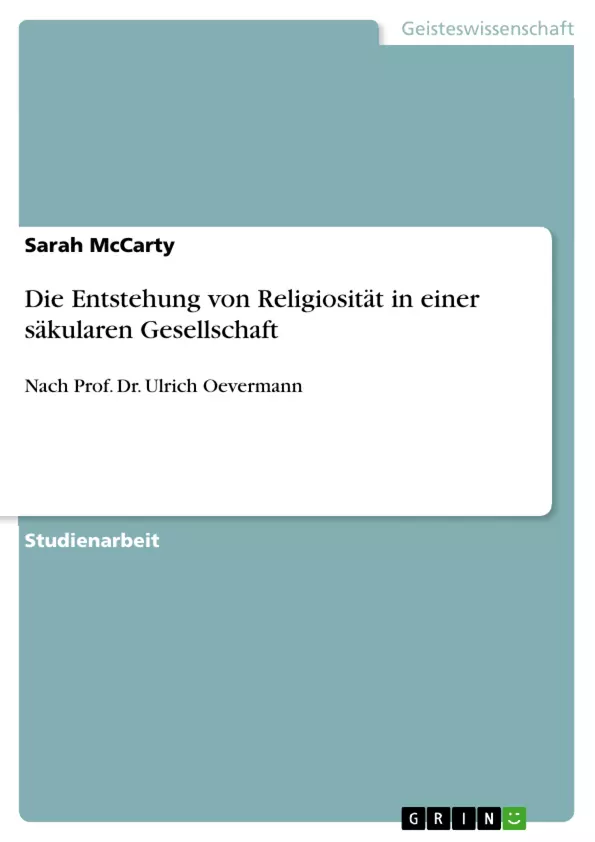Da sich der Mensch in seiner Lebenspraxis in einer widersprüchlichen Einheit zwischen Entscheidungsverpflichtung und Begründungszwang befindet, ist er immer wieder gezwungen aus seinen Routinen aus-zubrechen, um Entscheidungen treffen zu können. Dieses Ausbrechen kann sich häufig krisenhaft vollziehen, auch weil der Mensch für seine Entscheidungen oftmals Gründe hat, die ihm erst im Nachhinein voll bewusst werden. Für Prof. Dr. Ulrich Oevermann ist hierbei die Krise der Normalfall und die Routine die Ausnahme, da sich der Mensch unentwegt gezwungen sieht Entscheidungen zu treffen, deren Ausgang er oftmals nicht oder nicht vollständig überblicken kann und die sein Leben ganz einschneidend beeinflussen können. Da laut Oevermann nicht die Möglichkeit besteht, dass man sich nicht entscheidet muss sich der Mensch immer wieder neu entscheiden. Diese Entscheidungsmuster können aber auch nicht (immer) routinisiert werden, da er sich immer wieder auf neue Situationen einlassen und selbständig Entscheidungen treffen muss.Gerade in der heutigen Zeit trifft dies in extremem Maße zu. Es gibt keine festen Regeln und Normen mehr, an denen man sich orientieren muss. Aber vielleicht auch kann. Dies zeigt nun ganz deutlich die Schwierigkeit auf. In einer Gesellschaft die auch mit „anything goes“ charakterisiert werden kann, ist der Mensch gezwungen, sein Leben selbständig zu planen, indem er Entscheidungen trifft. Allerdings ist er zwar in soweit autonom, dass er selbst entscheiden kann, doch sieht er sich gezwungen diese Entscheidungen auch zu begründen. Vor seinem Umfeld, denn es wird von ihm erwartet, dass er weiß was er tut und die Entscheidungen nicht aufs Geratewohl trifft. Aber auch vor sich selbst, um seinem irdischen Leben Sinn zu geben. Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelt Prof. Dr. Ulrich Oevermann das Strukturmodell von Religiosität, welches Gegenstand der vorliegenden Seminararbeit ist. Hierin beschreibt er, wie es im Menschen zur Religiosität kommt respektive kommen muss, auch in einer säkularen Gesellschaft und auch bei „religiös indifferenten“ Menschen. Im Folgenden soll deshalb zunächst der Ansatz Oevermanns dargestellt und erläutert werden. Im Anschluss daran, soll der Fakt, dass auch Menschen, die nicht im weitläufig anerkannten Sinn religiös sind, aber laut Oevermann Religiosität besitzen, mit weiterführender Literatur untersucht werden. Im letzten Teil dieser Arbeit soll ein Fazit durch eine kritische Auseinandersetzung gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Ansatz
- Universelle Geltung und Religionsvergleich
- Das Strukturmodell in einer säkularen Welt
- Religiosität und religiöse Indifferenz in einer sich säkularisierenden Gesellschaft
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung von Religiosität in einer säkularen Gesellschaft aus der Perspektive von Prof. Dr. Ulrich Oevermann. Sie untersucht, wie das von Oevermann entwickelte Strukturmodell von Religiosität die Entstehung von Religiosität erklärt, selbst bei Menschen, die sich nicht als religiös bezeichnen.
- Das Strukturmodell von Religiosität nach Oevermann
- Die Rolle von Entscheidungen und Begründungszwängen in einer säkularen Welt
- Die Bedeutung der Krisenhaftigkeit menschlicher Existenz für die Entstehung von Religiosität
- Religiosität und religiöse Indifferenz im Kontext der Säkularisierung
- Kritische Würdigung des Ansatzes von Oevermann
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des Entscheidungszwangs in einer säkularen Gesellschaft vor und führt das Strukturmodell von Religiosität nach Oevermann ein.
- Der Ansatz: Dieses Kapitel erläutert Oevermanns Ansatz, der davon ausgeht, dass Religiosität nicht aus der Erfahrung von Religion, sondern aus den Strukturen des menschlichen Lebens und der Entscheidungsfindung entsteht. Oevermann unterscheidet dabei verschiedene religionssoziologische Ansätze und kritisiert ihre methodischen Schwächen.
- Religiosität und religiöse Indifferenz in einer sich säkularisierenden Gesellschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, wie sich Religiosität in einer säkularen Gesellschaft manifestiert, insbesondere bei Menschen, die sich selbst nicht als religiös bezeichnen. Es wird die These vertreten, dass auch diese Menschen religiöse Strukturen in ihrem Leben aufweisen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Religiosität, Säkularisierung, Entscheidungstheorie, Strukturmodell, Entscheidungszwang, Begründungszwang, Krisenhaftigkeit, Soziologie der Religion, Ulrich Oevermann.
Häufig gestellte Fragen
Wie entsteht Religiosität laut Ulrich Oevermann?
Nach Oevermann entsteht Religiosität aus der Struktur menschlicher Lebenspraxis, insbesondere aus dem Zwang, unter Krisenbedingungen folgenreiche Entscheidungen treffen und begründen zu müssen.
Warum gilt die Krise als Normalfall des menschlichen Lebens?
Der Mensch muss ständig Entscheidungen treffen, deren Ausgang er nicht überblicken kann. Diese Krisenhaftigkeit zwingt zum Ausbrechen aus Routinen und schafft einen Begründungszwang.
Sind auch „religiös indifferente“ Menschen religiös?
Ja, laut Oevermanns Strukturmodell besitzen auch Menschen, die sich nicht als religiös bezeichnen, religiöse Strukturen, da sie ihrem Leben Sinn geben und ihre Autonomie begründen müssen.
Was bedeutet „anything goes“ für die moderne Religiosität?
In einer Gesellschaft ohne feste Normen ist der Einzelne gezwungen, sein Leben selbstständig zu planen, was den Druck zur individuellen Sinnstiftung und Begründung von Entscheidungen erhöht.
Was ist das Ziel des Strukturmodells von Oevermann?
Das Modell will erklären, wie Religiosität auch in einer vollkommen säkularen Welt als notwendige Struktur der menschlichen Existenz erhalten bleibt.
- Quote paper
- Sarah McCarty (Author), 2009, Die Entstehung von Religiosität in einer säkularen Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161355