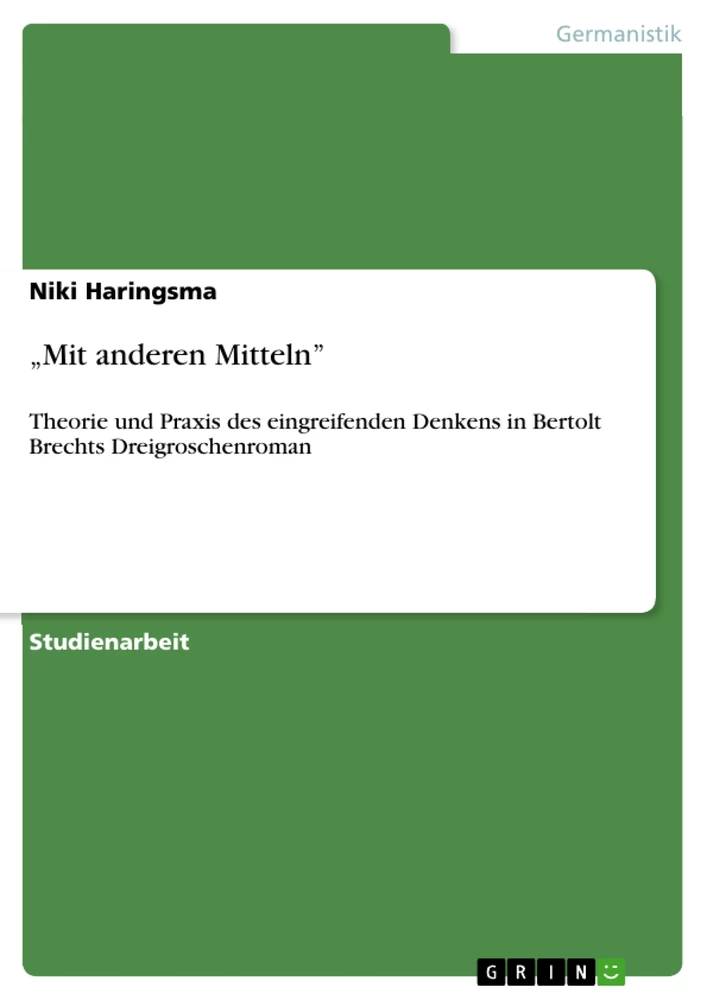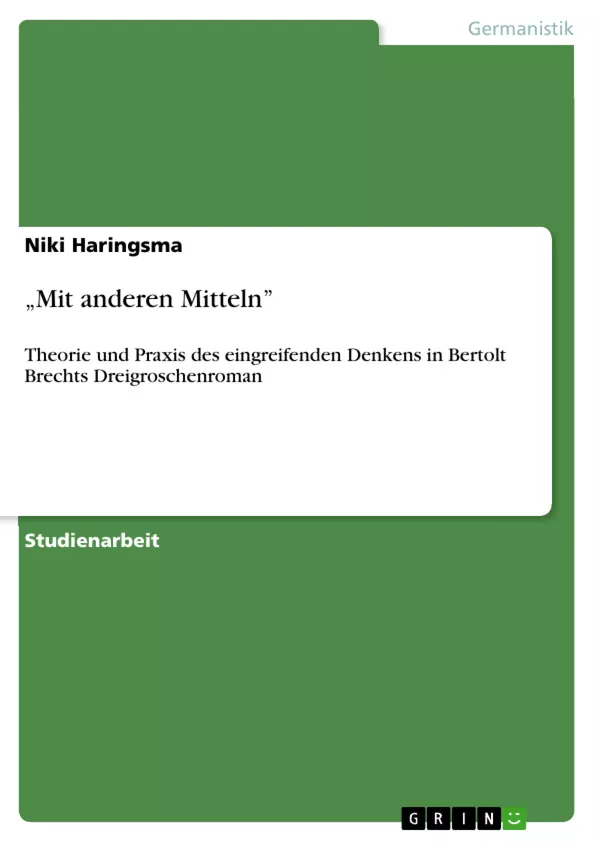Brechts Theorie der eingreifenden Literatur basiert auf einer Schreibweise, mit der er eine aktive, politisch engagierte Haltung bei seinem Publikum erzeugen wollte. Diese Wirkungsintention setzt eine allegorische, modellhafte Verwendung der Textelemente voraus. Die jeweiligen Aspekte (Handlung, Figuren, Form, Verweisungen) eines eingreifenden Textes bilden keine abgeschlossene Einheit, sondern ein literarisches Modell, das eine kritische und individuelle Interpretation des Lesers verlangt. Hieraus ergibt sich, dass der Leser die Möglichkeit bekommt, die im Leseprozess erworbenen Einsichten in seine persönliche Realität zu übertragen.
In dieser Arbeit werde ich die Theorie und Praxis des eingreifenden Denkens beschreiben, und die Rolle, die diese Methodik in Brechts Ideologie gespielt hat. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht die Analyse von Brechts großer Prosaarbeit im dänischen Exil: dem Dreigroschenroman.
In seinem Exilroman konnte Brecht die Fabel der Dreigroschenoper als bekannt voraussetzen und den Inhalt des Stückes als Vorlage für eine Neuinterpretation der Handlung im Buch verwenden. Hieraus ergibt sich, dass der Roman sich als kritische Auseinandersetzung mit dem Stück als Theatererfolg interpretieren lässt: der Text des Buches setzt sich nicht nur mit der ökonomischen und ideologischen Situation Europas im 20. Jahrhundert, sondern auch mit der Popularität der Dreigroschenoper auseinander. Insbesondere dekonstruiert Brecht die positive Interpretation der faschistischen Figur Macheath, die auch heutzutage noch als Ikon der Brechtschen Dichtung in der Popkultur große Popularität genießt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Dreigroschenoper und der Dreigroschenroman
- Das eingreifende Denken
- Eingreifende Sätze und die Wirkung der Historisierung
- Die neuen Elemente des Dreigroschenstoffs im Roman
- Die Rettung der Verbrecher und die Rolle der Opfer
- Multimedialität im textuellen Medium
- Kursivtext und Satire: „Warum das?”
- Das Verhalten der Figuren
- Die bürgerliche Erscheinung des Herrn Macheaths
- Die soziale Abhängigkeit der Figur Polly Peachum
- Ablehnung der Selbstbestimmung
- Der „Stempel des Vertrauten” als eingreifende literarische Technik
- Bewältigungsstrategien der modellhaften Figuren
- Die marxistische Dialektik und der Körper als Handelsware
- Der Faschismus im Dreigroschenroman
- Das Pfund der Armen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Theorie und Praxis des eingreifenden Denkens in Bertolt Brechts „Dreigroschenroman“. Sie untersucht, wie Brecht mithilfe der Romanform seine sozialpolitischen Ideologien vermittelt und den Leser zum kritischen Denken anregt.
- Brechts Theorie der eingreifenden Literatur und ihre Wirkungsintention
- Die Rolle des „Dreigroschenromans“ als Werkzeug zur kritischen Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse
- Die Darstellung von Kapitalismus und Faschismus in Brechts Roman
- Die Verwendung von satirischen Elementen und Modellhaftigkeit in Brechts Text
- Der Einfluss der Exilsituation auf Brechts Schreibweise
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einführung stellt Brechts Theorie der eingreifenden Literatur und ihre Bedeutung für den „Dreigroschenroman“ vor. Sie erklärt die Wirkungsintention des Textes und wie der Leser die darin enthaltenen Modelle auf seine eigene Realität übertragen kann.
- Das Kapitel „Die Dreigroschenoper und der Dreigroschenroman“ vergleicht die beiden Versionen der Geschichte und erläutert, wie Brecht die satirischen Elemente der Dreigroschenoper im Roman neu interpretiert. Es wird die Bedeutung des Textmediums für Brechts Intentionen hervorgehoben.
- Im Kapitel „Das eingreifende Denken“ wird Brechts Konzept des kritischen Denkens und seine Rolle im „Dreigroschenroman“ detailliert erklärt. Der Unterschied zum traditionellen Naturalismus wird anhand von Brechts Schreibweise verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Eingreifende Literatur, Bertolt Brecht, Dreigroschenroman, Kapitalismus, Faschismus, Satire, Modellhaftigkeit, kritisches Denken, Exil, Sozialkritik, Marxismus, Dialektik, Multimedialität, Historisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Brechts Theorie der "eingreifenden Literatur"?
Es ist eine Schreibweise, die das Publikum nicht nur unterhalten, sondern zu einer aktiven, politisch engagierten Haltung und kritischen Analyse der Realität anregen will.
Wie unterscheidet sich der "Dreigroschenroman" von der "Dreigroschenoper"?
Während die Oper oft als bloßer Theatererfolg missverstanden wurde, nutzt der Roman die Fabel für eine tiefere, marxistisch geprägte Analyse von Kapitalismus und Faschismus.
Was bedeutet "Historisierung" bei Brecht?
Es ist eine Technik, die bekannte Zustände als veränderbar und geschichtlich bedingt darstellt, um den Leser aus seiner passiven Akzeptanz der Verhältnisse zu reißen.
Wie wird die Figur Macheath im Roman dargestellt?
Brecht dekonstruiert das Bild des charmanten Gangsters und zeigt Macheath als bürgerlichen Geschäftsmann, dessen kriminelle Energie die Mechanismen des Kapitalismus spiegelt.
Was ist das Ziel von Brechts satirischen Elementen?
Satire dient dazu, gesellschaftliche Widersprüche bloßzustellen und den Leser zu einer kritischen und individuellen Interpretation des literarischen Modells zu zwingen.
- Arbeit zitieren
- Niki Haringsma (Autor:in), 2010, „Mit anderen Mitteln”, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161380