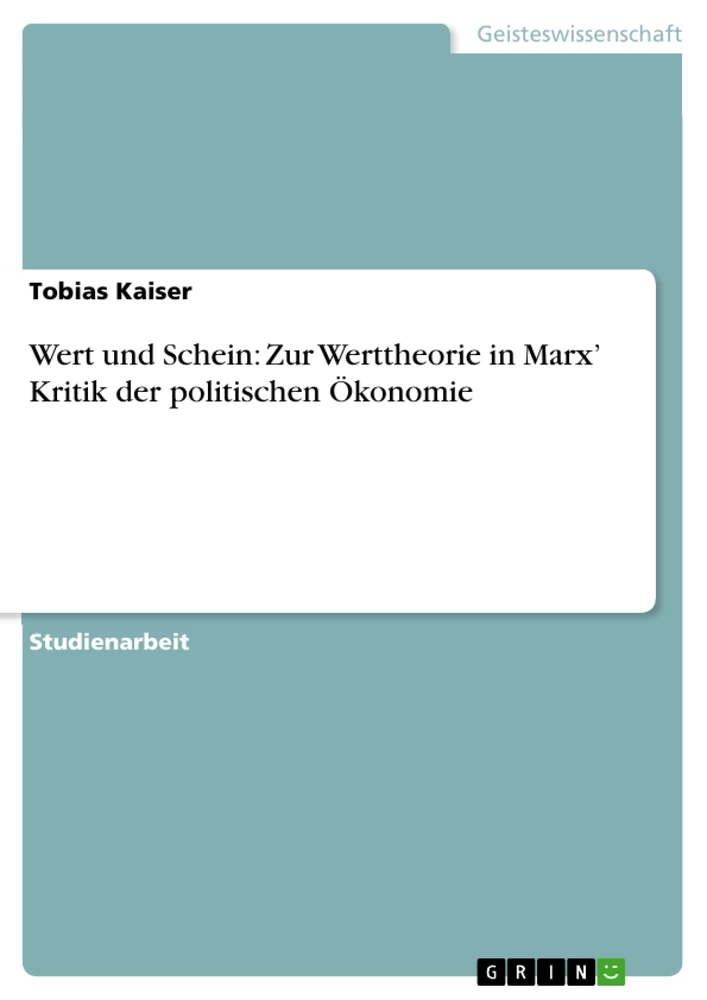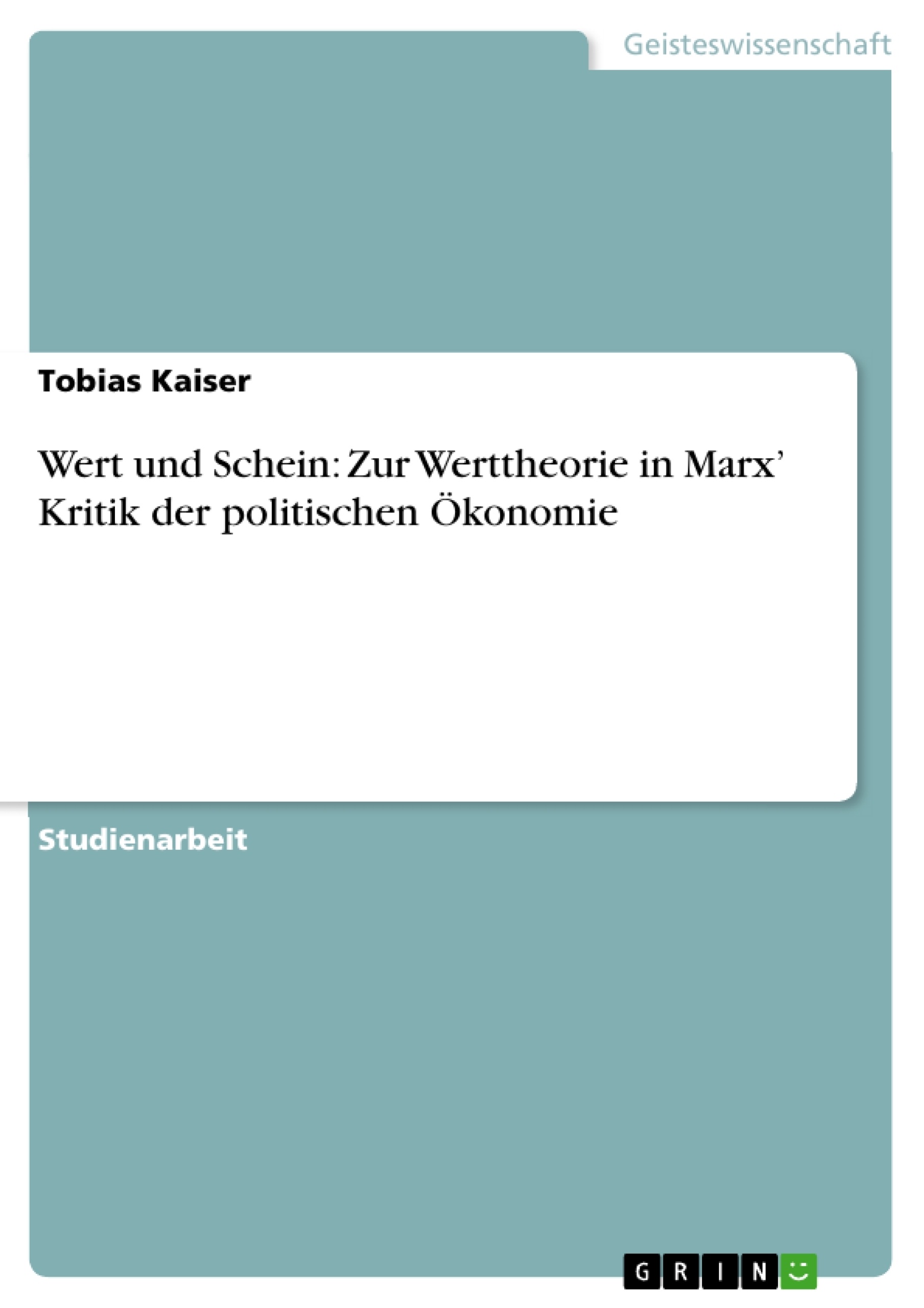Die erste Absicht dieser Arbeit besteht in einer gründlichen und nachvollziehenden Darstellung und vorsichtigen Interpretation der Werttheorie im ersten Kapitel des Marx’schen Kapitals, insbesondere der Kategorie der Ware als solcher und der Genesis der Geldform. Ziel ist es, die konstitutiv-immanente Widersprüchlichkeit der Ware und aller auf dieser beruhenden ‚Folgeschäden’ herauszuarbeiten. Die Ausführlichkeit scheint mir insofern gerechtfertigt, als daß sowohl die zu entwickelnden Kategorien selbst, als auch ihre Zusammenhänge und Mechanismen "vertrackt" und "verschleiert" sind. Außerdem scheint mir ein nicht ungewichtiger Teil der Gesamtproblematik darin zu bestehen, daß die von Marx hier rekonstruierten Begriffe gerne und gängigerweise einfach so verwendet und als gegeben angesehen werden und das, obwohl sie eben von vorneherein keineswegs so klar sind, wie es auf den ersten Blick scheinen mag.
Im Anschluß daran möchte ich, ausgehend von Marx’ Analyse und Betrachtung dessen, was er den "Fetischcharakter der Ware" nennt, die eher metaphysische, gelegentlich religiös anmutende Aura beleuchten, die vor allem Geld und Ware zu umgeben scheint. Schließlich werde ich versuchen, das sich – aus meiner Sicht – im Zusammenspiel der Ergebnisse der ersten beiden Teile abzeichnende Warendispositiv näher zu analysieren. Meine Grundthese dabei: Unserer an verschiedenen Dispositiven nicht armen Gegenwart liegt ein ganz grundlegendes Muster zugrunde, gewissermaßen ein Metadispositiv, das auch den anderen Dispositiven gegenüber als ein solches wirkt. Dieses kann vorläufig mit "Industrialisierung" beschrieben werden. Ihr wesentlicher Keim findet sich dabei bereits im Eröffnungskapitel des Kapitals, was aus meiner Sicht einen faszinierenden und genuin philosophischen Aspekt der Marx’schen Ökonomiekritik jenseits ihrer vielbesprochenen Kampfschrifthaftigkeit ausmacht.
Inhaltsverzeichnis
- Gebrauchswert - Tauschwert - Wert
- Arbeit - Produktion - Produktivkraft
- Arbeit Gesellschaft - Wertform
- Genesis der Geldform
- Metaphysik und Fetisch
- Eine Welt aus Prototypen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Marx' Werttheorie im ersten Kapitel des „Kapitals“, insbesondere die Kategorie der Ware und die Entstehung der Geldform. Sie untersucht die konstitutive Widersprüchlichkeit der Ware und ihrer Folgen und betont die Komplexität der von Marx eingeführten Begriffe. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit den „Fetischcharakter der Ware“ und die metaphysische Aura, die vor allem Geld und Ware umgibt.
- Analyse der Werttheorie in Marx' „Kapital“
- Untersuchung der Kategorie der Ware und ihrer Widersprüchlichkeit
- Erklärung der Genesis der Geldform
- Beleuchtung des „Fetischcharakters der Ware“
- Analyse des „Warendispositivs“ als grundlegendes Muster unserer Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Gebrauchswert - Tauschwert - Wert
Das Kapitel beginnt mit der Analyse der Ware als ein Ding, das menschliche Bedürfnisse befriedigt. Der Gebrauchswert ist mit dem Ding selbst und seiner Nützlichkeit verbunden, während der Tauschwert in der Austauschproportion zu anderen Gebrauchswerten besteht. Die Arbeit untersucht, wie die Abstraktion vom Gebrauchswert den Tauschwert hervorbringt und die menschliche Arbeit als gemeinsame Substanz der Waren identifiziert. - Kapitel 2: Arbeit - Produktion - Produktivkraft
Dieses Kapitel befasst sich mit der Beziehung zwischen Arbeit, Produktion und Produktivkraft. Es analysiert die Rolle der menschlichen Arbeit in der Produktion von Waren und die Herausbildung der Produktivkräfte als Quelle des gesellschaftlichen Reichtums. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Kapitalismus als Produktionssystem, das auf der Ausbeutung von Arbeit basiert. - Kapitel 3: Arbeit Gesellschaft - Wertform
In diesem Kapitel wird die Gesellschaftliche Arbeit als Grundlage des Wertes untersucht. Es geht um die Herausbildung von Wertformen, die den Tausch von Waren ermöglichen, und die Entwicklung des Geldwerts als universelles Tauschmittel. Die Arbeit beleuchtet die Rolle des Staates und der sozialen Strukturen im Kontext der Wertform und des Wertesystems. - Kapitel 4: Genesis der Geldform
Das Kapitel analysiert den historischen Prozess der Entstehung der Geldform. Es untersucht die Rolle des Geldes als universelles Äquivalent und die Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Arbeit diskutiert die Rolle des Geldes als Mittel der Akkumulation und die Entstehung des Kapitalismus. - Kapitel 5: Metaphysik und Fetisch
Dieses Kapitel beleuchtet den „Fetischcharakter der Ware“ und die metaphysische Aura, die Geld und Ware umgibt. Es analysiert, wie der Wert der Waren von ihrer materiellen Form getrennt wird und eine selbstständige Existenz erlangt. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen dieser Fetischisierung auf die menschlichen Beziehungen und das gesellschaftliche Bewusstsein. - Kapitel 6: Eine Welt aus Prototypen
Der letzte Abschnitt der Arbeit untersucht das „Warendispositiv“ als grundlegendes Muster unserer heutigen Gesellschaft. Es analysiert, wie die Industrialisierung und die Dominanz des Warencharakters alle Lebensbereiche prägt. Die Arbeit argumentiert, dass das Warendispositiv ein „Metadispositiv“ ist, das anderen Dispositiven gegenüber als ein solches wirkt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Werttheorie, der Kategorie der Ware, der Geldform, des Fetischcharakters, der Industrialisierung und des Warendispositivs. Sie analysiert die Widersprüchlichkeit des Kapitalismus und die Bedeutung der menschlichen Arbeit im Produktionsprozess. Wichtige Begriffe sind Gebrauchswert, Tauschwert, Wert, Arbeitsprodukt, abstrakte Arbeit, Geld, Fetisch, Dispositiv und Industrialisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Gebrauchswert und Tauschwert bei Marx?
Der Gebrauchswert bezieht sich auf die Nützlichkeit eines Dinges, während der Tauschwert das quantitative Verhältnis ausdrückt, in dem Waren gegeneinander getauscht werden.
Was versteht Marx unter dem "Fetischcharakter der Ware"?
Er beschreibt damit das Phänomen, dass gesellschaftliche Verhältnisse zwischen Menschen als sachliche Verhältnisse zwischen Dingen (Waren) erscheinen.
Wie entsteht laut Marx die Geldform?
Die Geldform entwickelt sich historisch aus der Notwendigkeit eines allgemeinen Äquivalents, um den Tausch verschiedenartiger Waren zu ermöglichen.
Was ist "abstrakte Arbeit" im Kontext der Werttheorie?
Abstrakte Arbeit ist die von der konkreten Form der Tätigkeit abgesehene menschliche Arbeit, die die gemeinsame Substanz des Werts aller Waren bildet.
Was beschreibt das "Warendispositiv" in dieser Arbeit?
Es wird als ein grundlegendes Metadispositiv unserer Gegenwart analysiert, das durch die Industrialisierung alle Lebensbereiche nach dem Muster der Ware prägt.
Warum bezeichnet Marx die Kategorien der Ware als "vertrackt" und "verschleiert"?
Weil sie auf den ersten Blick einfach erscheinen, aber komplexe gesellschaftliche Widersprüche und metaphysische Feinheiten verbergen.
- Arbeit zitieren
- Tobias Kaiser (Autor:in), 2009, Wert und Schein: Zur Werttheorie in Marx’ Kritik der politischen Ökonomie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161446