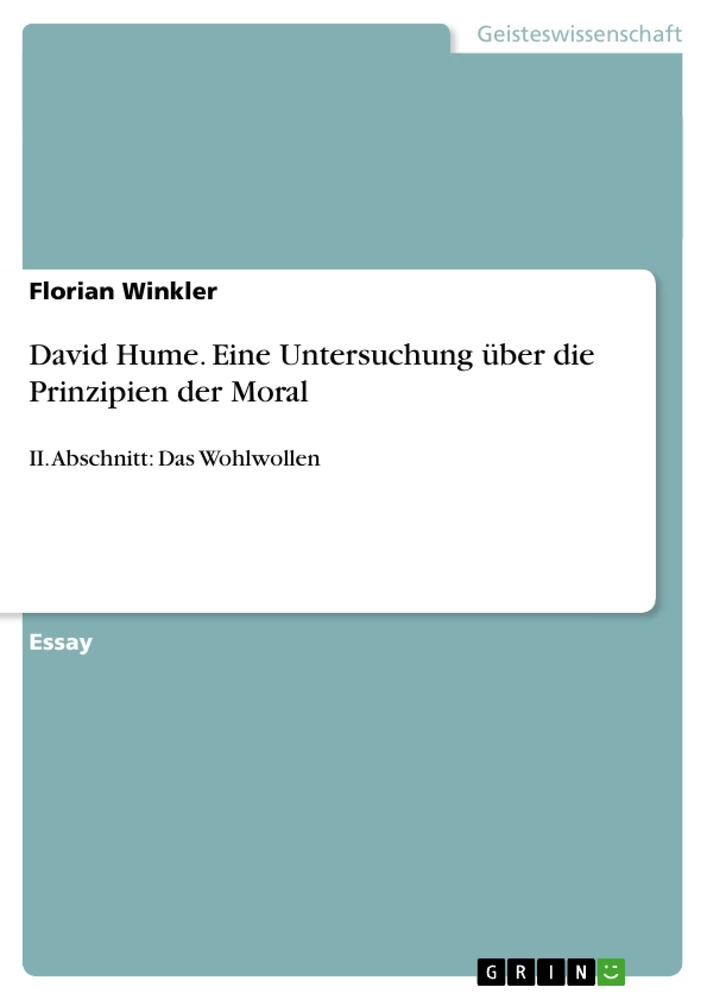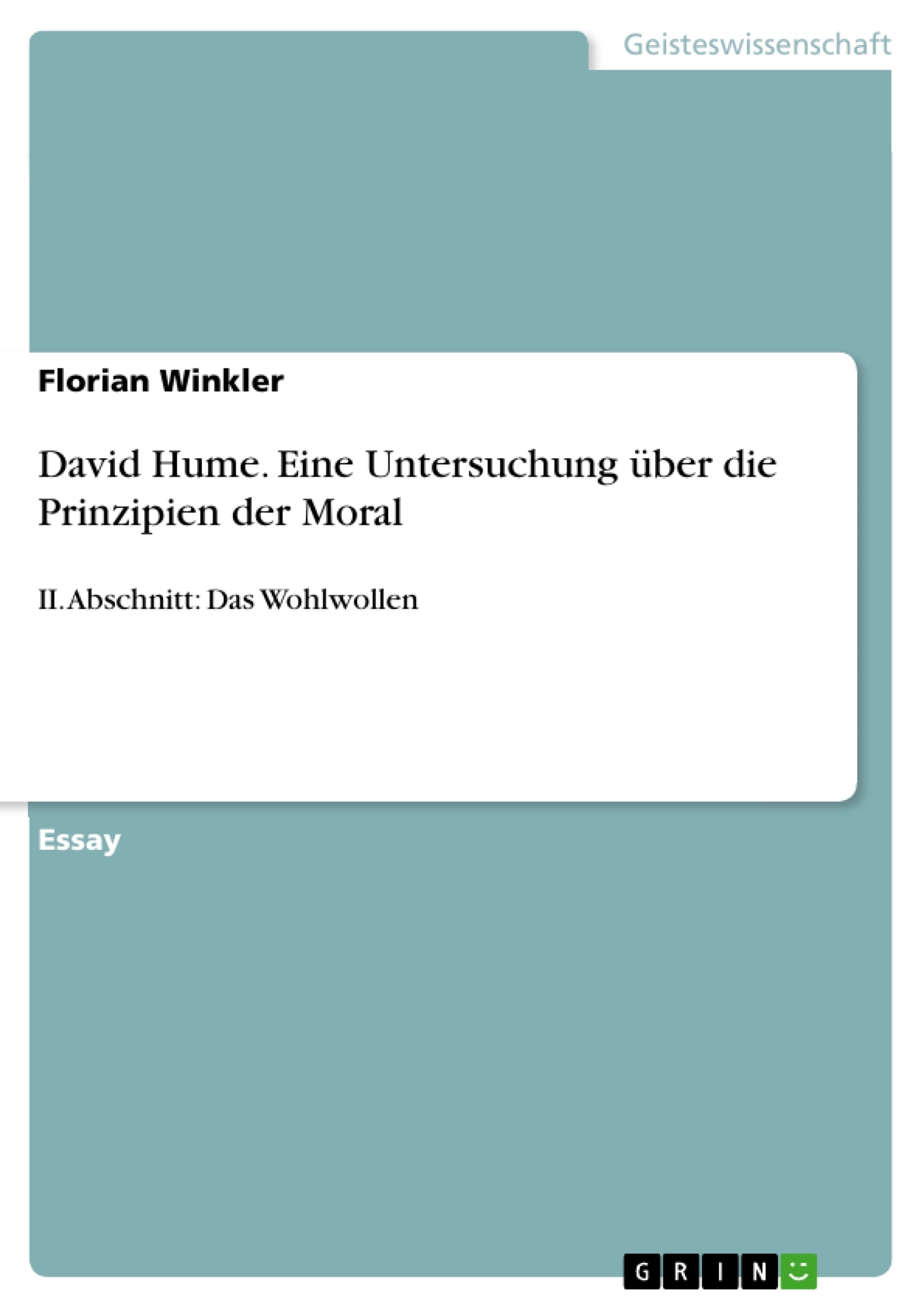David Hume (*1711 in Edinburgh; † 1776 ebenda) zählt neben vielen anderen – wie beispielsweise Rosseau, Voltaire, Berkeley und Locke – zu den größten Denkern der damaligen geistesgeschichtlichen Epoche – der Aufklärung. Unter anderem ist es ihm zu verdanken, dass das Zeitalter der Aufklärung „zum Gegenstand so vieler ausgezeichneter Darstellungen und Untersuchungen gemacht worden“ (Kopper 1996: S. VII) ist.
Die beiden zitierten Textstellen (siehe S. 1/7) stammen aus Humes Werk „Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral“ - Zweiter Abschnitt, „Über das Wohlwollen“, Zweiter Teil, S. 99. Beide Passagen stehen in einem gewissen Kontext zueinander und sollen daher auch in diesem analysiert werden. Dieser Zusammenhang besteht unter anderem darin, dass David Hume kurz zuvor im selbigen zweiten
Abschnitt von „Über das Wohlwollen“ darauf eingeht, dass, wenn sich eine bis dato als richtig geltende Meinung als überholt und somit falsch herausstellt – zum Beispiel durch neue Erfahrungen (Vgl. Hume 2002: S. 98 /99) – es die Aufgabe der Gesellschaft ist, die „Grenzen des moralisch Guten und Schlechten“ (Hume 2002: S. 99) neu zu
bestimmen. Bei den beiden zitierten Stellen handelt es sich nach der Auffassung Humes um derartige neu zu bestimmende Fälle, die wiederum von ihrer Art her – zum einem Barmherzigkeit und zum anderen Freigebigkeit – dahingehend im Kontext stehen, dass es sich vordergründig um die Frage dreht, wen ich an meinem „Reichtum“ teilhaben lasse und ob dies überhaupt zu rechtfertigen ist. Des Weiteren soll anhand dieser zwei Textstellen – im Gesamtkontext mit dem Abschnitt „Über das Wohlwollen“ – analysiert werden, inwiefern Hume im Gegensatz zu antiken Denkern – im Speziellen Aristoteles
– in Bezug auf Tugenden, wie beispielsweise die der Freigebigkeit, einen anderen Standpunkt einnimmt.
Zur kurzen vorherigen Erläuterung, wie laut Hume der Vorgang zur Unterscheidung zwischen „moralisch Guten und Schlechten“ vonstattengeht, lässt sich das Folgende sagen: Nach Hume besteht „zwischen moralischen und ästhetischen Eigenschaften“
(Kulenkampff 2003: S. 107) eine Analogie dahingehend, wie wir sie erfassen.
Ästhetische Eigenschaften werden unmittelbar erfasst und lösen ein Urteil aus (Vgl. Kulenkampff 2003: ebenda). Gleiches gilt für moralische Einschätzungen. Wenn sich dieses moralische Urteil allerdings im Laufe der Zeit, wie schon zuvor angesprochen,
etwa durch neue Erfahrungen, wandelt, dann...
Inhaltsverzeichnis
- II. Abschnitt: Das Wohlwollen
- Analyse des angegebenen Zitats
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse untersucht David Humes Gedanken zum Wohlwollen, insbesondere im Kontext seiner „Untersuchung über die Prinzipien der Moral". Der Essay befasst sich mit der Frage, wie die Grenzen von moralischem Verhalten im Zusammenhang mit Barmherzigkeit und Freigebigkeit neu definiert werden können.
- Humes Kritik an unreflektierter Barmherzigkeit und Freigebigkeit
- Die Bedeutung des Nutzens für moralische Urteile
- Humes Abgrenzung von antiken Denkern wie Aristoteles
- Die Rolle der Erfahrung in der moralischen Entwicklung
- Die Unterscheidung zwischen „gefälligen Diensten“ und nutzlosem Almosen
Zusammenfassung der Kapitel
Im zweiten Abschnitt seiner „Untersuchung über die Prinzipien der Moral“ analysiert David Hume das Konzept des Wohlwollens. Er argumentiert, dass die bloße Barmherzigkeit oder Freigebigkeit gegenüber Bedürftigen nicht unbedingt moralisch ist, wenn sie Faulheit oder Ausschweifung fördert. Hume betont, dass wahre Tugend darin besteht, Handlungen zu bewerten, die einen Nutzen für die Gesellschaft bringen. In diesem Zusammenhang bezieht sich der Essay auf die Unterscheidung zwischen „gefälligen Diensten“ und nutzlosem Almosen. Hume widerlegt die traditionellen tugendhaften Bedeutungen von Barmherzigkeit und Freigebigkeit, indem er sie als potentiell schädliche Verhaltensweisen bezeichnet, die im Widerspruch zu einem moralisch wünschenswerten Verhalten stehen.
Schlüsselwörter
Der Essay beschäftigt sich mit zentralen Fragen der Moralphilosophie, insbesondere mit den Begriffen des Wohlwollens, der Barmherzigkeit, der Freigebigkeit und des Nutzens. Im Fokus steht die Analyse von Humes Argumentation, die traditionelle Tugenden in Frage stellt und die Bedeutung der Erfahrung für die moralische Entwicklung betont. Der Essay befasst sich zudem mit der Unterscheidung zwischen „gefälligen Diensten“ und unreflektiertem Almosen sowie mit der Abgrenzung von Humes Position zu antiken Denkern wie Aristoteles.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Standpunkt vertritt David Hume zum Thema Barmherzigkeit?
Hume kritisiert unreflektierte Barmherzigkeit, wenn sie lediglich Faulheit fördert, und fordert eine Neubewertung basierend auf dem gesellschaftlichen Nutzen.
Wie unterscheidet sich Hume von Aristoteles in Bezug auf Tugenden?
Im Gegensatz zu antiken Denkern wie Aristoteles bewertet Hume Tugenden wie Freigebigkeit stärker nach ihrem praktischen Nutzen für die Gesellschaft als nach rein moralischen Idealen.
Was ist für Hume die Basis für moralische Urteile?
Hume sieht eine Analogie zwischen ästhetischen und moralischen Urteilen; beide werden unmittelbar erfasst, können sich aber durch neue Erfahrungen und Erkenntnisse über den Nutzen wandeln.
Was versteht Hume unter „gefälligen Diensten“?
Gefällige Dienste sind Handlungen, die einen echten sozialen Wert haben, im Gegensatz zu „nutzlosem Almosen“, das keine nachhaltige Verbesserung bewirkt.
Welche Rolle spielt die Erfahrung in Humes Moralphilosophie?
Erfahrung ist essenziell, um die Folgen von Handlungen zu bewerten und somit die Grenzen zwischen moralisch Gutem und Schlechtem stetig neu zu definieren.
- Quote paper
- Florian Winkler (Author), 2010, David Hume. Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161454