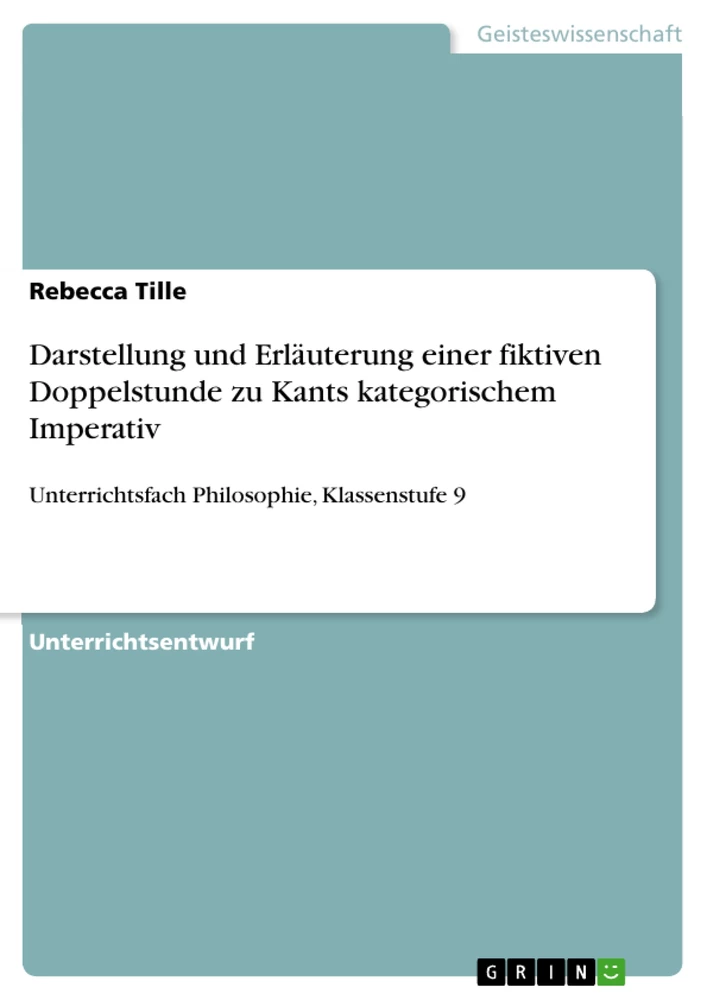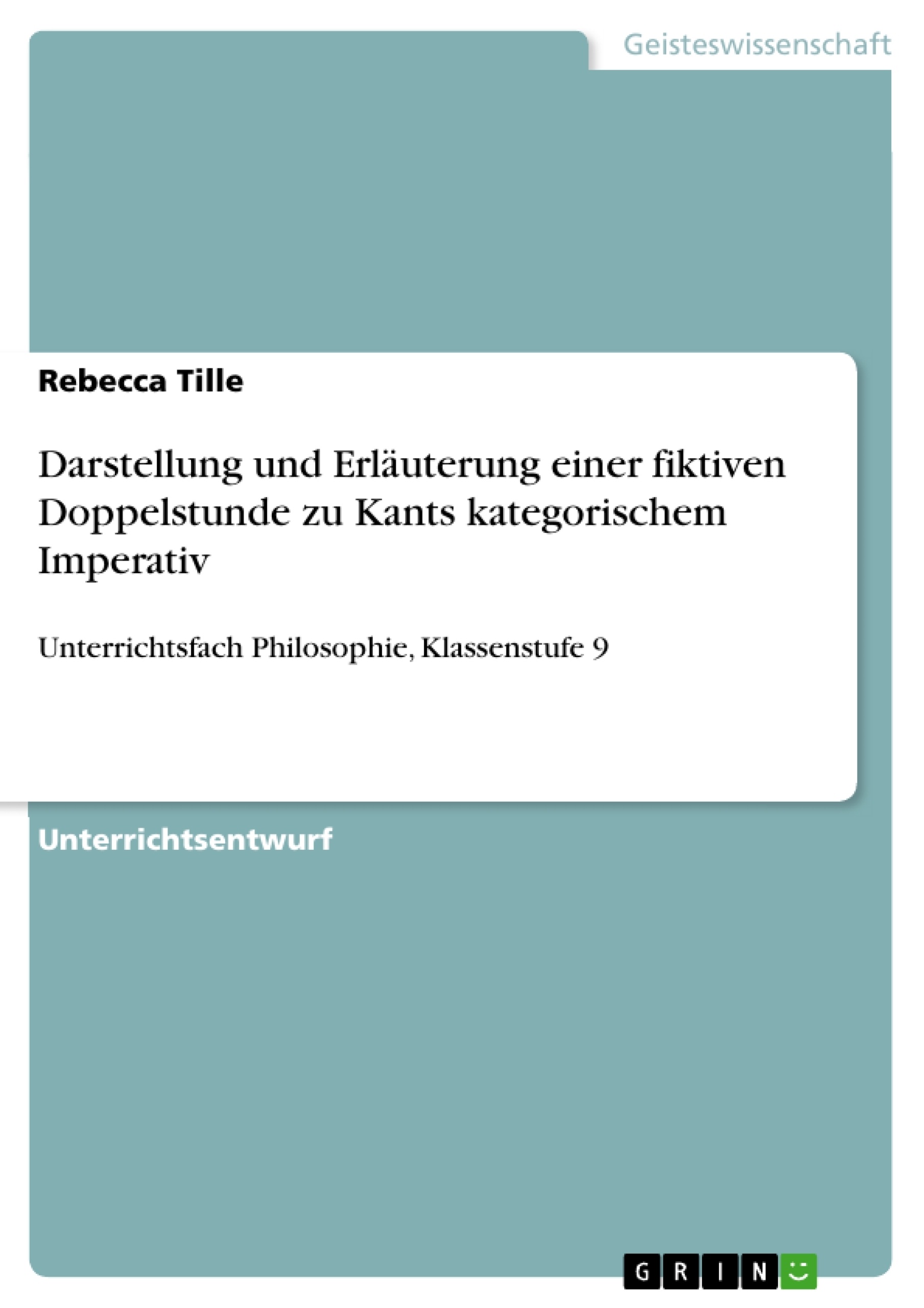Gemäß Kant ist allein ein guter Wille als Handlungsabsicht moralisch gut. Doch welches Gesetz bestimmt den Willen, damit er einschränkungslos gut ist? Woraus ergibt sich die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Handlung?
Thema dieser Hausarbeit soll es sein, eine fiktive Doppelstunde zu Kants kategorischem Imperativ darzustellen, zu begründen und ausreichend zu erläutern. Die geplanten Ethikstunden sind für Klassenstufe 10 des Gymnasiums konzipiert.
Die Schüler sollen Kants Grundposition zu moralisch richtigem Handeln kennenlernen. Dazu gehört die Universalisierungsformel des kategorischen Imperativs, die Definition des guten Willens sowie weiterer philosophischer Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Maxime oder Autonomie. Es soll weiterhin Kants Pflichtbegriff geklärt werden, wobei die Schüler zwischen pflichtgemäßen Handeln und Handeln aus Pflicht unterscheiden sollen. Des Weiteren soll die Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs in der eigenen Lebenswirklichkeit der Schüler, anhand von beispielhaften Handlungssituationen, angewandt und überprüft werden.
Kants „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ soll in kleinen Auszügen gelesen werden, somit können die Schüler sich darin versuchen Argumentationsstrukturen bereits am Originaltext aufzuschlüsseln und nachzuvollziehen.
Es handelt sich hierbei um ein sehr abstraktes Stundenthema. Daher soll der Unterrichtsverlauf zwar exemplarisch und verständlich gekennzeichnet sein, damit die Schüler, wie bereits erwähnt, Bezug auf ihre Erfahrungs- und Lebenswelt nehmen können, aber trotz dessen sollte er nicht zu einfach konzipiert sein und die Schüler geistig unterfordern oder langweilen.
Die Schüler sollen ein Gefühl für die Bedeutung philosophischer Ethik erhalten und verstehen, dass es wichtig ist, eigenes Handeln in moralischer Hinsicht zu überprüfen und Urteile angemessen begründen und vertreten zu können.
Dass Kants kategorischer Imperativ Schwächen aufweist, beispielsweise bei einer Normen- und Wertekollision, soll innerhalb dieser einführenden Doppelstunde nicht thematisiert werden. Sein Wesen lässt sich nicht erfassen und schätzen, wenn die Beschäftigung mit ihm sogleich dadurch entwertet wird, dass er ja letztlich auch nicht helfe moralisch richtig zu handeln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sachanalyse
- ,,Klarheiten"
- Didaktische Konzeption
- Vorüberlegungen
- Stundenverlauf
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Hausarbeit ist die Darstellung und Erläuterung einer fiktiven Doppelstunde zum kategorischen Imperativ Immanuel Kants, die für die Klassenstufe 10 des Gymnasiums konzipiert ist. Der Fokus liegt auf der Vermittlung der grundlegenden Positionen Kants zum moralischen Handeln, darunter die Universalisierungsformel des kategorischen Imperativs, die Definition des guten Willens und die Unterscheidung zwischen pflichtgemäßen und pflichtmäßigen Handlungen.
- Der kategorische Imperativ als Grundlage für moralisch richtiges Handeln
- Die Definition des guten Willens und seine Bedeutung für die Ethik Kants
- Die Unterscheidung zwischen pflichtgemäßen und pflichtmäßigen Handlungen
- Die Anwendbarkeit des kategorischen Imperativs in konkreten Handlungssituationen
- Die Bedeutung philosophischer Ethik für die Überprüfung und Begründung des eigenen Handelns
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Frage nach dem Gesetz, das den guten Willen bestimmt. Sie beschreibt den Fokus der fiktiven Doppelstunde und die Lernziele für die Schüler. Die Sachanalyse beleuchtet Kants Ethik im Vergleich zu anderen philosophischen Positionen und stellt den kategorischen Imperativ als geeigneten Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit der philosophischen Begründung moralischen Handelns vor.
Der Abschnitt ,,Klarheiten" befasst sich mit der Definition des guten Willens und seiner Bedeutung für das moralische Handeln. Dabei wird die Rolle der Vernunft und die Unterscheidung zwischen pflichtgemäßem Handeln und Handeln aus Pflicht erläutert. Die didaktische Konzeption präsentiert die Vorüberlegungen und den geplanten Stundenverlauf der fiktiven Doppelstunde.
Schlüsselwörter
Kategorischer Imperativ, guter Wille, pflichtgemäßes Handeln, Handeln aus Pflicht, Maxime, Universalisierungsformel, Vernunft, Ethik, moralisch richtig, Handlungsabsicht, Motivation, Philosophie, Kant.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der kategorische Imperativ?
Er ist ein moralisches Gesetz von Immanuel Kant, das besagt: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“
Was versteht Kant unter dem „guten Willen“?
Für Kant ist allein ein guter Wille als Handlungsabsicht ohne Einschränkung moralisch gut, unabhängig von den Folgen der Handlung.
Was ist der Unterschied zwischen „pflichtgemäßem Handeln“ und „Handeln aus Pflicht“?
Pflichtgemäßes Handeln geschieht aus Neigung oder Eigennutz, während Handeln aus Pflicht nur aus Achtung vor dem moralischen Gesetz erfolgt.
Wie kann der kategorische Imperativ im Alltag angewendet werden?
Man überprüft seine Handlungsabsicht (Maxime), indem man sich fragt, ob es für die Gesellschaft tragbar wäre, wenn jeder in dieser Situation so handeln würde.
Warum wird dieses Thema in der 10. Klasse unterrichtet?
Schüler sollen lernen, ihr eigenes Handeln moralisch zu überprüfen und ethische Urteile rational zu begründen.
- Quote paper
- Rebecca Tille (Author), 2010, Darstellung und Erläuterung einer fiktiven Doppelstunde zu Kants kategorischem Imperativ, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161480