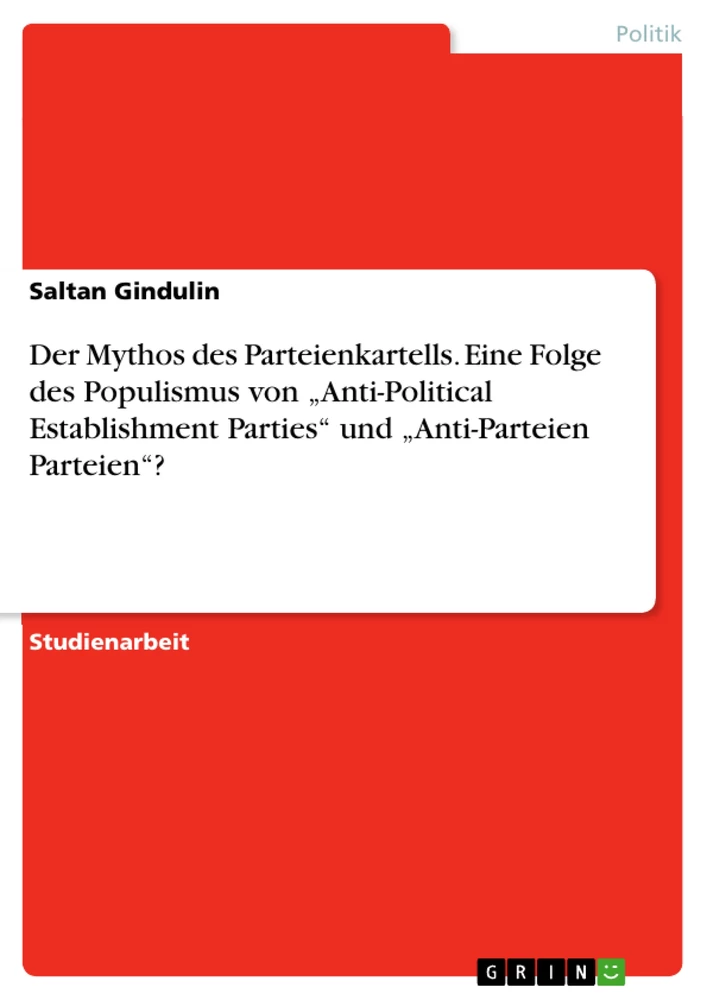Die neueren Befunde der Parteienforschung haben eins gemein, sie zeigen, dass die Parteienlandschaften der sogenannten „etablierten“ westlichen Demokratien oder besser „advanced post-industrial democracies“(Kitschelt: 2000.) in Europa einem wachsenden Veränderungsdruck unterliegen. Die Gründe hierfür sind zahlreich, sie umfassen den Wegfall alter Cleavage-Strukturen bedingt durch „den im Zeitverlauf variablen Grad an ökonomischer und sozio-kulturelle[] Homogenität als gesellschaftlichem Rahmen“ (Detterbeck/Renzsch: Parteienwettbewerb, S. 39.) , genauso wie die zunehmende Europäisierung, Globalisierung, Individualisierung der Gesellschaft und daraus folgenden oder koinzidenten Veränderungen des politischen Systems. Im Hinblick auf die Parteienforschung heißt dies zweierlei Dinge. Zum einen führen diese Veränderungen zum Aufkommen neuer Erklärungsmodelle und neuer Parteientypen bzw. Subtypen, welche wie auch in der Vergangenheit in der Praxis nicht immer trennscharf zu unterscheiden und mehr oder minder plausibel oder kontrovers sind. Zum anderen setzen diese Veränderungen auch die älteren Erklärungs- und Forschungsmodelle unter Druck, die hin und wieder Allgemeingültigkeit und teilweise Endgültigkeit für sich beansprucht haben. Fünfzig Jahre alte Zitate, wie das folgende, haben zwar noch immer Gültigkeit, aber sie erfassen einen Großteil der Veränderungen nicht:
„Heute haben politische Parteien die Funktion, die durch die fortschreitende Demokratisierung von Millionen von Menschen freigesetzten Aktivbürger zu politischen Handlungseinheiten zu organisieren. Sie sind sozusagen das unentbehrliche Werkzeug, um das sich selbst organisierende Volk politisch aktionsfähig zu machen“ (Leibholz, Gerhard: Zum Begriff und Wesen der Demokratie, (1956). Zitiert, weil Leibholz wohl die theoretische Grundlage für das zumindest in der Theorie, hier soll keine Position bezogen werden, mögliche Kartellisieren von Parteien gelegt hat. Vgl. hierzu auch Walter: 2010 das Kapitel „Leibholz und die Folgen“.).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Warum ist die Frage relevant, was und wem nutzt eine Antwort?
- Populismus als „Kitt“ zwischen den drei Parteitypen
- Wie passen die drei unterschiedlichen Parteitypen zusammen?
- Anti-Political Establishment Parties (APE) und Anti-Parteien Partei (APP)
- Fragerelevante Definitionsmerkmale der Cartel Party und die Argumentation der „Herausforderer“
- Modellentwicklung
- Das „Wähler-Wahrnehmungsmodell“
- Ausbaufähigkeit des „Wähler-Wahrnehmungsmodells“
- Ergebnisse, Thesen, Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Populismus auf die Entstehung von Parteitypen wie „Anti-Political Establishment Parties“ und „Anti-Parteien Parteien“ im Kontext des „Cartel Party“-Modells. Ziel ist die Entwicklung eines Wähler-Wahrnehmungsmodells, welches die Wahrnehmung dieser Parteitypen durch die Wähler berücksichtigt.
- Der Einfluss von Populismus auf die Parteienlandschaft
- Die Charakteristika von „Anti-Political Establishment Parties“ und „Anti-Parteien Parteien“
- Das „Cartel Party“-Modell und seine Kritik
- Entwicklung eines Wähler-Wahrnehmungsmodells
- Der Wandel des Parteiensystems
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel der Parteienlandschaft in westlichen Demokratien aufgrund von Faktoren wie dem Wegfall alter Cleavage-Strukturen, Europäisierung, Globalisierung und Individualisierung. Sie führt in die Problematik ein, dass etablierte Parteien oft als „Establishment“ wahrgenommen werden, was zum Aufkommen neuer Parteitypen und zur Herausbildung neuer Erklärungsmodelle führt. Die Arbeit stellt die Frage, ob Populismus die Entstehung von „Cartel Parties“, also einer vermeintlichen Einigung des Establishments, und die Herausbildung von „Anti-Political Establishment Parties“ und „Anti-Parteien Parteien“ beeinflusst.
Warum ist die Frage relevant, was und wem nutzt eine Antwort?: Dieses Kapitel beleuchtet die Relevanz der Forschungsfrage. Es wird argumentiert, dass die zunehmende Distanzierung von Wählern vom politischen Establishment und das Aufkommen neuer Parteitypen ein tiefes Verständnis erfordern. Die Arbeit möchte nicht die Existenz eines Parteienkartells beweisen, sondern die Wahrnehmung dieses Phänomens durch die Wähler analysieren.
Populismus als „Kitt“ zwischen den drei Parteitypen: Dieses Kapitel untersucht den Populismus als strategisches Mittel von „Anti-Political Establishment Parties“ und „Anti-Parteien Parteien“ im Kampf gegen das etablierte Parteienkartell. Es analysiert, wie diese Parteien Populismus einsetzen, um Wähler anzuziehen und sich gegen das „Establishment“ zu positionieren. Die Kapitelteile beleuchten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Parteitypen und wie sie im Kontext des Populismus zusammenhängen.
Modellentwicklung: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung eines „Wähler-Wahrnehmungsmodells“, welches die Wahrnehmung der verschiedenen Parteitypen durch die Wähler im Mittelpunkt stellt. Es wird dargelegt, wie die Wähler die Strategien und den Populismus dieser Parteien bewerten und wie dies ihren Erfolg beeinflusst. Der Fokus liegt auf der Wählerperspektive und deren Rolle im Wandel des Parteiensystems.
Schlüsselwörter
Populismus, Cartel Party, Anti-Political Establishment Parties, Anti-Parteien Parteien, Wählerwahrnehmung, Parteienlandschaft, Parteiensystem, Veränderung, Establishment, Demokratie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Der Einfluss von Populismus auf die Entstehung neuer Parteitypen
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Populismus auf die Entstehung neuer Parteitypen, insbesondere „Anti-Political Establishment Parties“ (APE) und „Anti-Parteien Parteien“ (APP), im Kontext des „Cartel Party“-Modells. Der Fokus liegt auf der Wahrnehmung dieser Parteien durch die Wähler.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die Entwicklung eines „Wähler-Wahrnehmungsmodells“, das die Wahrnehmung von APEs, APP und etablierten Parteien (Cartel Parties) durch die Wähler berücksichtigt und deren Einfluss auf den Wandel des Parteiensystems erklärt.
Welche Parteitypen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert drei Parteitypen: „Cartel Parties“ (etablierte Parteien), „Anti-Political Establishment Parties“ (APE) und „Anti-Parteien Parteien“ (APP). Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten dieser Typen, insbesondere im Kontext des Populismus.
Welche Rolle spielt der Populismus in der Arbeit?
Populismus wird als strategisches Mittel von APEs und APP betrachtet, um sich gegen das etablierte Parteienkartell („Cartel Parties“) zu positionieren und Wähler anzuziehen. Die Arbeit untersucht, wie Populismus die Wahrnehmung dieser Parteien beeinflusst.
Was ist das „Cartel Party“-Modell?
Das „Cartel Party“-Modell beschreibt eine vermeintliche Einigung des politischen Establishments. Die Arbeit untersucht nicht die Existenz dieses Kartells selbst, sondern die Wahrnehmung dieses Phänomens durch die Wähler und wie dies die Entstehung von APEs und APP beeinflusst.
Was ist das „Wähler-Wahrnehmungsmodell“?
Das „Wähler-Wahrnehmungsmodell“ ist ein zentrales Ergebnis der Arbeit. Es beschreibt, wie Wähler die Strategien und den Populismus der verschiedenen Parteitypen bewerten und wie diese Bewertung ihren Erfolg beeinflusst. Es stellt die Wählerperspektive in den Mittelpunkt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Relevanz der Forschungsfrage, ein Kapitel zum Populismus als „Kitt“ zwischen den drei Parteitypen, ein Kapitel zur Modellentwicklung und abschließend ein Kapitel mit Ergebnissen, Thesen und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Populismus, Cartel Party, Anti-Political Establishment Parties, Anti-Parteien Parteien, Wählerwahrnehmung, Parteienlandschaft, Parteiensystem, Veränderung, Establishment, Demokratie.
Warum ist die Forschungsfrage relevant?
Die zunehmende Distanzierung der Wähler vom politischen Establishment und das Aufkommen neuer Parteitypen erfordern ein tiefes Verständnis der zugrundeliegenden Prozesse. Die Arbeit trägt dazu bei, die Wahrnehmung dieser Entwicklungen durch die Wähler zu analysieren.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Der Aufbau gliedert sich in Einleitung, Begründung der Relevanz der Forschungsfrage, Analyse des Populismus als verbindendes Element der drei Parteitypen, Entwicklung des Wähler-Wahrnehmungsmodells und schließlich Zusammenfassung der Ergebnisse, Thesen und Schlussfolgerungen.
- Quote paper
- Saltan Gindulin (Author), 2010, Der Mythos des Parteienkartells. Eine Folge des Populismus von „Anti-Political Establishment Parties“ und „Anti-Parteien Parteien“?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161522