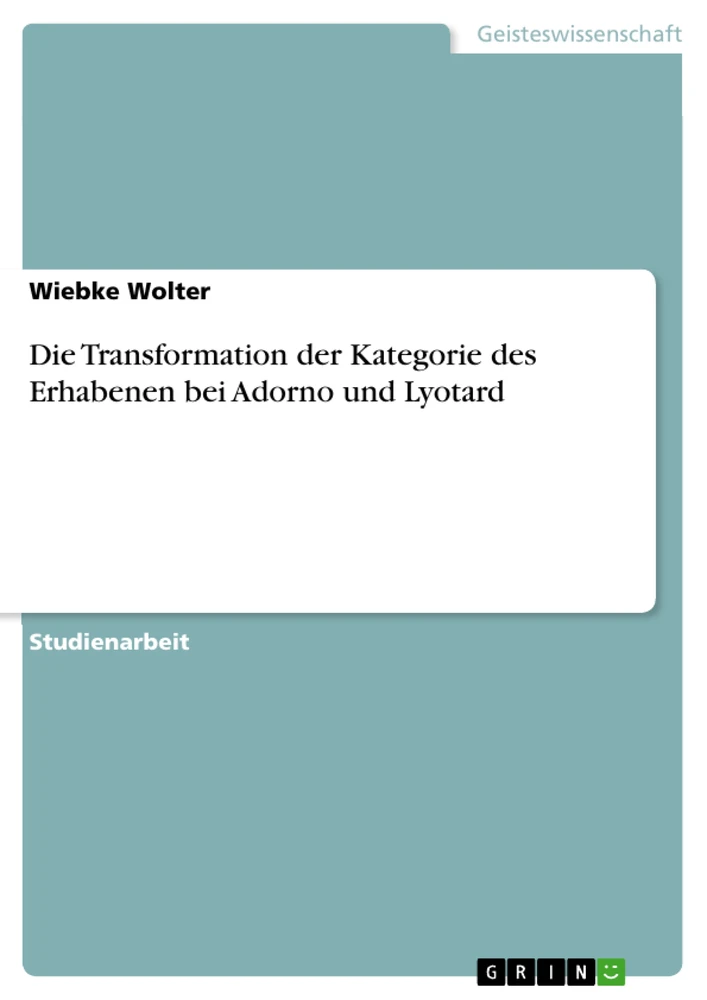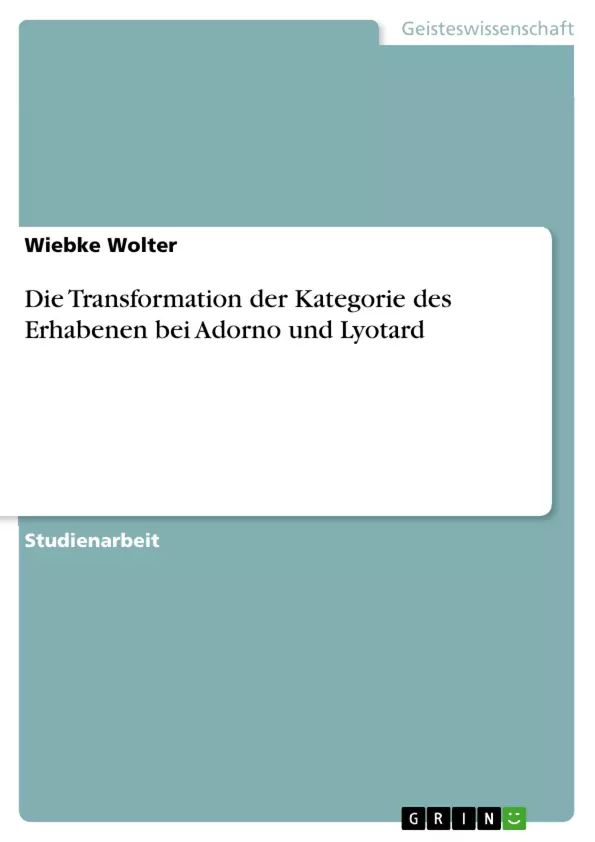Auf den ersten Blick drängt es sich nicht gerade auf, Adornos Ästhetische Theorie als Theorie des Erhabenen zu lesen, denn quantitativ gesehen ist der Begriff „erhaben“ nicht sehr präsent in Adornos Schrift. Es gibt nur fünf Seiten, ganz am Ende der Ästhetischen Theorie, die sich explizit mit dem Erhabenen auseinandersetzen. Dennoch gibt Adorno viele Hinweise darauf, dass es sich bei seiner Ästhetik um eine Ästhetik des Erhabenen handelt. Adorno schreibt, dass nach dem „Sturz formaler Schönheit, die Moderne hindurch von den traditionellen ästhetischen Ideen seine [die erhabene Idee] allein übrig“ blieb, das Erhabene „zum geschichtlichen Konstituens von Kunst selbst“ wurde und „sich die Kunst im Moment des Erhabenen zusammen[zieht]“. Wenn man diese Aussagen Adornos ernst nimmt, dann ist es mehr als plausibel „das Erhabene“ in der Ästhetischen Theorie in den Fokus zu heben.
Wolfgang Welsch und auch Sabine Sander haben in ihrer Adorno-Interpretation die Kategorie des Erhabenen bei Adorno an eine prominente Stelle gerückt. Der Titel von Welschs Aufsatz lautet „Adornos Ästhetik: eine implizite Ästhetik des Erhabenen“. Er versucht darzulegen, dass auch wenn der Begriff nicht explizit auftaucht, Adornos Ästhetische Theorie eine Theorie des Erhabenen ist - dass auch überall dort, wo Adorno vom Schönen spricht, ebenso „erhaben“ stehen könnte. Sabine Sander hat in ihrer Dissertation mit dem Titel „Der Topos der Undarstellbarkeit“ unter anderem Adornos paradoxe Anforderung an die Kunst „die Kommunikation des Unkommunizierbaren“ zu leisten untersucht. Diese Aufforderung wird bei Adorno in einem Atemzug mit dem Begriff des Erhabenen ausgesprochen.
Diese Hausarbeit soll einerseits die Transformation des traditionellen Begriffs des Erhabenen durch Adorno, und besonders die Kritik an dem Konzept des Erhabenen bei Kant, aufzeigen sowie darstellen, was Adorno unter einer erhabenen Kunst versteht. Im zweiten Schritt wird dann Lyotards Weiterführung und Kritik an Adornos Ansatz untersucht. Zuletzt werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Ansätze aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Das Erhabene“ als Gegenbegriff zum „Schönen“
- Adorno: Die Ästhetische Theorie als Theorie des Erhabenen
- Lyotard: Das Erhabene als Ereignis
- Gemeinsamkeiten, Unterschiede und das Paradox der Vor-Zukunft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Transformation der Kategorie des Erhabenen bei Adorno und Lyotard. Sie analysiert, wie beide Denker den traditionellen Begriff des Erhabenen, insbesondere im Kontext von Kants Philosophie, neu interpretieren und in ihren jeweiligen ästhetischen Theorien einordnen. Die Arbeit vergleicht die Ansätze beider Denker und beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede, um zu verstehen, wie sie mit dem Problem des Undarstellbaren und Unkommunizierbaren in der Kunst umgehen.
- Adornos Ästhetische Theorie und ihre implizite Theorie des Erhabenen
- Lyotards Konzeption des Erhabenen als Ereignis
- Die Rolle des Erhabenen im Kontext von Kunst und Philosophie
- Die Frage der Kommunikation und Unkommunizierbarkeit
- Die Bedeutung von Auschwitz als Chiffre für das Undarstellbare
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale These der Arbeit vor, dass Adornos Ästhetische Theorie als eine Theorie des Erhabenen gelesen werden kann, trotz des scheinbar geringen Stellenwerts des Begriffs in seinem Werk. Sie führt ein in die Rezeption Adornos und Lyotards im Kontext des Erhabenen und skizziert die Problemstellungen, die im weiteren Verlauf der Arbeit behandelt werden.
- „Das Erhabene“ als Gegenbegriff zum „Schönen“: Dieses Kapitel beleuchtet die Konzeption des Erhabenen als Gegenbegriff zum Schönen, mit Fokus auf Kants Philosophie. Es stellt die traditionellen Interpretationen des Begriffs und seine Bedeutung im Zusammenhang mit Ästhetik und Philosophie dar.
- Adorno: Die Ästhetische Theorie als Theorie des Erhabenen: Dieses Kapitel analysiert Adornos Konzept des Erhabenen, seine Kritik an Kants Erhabenen-Theorie und seine Übertragung des Begriffs auf die Kunst. Es zeigt, wie Adorno das Erhabene als eine zentrale Kategorie seiner Ästhetik versteht und wie es mit seinen Thesen zu Kunst und Gesellschaft zusammenhängt.
- Lyotard: Das Erhabene als Ereignis: Dieses Kapitel widmet sich Lyotards Konzeption des Erhabenen. Es analysiert seine radikalere Interpretation des Erhabenen als Ereignis und seine Betonung des Moments des Erschütternden und Nicht-Fassbaren in der Kunst. Das Kapitel stellt Lyotards Ansatz in Bezug zu Adornos Thesen und diskutiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
- Gemeinsamkeiten, Unterschiede und das Paradox der Vor-Zukunft: Dieses Kapitel vertieft den Vergleich zwischen Adornos und Lyotards Ansätzen. Es analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrer Interpretation des Erhabenen, der Kommunikation und des Undarstellbaren, sowie in ihrer Bezugnahme auf Auschwitz. Das Kapitel beleuchtet auch die Frage des Paradoxen, das sich aus dem Verhältnis von Kunst, Kommunikation und Unkommunizierbarkeit ergibt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen des Erhabenen, der Ästhetik, Kunst, Philosophie, Adorno, Lyotard, Kommunikation, Unkommunizierbarkeit, Undarstellbarkeit, Auschwitz, sowie auf den „Topos der Undarstellbarkeit“.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Adornos Ästhetik als Theorie des Erhabenen gelesen?
Obwohl der Begriff selten vorkommt, schreibt Adorno, dass das Erhabene zum geschichtlichen Konstituens der modernen Kunst wurde und die traditionelle Idee der Schönheit abgelöst hat.
Wie unterscheidet sich Lyotards Konzept des Erhabenen von Adorno?
Lyotard interpretiert das Erhabene radikaler als "Ereignis" und betont das Moment des Erschütternden und Nicht-Fassbaren in der Kunst noch stärker.
Welche Rolle spielt "Auschwitz" in diesen Theorien?
Auschwitz dient als Chiffre für das Undarstellbare und Unkommunizierbare, das die moderne Kunst vor die paradoxe Aufgabe stellt, das Unaussprechliche auszudrücken.
Was ist das "Paradox der Vor-Zukunft"?
Es beschreibt das Spannungsfeld in der Kunst, die etwas darstellen will, das eigentlich außerhalb der herkömmlichen Kommunikation und Zeitstruktur liegt.
Wie kritisieren Adorno und Lyotard Kant?
Beide transformieren Kants subjektive Theorie des Erhabenen in eine objektive ästhetische Kategorie, die direkt mit den Krisen der Moderne verknüpft ist.
- Arbeit zitieren
- Wiebke Wolter (Autor:in), 2009, Die Transformation der Kategorie des Erhabenen bei Adorno und Lyotard , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161535