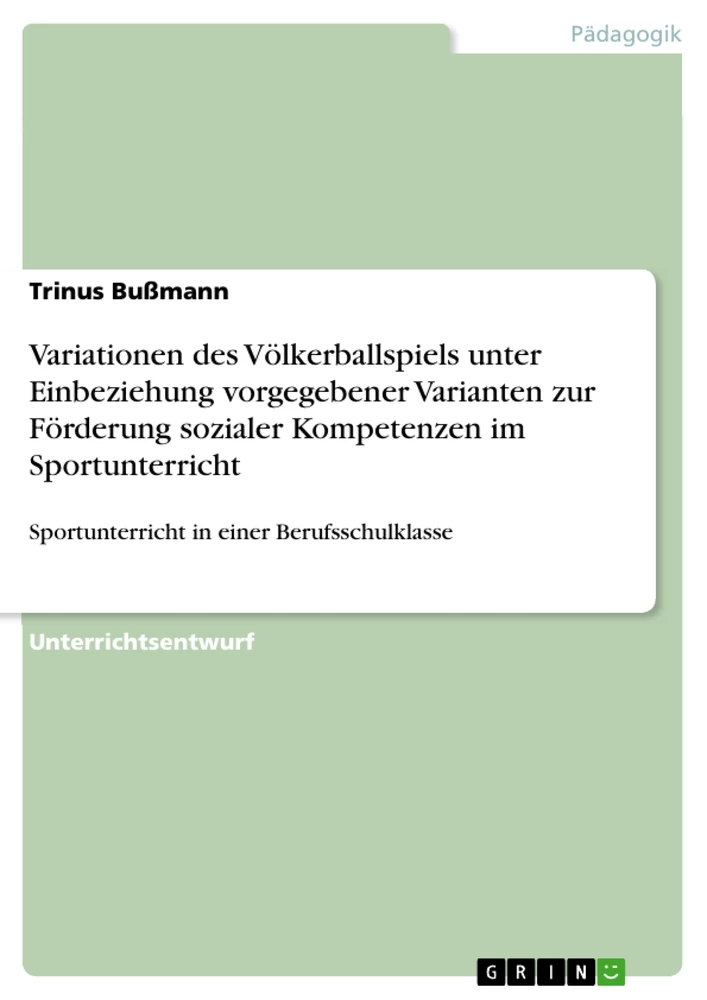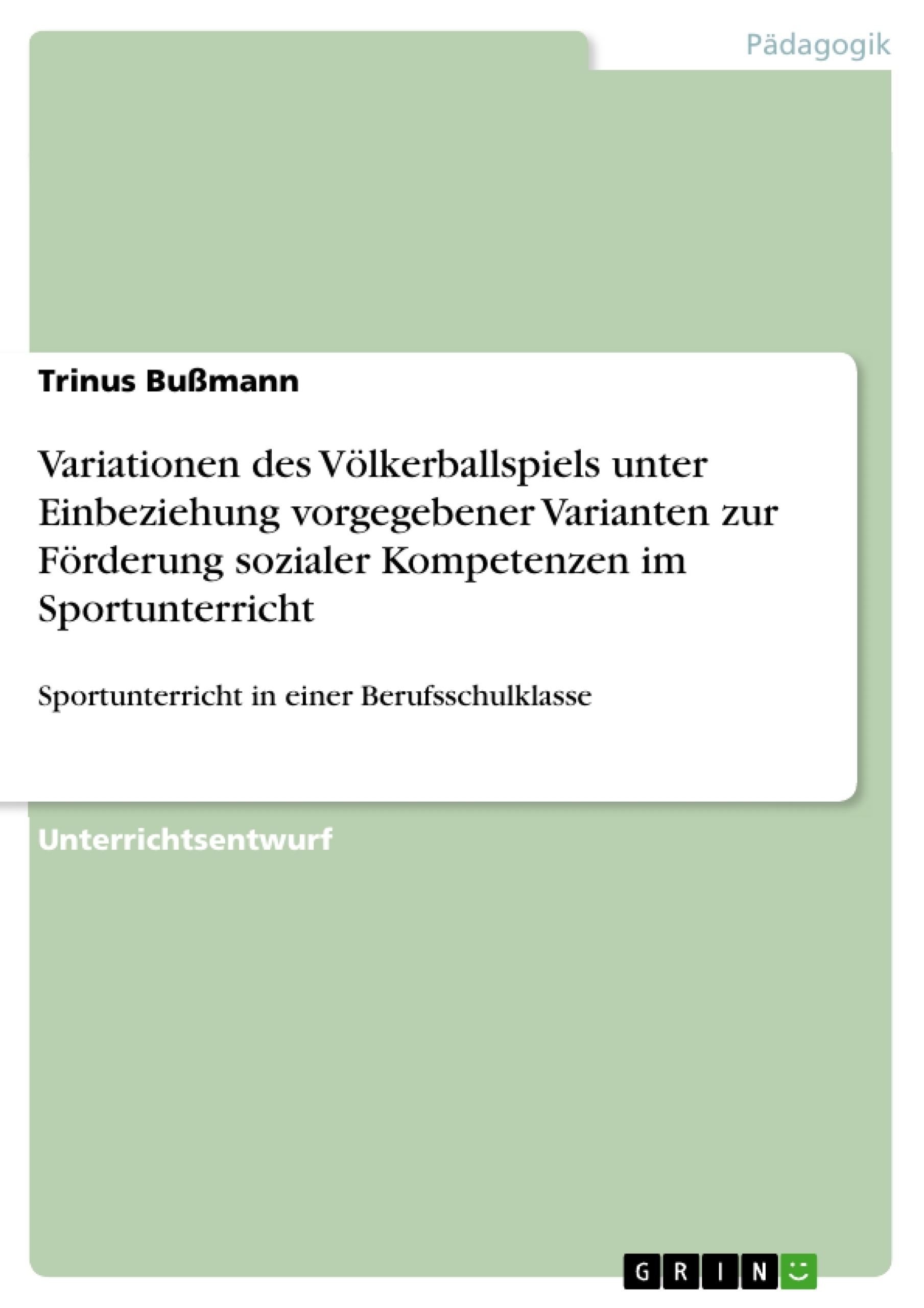Stundenlernziel Die Herbeiführung einer Verbesserung der Sozialkompetenz auf Schülerseite, durch die selbstständige Regelfindung und -umsetzung im Rahmen des Völkerballspiels. Feinlernziele Die Schüler sollen… LZ 1... verbessern ihre Fähigkeit kooperativ in einem Team zusammen zu arbeiten, indem sie gemeinschaftlich Spielregeln festlegen und anschließend als eine Mannschaft zusammen spielen (SK) LZ 2… verbessern ihre Abstimmungsfähigkeit in der Gruppe, indem sie die Vorschläge ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler akzeptieren und berücksichtigen und daraufhin gemeinsam zu ihrer Regelfestlegung gelangen (SK) LZ 3… finden umsetzbare Spielregeln für ihre jeweilige Spielformvariante und legen diese fest, indem sie sie auf dem vorstrukturierten Plakat notieren (FKp) LZ 4… stellen bei der Präsentation ihre Spielformvariante „Spion“ bzw. „Mattenvölkerball“ mit ihren dazugehörigen Regeln inhaltlich verständlich der jeweils anderen Gruppe dar (FKk) LZ 5… hören ihren Mitschülerinnen und Mitschülern bei der Präsentation aktiv zu, indem sie sich leise verhalten und bei Unklarheiten nachfragen (SK) FKp = Fachkompetenz (psychomotorisch), FKk = Fachkompetenz (kognitiv), SK = Sozialkompetenz
Inhaltsverzeichnis
- Analyse des Bedingungsfeldes
- Angaben zur Lerngruppe
- Die Kompetenzen der Lerngruppe
- Lern- und Handlungsziele
- Methodische Konzeption
- Makrostruktur
- Mikrostruktur
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Anhang I: Geplanter Verlauf der Unterrichtsstunde
- Anhang II: Makrostruktur
- Anhang III: Stundenverlauf
- Anhang IV: Arbeitsauftrag
- Anhang V: Hallenübersicht
- Anhang VI: Grunddaten der BEBM- 1
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, das Völkerballspiel durch eigene kreative Ideen und die Einbeziehung vorgegebener Varianten zu verändern und dabei soziale Kompetenzen im Sportunterricht zu fördern. Im Fokus stehen die Förderung der Gruppenarbeit, die gemeinsame Entwicklung von Spielregeln und deren Präsentation sowie die Anwendung dieser Regeln in den Spielphasen.
- Förderung sozialer Kompetenzen im Sportunterricht
- Variieren des Völkerballspiels durch kreative Ideen und vorgegebene Varianten
- Gemeinsames Entwickeln und Festlegen von Spielregeln
- Präsentieren der entwickelten Spielregeln
- Anwenden der Regeln in den Spielphasen
Zusammenfassung der Kapitel
Analyse des Bedingungsfeldes
Dieser Abschnitt beschreibt die Lerngruppe, deren Kompetenzen und die allgemeine Einstellung zur Sportstunde. Er analysiert das Klassenklima und geht auf die Motivation und das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler ein.
Methodische Konzeption
Dieser Abschnitt erläutert die methodische Konzeption der Unterrichtsstunde. Er beleuchtet die Makro- und Mikrostruktur des Unterrichtsverlaufs und erklärt die Wahl der Methoden und Materialien.
Schlüsselwörter
Völkerball, soziales Handeln, Sportunterricht, Gruppenarbeit, Regelentwicklung, Spielvariation, Präsentation, Reflexion.
Häufig gestellte Fragen
Wie fördert Völkerball die Sozialkompetenz im Sportunterricht?
Durch die gemeinsame Entwicklung und Aushandlung von Spielregeln lernen Schüler Kooperation, Abstimmungsfähigkeit und den gegenseitigen Respekt vor Vorschlägen anderer.
Was sind Spielvarianten wie "Spion" oder "Mattenvölkerball"?
Dies sind modifizierte Formen des klassischen Völkerballs, bei denen durch zusätzliche Regeln oder Hindernisse neue taktische Herausforderungen und Kooperationserfordernisse entstehen.
Welche Rolle spielt die Präsentation im Sportunterricht-Entwurf?
Die Schüler müssen ihre selbst entwickelten Regeln der anderen Gruppe verständlich erklären, was ihre kognitive Fachkompetenz und Kommunikationsfähigkeit schult.
Warum ist selbstständige Regelfindung wichtig?
Sie erhöht die Identifikation mit dem Spiel und fördert die Eigenverantwortung, da die Schüler nicht nur vorgegebene Regeln befolgen, sondern deren Sinnhaftigkeit selbst gestalten.
Was wird unter "Fachkompetenz (psychomotorisch)" in diesem Kontext verstanden?
Es bezieht sich auf die tatsächliche sportliche Umsetzung der Spielregeln und die Bewegungskoordination während der Spielphasen im Völkerball.
- Quote paper
- Trinus Bußmann (Author), 2010, Variationen des Völkerballspiels unter Einbeziehung vorgegebener Varianten zur Förderung sozialer Kompetenzen im Sportunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161566