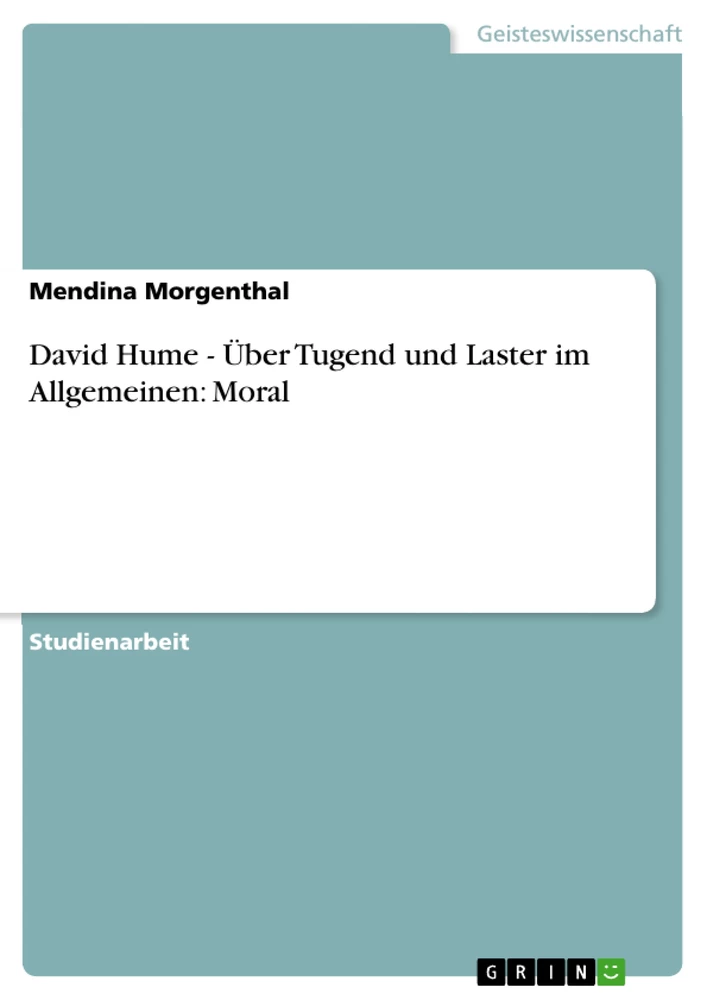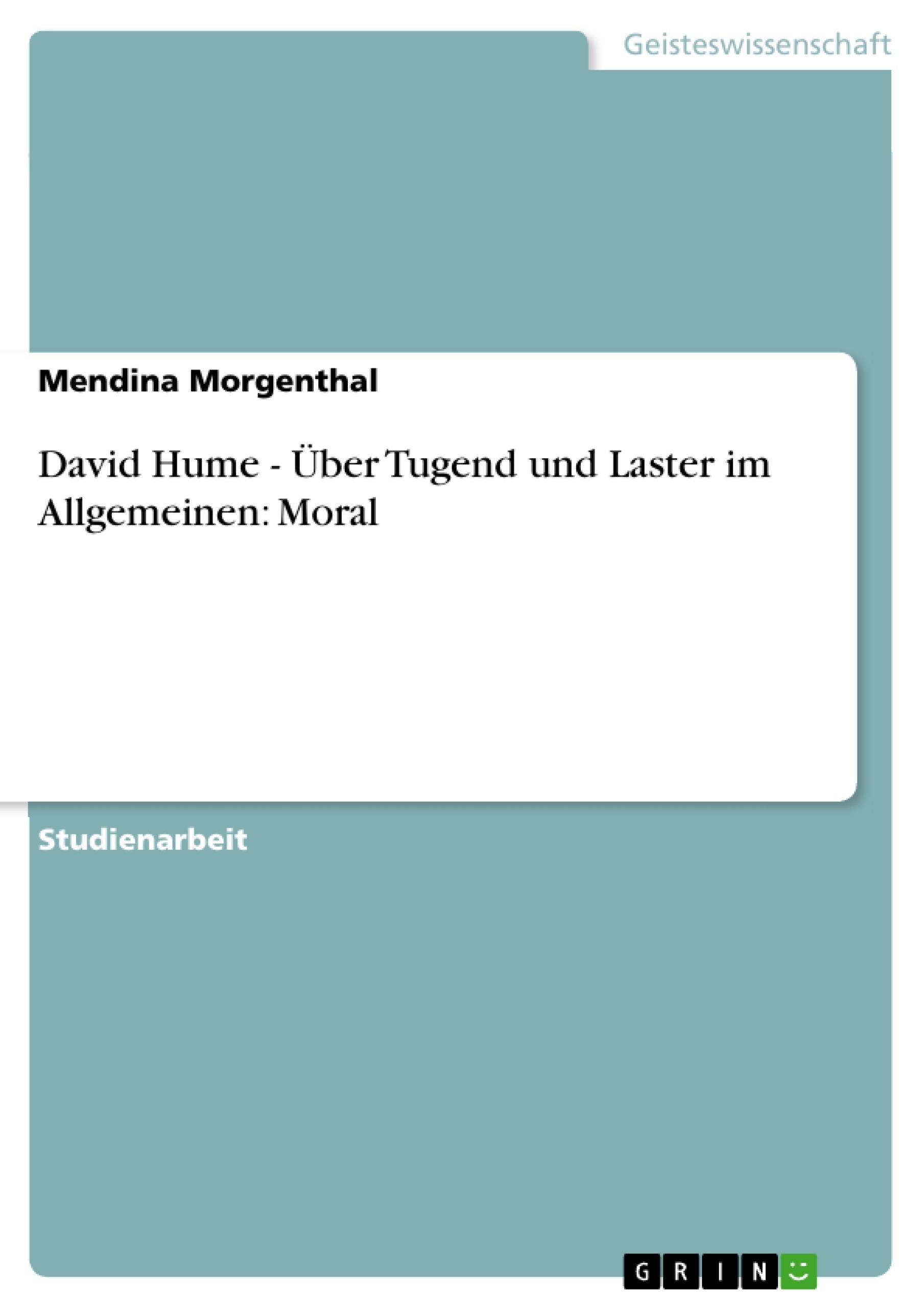In dem ersten Abschnitt des ersten Teils des Werkes „Über Moral“ will Hume darlegen, dass (und warum) moralische Unterscheidungen, also Unterscheidungen zwischen Gut und Böse, Recht und Unrecht, nicht aus der Vernunft abgeleitet werden; die Vernunft also niemals die Quelle solcher moralischer Unterscheidungen sein kann
Inhaltsverzeichnis
- Erster Teil- Über Tugend und Laster im Allgemeinen
- 1. Abschnitt- Moralische Unterscheidungen nicht aus der Vernunft abgeleitet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In diesem ersten Abschnitt seines Werkes „Über Moral“ möchte Hume belegen, dass moralische Unterscheidungen, also die Unterscheidung zwischen Gut und Böse, Recht und Unrecht, nicht aus der Vernunft abgeleitet werden können. Hume argumentiert, dass die Vernunft keine Quelle für moralische Urteile sein kann.
- Die Rolle der Perzeptionen und Eindrücke für moralische Urteile
- Die Begrenztheit der Vernunft und ihre Rolle in Bezug auf Wahrheit und Falschheit
- Die Unterscheidung zwischen Vernunft und Moral
- Die Unmöglichkeit, moralische Unterscheidungen durch Vernunft zu begründen
- Die Bedeutung von Gefühl und Beobachtung für moralische Urteile
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Abschnitt des ersten Teils von „Über Moral“ analysiert Hume die Frage, ob moralische Unterscheidungen aus der Vernunft abgeleitet werden können. Er argumentiert, dass Urteile, die unseren Affekten und Neigungen Einfluss nehmen, nicht allein durch Vernunft zustande kommen. Hume zeigt, dass die Vernunft auf das Erkennen von Wahrheit und Falschheit begrenzt ist und nicht in der Lage ist, Handlungen als tugendhaft oder lasterhaft einzuschätzen. Durch die Analyse der beiden Tätigkeiten des Verstandes, Vorstellungen und Eindrücke, sowie durch die Betrachtung von Beziehungen und Relationen, beweist er, dass moralische Urteile nicht durch die Vernunft erkannt werden können. Er stellt fest, dass moralische Urteile von einem Gefühl der Missbilligung oder Billigung abhängen, das durch Beobachtung einer Handlung entsteht.
Schlüsselwörter
Moral, Vernunft, Unterscheidungen, Gut und Böse, Recht und Unrecht, Perzeptionen, Eindrücke, Vorstellungen, Affekte, Neigungen, Wahrheit, Falschheit, Tugend, Laster, Beziehungen, Relationen, Gefühl, Missbilligung, Billigung, Beobachtung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist David Humes Hauptargument zur Moral?
Hume argumentiert, dass moralische Unterscheidungen (Gut/Böse) nicht aus der Vernunft stammen, sondern auf Gefühlen der Billigung oder Missbilligung basieren.
Warum kann die Vernunft laut Hume keine Moral begründen?
Vernunft befasst sich nur mit der Feststellung von Wahrheit oder Falschheit (Beziehungen von Ideen oder Tatsachen). Moralische Urteile hingegen motivieren zum Handeln, was Vernunft allein nicht kann.
Welche Rolle spielen „Affekte“ in Humes Theorie?
Affekte und Leidenschaften sind die treibenden Kräfte menschlichen Handelns; die Vernunft ist laut Hume lediglich deren „Sklave“.
Was ist der Unterschied zwischen Perzeptionen und Eindrücken?
Hume unterteilt geistige Inhalte in lebhafte Eindrücke (Sinneswahrnehmungen, Gefühle) und schwächere Vorstellungen (Gedanken, Erinnerungen).
Wie entstehen moralische Urteile bei Hume?
Sie entstehen durch die Beobachtung einer Handlung, die in uns ein angenehmes Gefühl (Tugend) oder ein unangenehmes Gefühl (Laster) auslöst.
- Arbeit zitieren
- Mendina Morgenthal (Autor:in), 2010, David Hume - Über Tugend und Laster im Allgemeinen: Moral, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161594