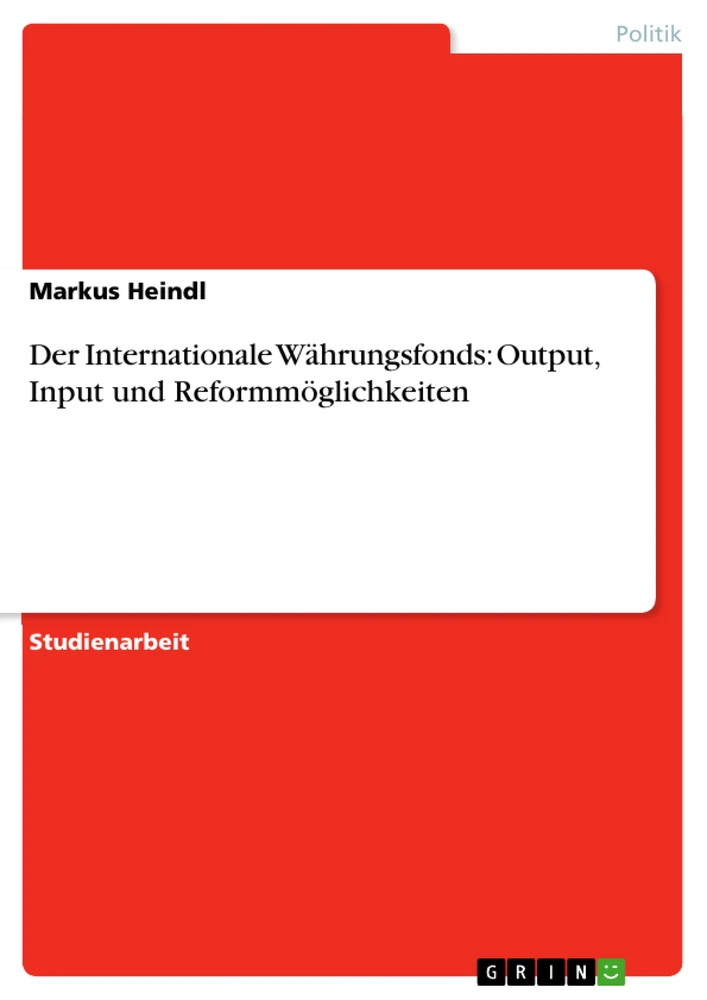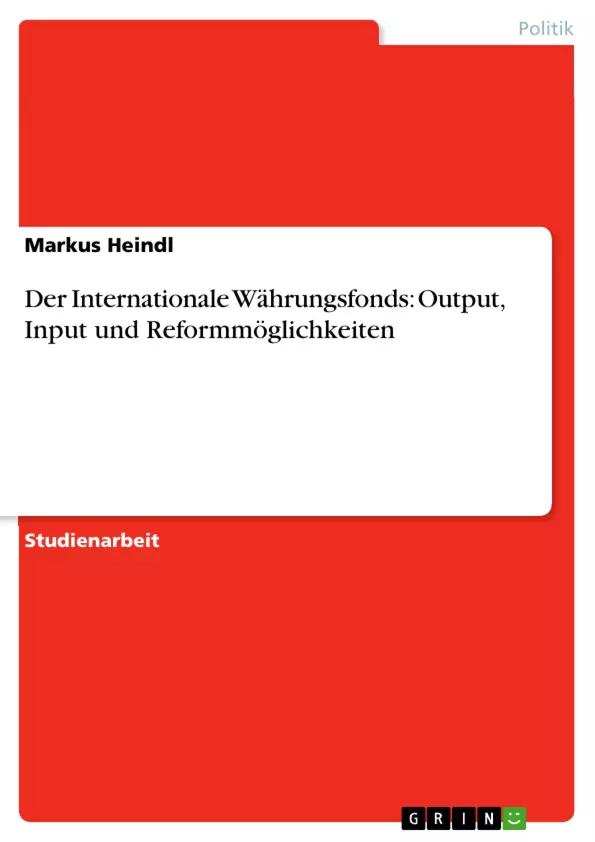In der Arbeit werden anhand der Scharpf'schen Unterscheidung von Input- und Outputlegitimation Probleme des IWF analysiert sowie mögliche Reformen diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Problem, Fragestellung und Vorgehen
- 2. Der Internationale Währungsfonds: Output, Input und Reformmöglichkeiten
- 2.1 Der theoretische Ansatzpunkt
- 2.2 Der Output des Internationalen Währungsfonds und seine problematischen Effekte
- 2.3 Warum produziert der Internationale Währungsfonds diesen und keinen anderen Output?
- 2.3.1 Die Bedeutung des formalen Auftrags und der institutionellen Struktur des Fonds
- 2.3.2 Die Bedeutung nationaler politischer und privatwirtschaftlicher Interessen der beteiligten Akteure
- 2.3.3 Die Bedeutung volkswirtschaftlicher Theorien und Erkenntnisse
- 2.4 Welche Reformen braucht der Internationale Währungsfonds?
- 3. Zusammenfassung und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den Internationalen Währungsfonds (IWF) im Hinblick auf seinen Output, Input und Reformmöglichkeiten. Im Zentrum steht die Frage, warum der IWF trotz Kritik an seiner Kreditvergabepolitik und seinen Effekten diesen Output produziert und welche Reformmöglichkeiten es gibt.
- Analyse des Outputs des IWF und seiner problematischen Effekte
- Untersuchung der Faktoren, die den Output des IWF beeinflussen
- Formaler Auftrag und institutionelle Struktur
- Nationale politische und privatwirtschaftliche Interessen
- Volkswirtschaftliche Theorien und Erkenntnisse
- Diskussion von Reformmöglichkeiten des IWF
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt das Problemfeld der Reform des IWF dar, erläutert die Fragestellung und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Der Internationale Währungsfonds: Output, Input und Reformmöglichkeiten: Dieses Kapitel untersucht den IWF im Hinblick auf seinen Output und Input sowie die bestehenden Reformmöglichkeiten. Es werden verschiedene Perspektiven auf den IWF beleuchtet, darunter die Kritik von NGOs und Experten, sowie die Bedeutung des IWF in der internationalen Finanzarchitektur.
- Kapitel 2.1 Der theoretische Ansatzpunkt: Dieser Abschnitt erklärt das Konzept der Input- und Outputlegitimation von politischen Entscheidungen nach Fritz Scharpf und wendet es auf den IWF an.
- Kapitel 2.2 Der Output des Internationalen Währungsfonds und seine problematischen Effekte: Dieser Abschnitt analysiert den Output des IWF, insbesondere die Kreditvergabepolitik, und diskutiert deren problematische Effekte für die Empfängerländer.
- Kapitel 2.3 Warum produziert der Internationale Währungsfonds diesen und keinen anderen Output?: Dieser Abschnitt untersucht die Ursachen für den aktuellen Output des IWF und analysiert drei Faktoren: den formalen Auftrag und die institutionelle Struktur des Fonds, nationale politische und privatwirtschaftliche Interessen der beteiligten Akteure sowie angewandte volkswirtschaftliche Theorien und Erkenntnisse.
- Kapitel 2.4 Welche Reformen braucht der Internationale Währungsfonds?: Dieser Abschnitt diskutiert verschiedene Reformmöglichkeiten des IWF und stellt die These auf, dass die aktuellen Kreditprogramme des IWF ohne aufwändige institutionelle Reformen reformiert werden können. Der Fokus sollte stattdessen auf den inhaltlichen Schwächen der IWF-Politik liegen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf den Internationalen Währungsfonds (IWF), seine Kreditvergabepolitik, die Input- und Outputlegitimation von politischen Entscheidungen, nationale und internationale Interessen, volkswirtschaftliche Theorien und Reformmöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Input- und Outputlegitimation beim IWF?
Inputlegitimation bezieht sich darauf, wie Entscheidungen zustande kommen (Beteiligung), während Outputlegitimation die Wirksamkeit und Ergebnisse der IWF-Politik bewertet.
Warum wird die Kreditvergabepolitik des IWF kritisiert?
Kritiker bemängeln die oft harten Auflagen, die negative soziale und ökonomische Effekte in den Empfängerländern haben können.
Welche Faktoren beeinflussen den Output des IWF?
Einflussfaktoren sind der formale Auftrag, nationale politische und privatwirtschaftliche Interessen der Mitgliedsstaaten sowie herrschende volkswirtschaftliche Theorien.
Sind institutionelle Reformen beim IWF zwingend notwendig?
Die Arbeit stellt die These auf, dass inhaltliche Reformen der Kreditprogramme auch ohne aufwändige institutionelle Umstrukturierungen möglich wären.
Welche Rolle spielen NGOs in der IWF-Debatte?
NGOs treten oft als Kritiker auf, die auf die sozialen Folgen der IWF-Programme hinweisen und mehr Transparenz sowie Reformen fordern.
- Arbeit zitieren
- Markus Heindl (Autor:in), 2003, Der Internationale Währungsfonds: Output, Input und Reformmöglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161603