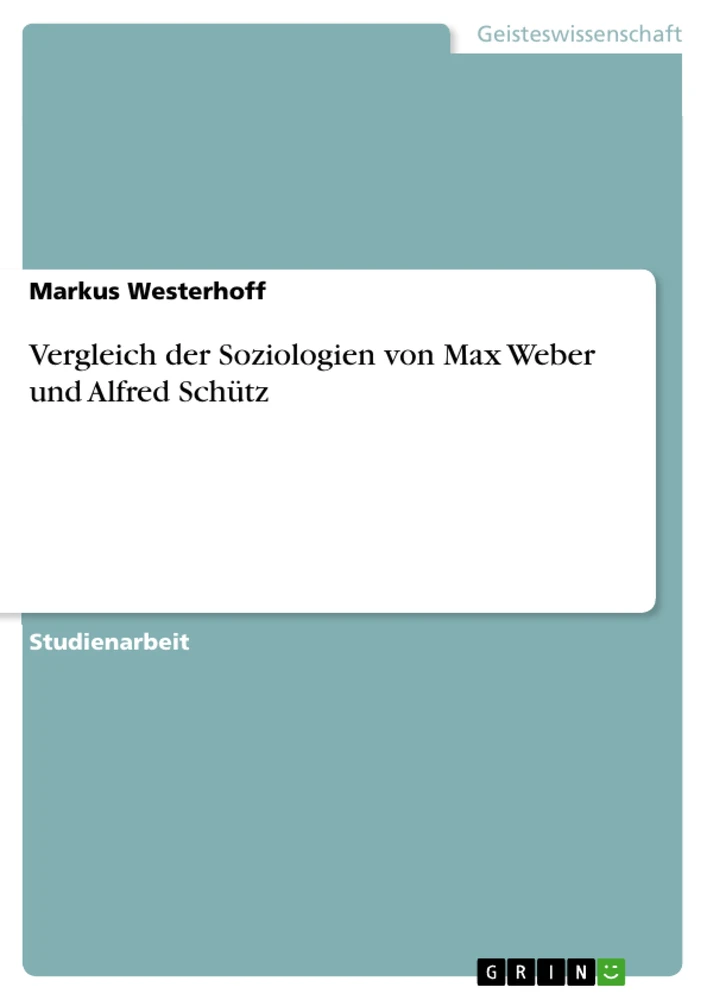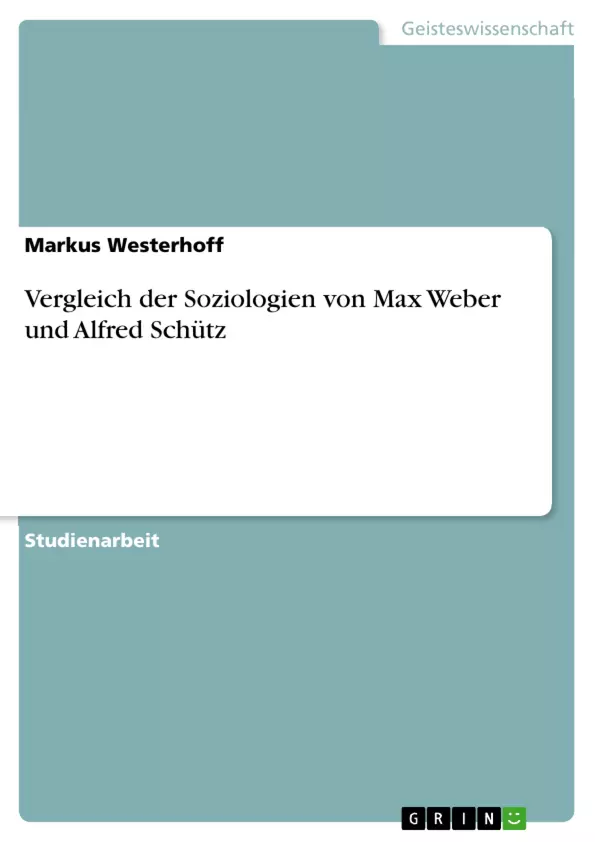Karl Emil Maximilian Weber gilt als einer der Klassiker der Soziologie und zählt unumstritten zu den Begründern der modernen Soziologie (vgl. Münch, R. 2002, S. 135). Mit seiner Soziologie kristallisierte sich Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue Position des Menschengeschlechts heraus, die der Vorstellung entgegengesetzt war, dass die Geschichte einen eigenen, unabhängigen Sinn besitze. Erst nach Weber waren die einzelnen Individuen unumstritten die Schmiede ihres Schicksals (vgl. Kalberg 2006, S. 17). Alfred Schütz knüpft mit seinen Untersuchungen direkt bei Weber an, jedoch kritisiert er auch dessen Werk und nimmt dabei mit seinen Untersuchungen die Perspektive einer bestimmten Problemstellung ein (vgl. Schneider 2008, S. 234). Die vorliegende Arbeit soll daher die soziologischen Theorien von Max Weber und Alfred Schütz behandeln. Es sollen beide Theorien gegenüberstellt und verglichen werden. Ziel soll dabei sein, sowohl die wesentlichen Gemeinsamkeiten, als auch die Unterschiede herauszuarbeiten. Zunächst sollen dafür die Handlungstheorien von Weber und Schütz einzeln betrachtet werden. Daraufhin werden beide Werke hinsichtlich ihrer Behandlung des subjektiven Sinns behandelt und ausgearbeitet. Danach soll die Emergenzkonstellation beider Werke aufgezeigt werden. Eine Reflexion der erarbeiteten Ergebnisse soll diese Arbeit letztendlich abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorien
- Die Handlungstheorie nach Max Weber
- Die Handlungstheorie nach Alfred Schütz
- Theorienvergleich
- Der subjektive Sinn bei Weber und Schütz
- Emergenz bei Weber und Schütz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit hat zum Ziel, die soziologischen Theorien von Max Weber und Alfred Schütz gegenüberzustellen und zu vergleichen. Dabei sollen die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Theorien herausgearbeitet werden.
- Handlungstheorien von Weber und Schütz
- Behandlung des subjektiven Sinns in beiden Werken
- Emergenzkonstellation beider Werke
- Vergleich der methodischen Ansätze
- Zusammenführung der Ergebnisse und Reflexion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die beiden Soziologen Max Weber und Alfred Schütz als bedeutende Vertreter der modernen Soziologie vor. Sie erläutert die Thematik der Arbeit, die sich auf den Vergleich der Handlungstheorien von Weber und Schütz konzentriert.
Theorien
Die Handlungstheorie nach Max Weber
Dieser Abschnitt beschreibt Webers Ansatz der verstehenden Soziologie und seine Bemühungen, die Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft zu etablieren. Er beleuchtet Webers methodisches Instrumentarium und seine Definition von sozialem Handeln, das durch subjektiven Sinn geprägt ist. Die vier Idealtypen des sozialen Handelns (traditionales, affektuelles, wertrationales und zweckrationales Handeln) werden vorgestellt und erläutert.
Die Handlungstheorie nach Alfred Schütz
Hier wird Schütz' Ansatz, der auf Weber aufbaut, aber auch dessen Werk kritisiert, vorgestellt. Schütz' Fokus liegt auf der Analyse der Konstitution der sozialen Welt, wobei er die Phänomenologie von Edmund Husserl integriert. Der Abschnitt beschreibt Schütz' Unterscheidung zwischen dem Sinn, den Ego selbst setzt, und dem Sinn, den dieses Handeln für Alter hat. Die Differenzierung zwischen Um-zu-Motiven und Weil-Motiven wird ebenfalls beleuchtet.
Theorienvergleich
Der subjektive Sinn bei Weber und Schütz
Dieser Abschnitt vergleicht die Ansätze von Weber und Schütz hinsichtlich des subjektiven Sinns. Schütz kritisiert Webers undifferenzierte Verwendung des Sinnbegriffs und betont die Bedeutung der Intersubjektivität für die Konstitution der sozialen Welt. Er stellt fest, dass Weber das Problem der Intersubjektivität nur unzureichend behandelt, während Schütz versucht, die Wurzeln sozialwissenschaftlicher Problematik bis zu den fundamentalen Gegebenheiten des Bewusstseinslebens zurückzuverfolgen. Schütz' Fokus liegt auf der Analyse der Konstitution des Sinns, während Weber sich eher mit der Methodologie des Sinnverstehens beschäftigt.
Emergenz bei Weber und Schütz
Dieser Abschnitt untersucht die Konzepte der Emergenz in den Handlungstheorien von Weber und Schütz. Der Abschnitt erläutert den Begriff der Emergenz und unterscheidet zwischen schwacher und starker Emergenz. Weber wird als Vertreter der schwachen Emergenz betrachtet, da er soziale Ordnung stets auf die Beziehung zwischen den einzelnen Akteuren zurückführt. Schütz hingegen wird als Vertreter einer Mischform aus schwacher und starker Emergenz dargestellt, da er zwar die Bedeutung von Typisierungen und gesellschaftlichen Mustern betont, aber auch die Rolle des Individuums in der Reproduktion dieser Muster hervorhebt.
Schlüsselwörter
Die Haup Begriffe und Themenschwerpunkte dieser Arbeit sind die Handlungstheorie, subjektiver Sinn, Intersubjektivität, Emergenz, Typisierung, Idealtypen, Max Weber und Alfred Schütz. Die Arbeit fokussiert auf den Vergleich der Handlungstheorien von Weber und Schütz und analysiert insbesondere die Bedeutung des subjektiven Sinns und des Konzepts der Emergenz in beiden Theorien. Dabei werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Ansätze herausgearbeitet.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich die Handlungstheorien von Weber und Schütz?
Während Weber soziales Handeln durch subjektiven Sinn definiert, kritisiert Schütz dessen undifferenzierten Sinnbegriff und ergänzt ihn um phänomenologische Aspekte der Intersubjektivität.
Was sind Webers vier Idealtypen des Handelns?
Weber unterscheidet zwischen traditionalem, affektuellem, wertrationalem und zweckrationalem Handeln.
Was versteht Alfred Schütz unter Um-zu- und Weil-Motiven?
Um-zu-Motive beziehen sich auf das angestrebte Ziel einer Handlung in der Zukunft, während Weil-Motive die Ursachen in der Vergangenheit beschreiben.
Wie wird "Emergenz" in den Theorien behandelt?
Weber wird der schwachen Emergenz zugeordnet (Fokus auf Akteure), während Schütz eine Mischform vertritt, die auch gesellschaftliche Typisierungen einbezieht.
Was ist die Hauptkritik von Schütz an Max Weber?
Schütz bemängelt, dass Weber das Problem der Intersubjektivität – wie Sinn zwischen verschiedenen Individuen geteilt wird – nicht ausreichend tiefgehend analysiert hat.
- Arbeit zitieren
- Markus Westerhoff (Autor:in), 2009, Vergleich der Soziologien von Max Weber und Alfred Schütz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161681