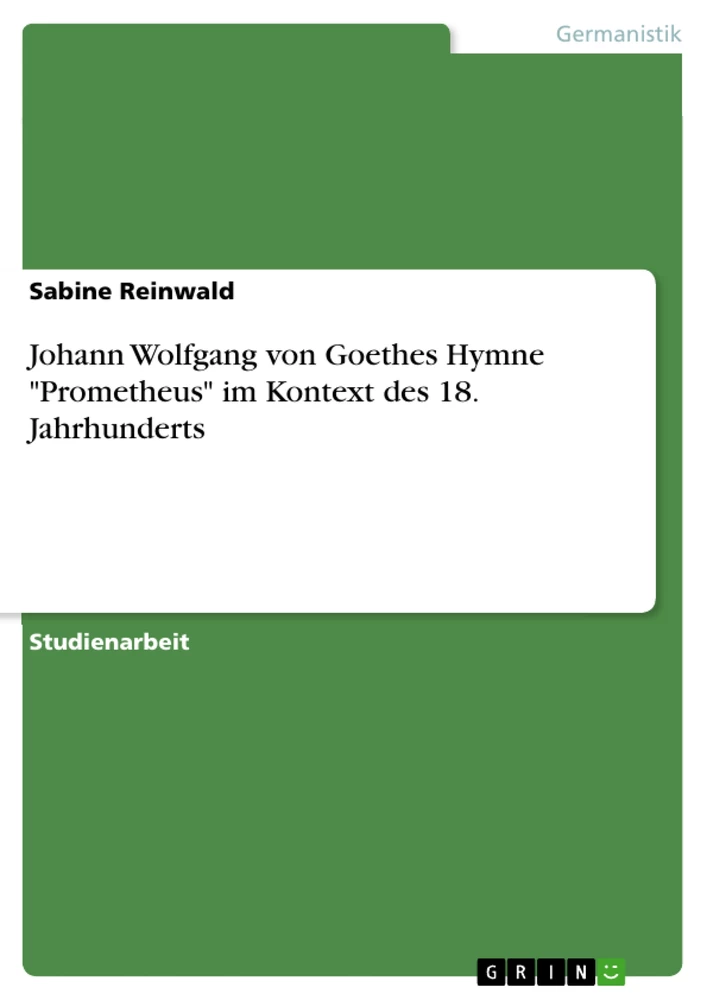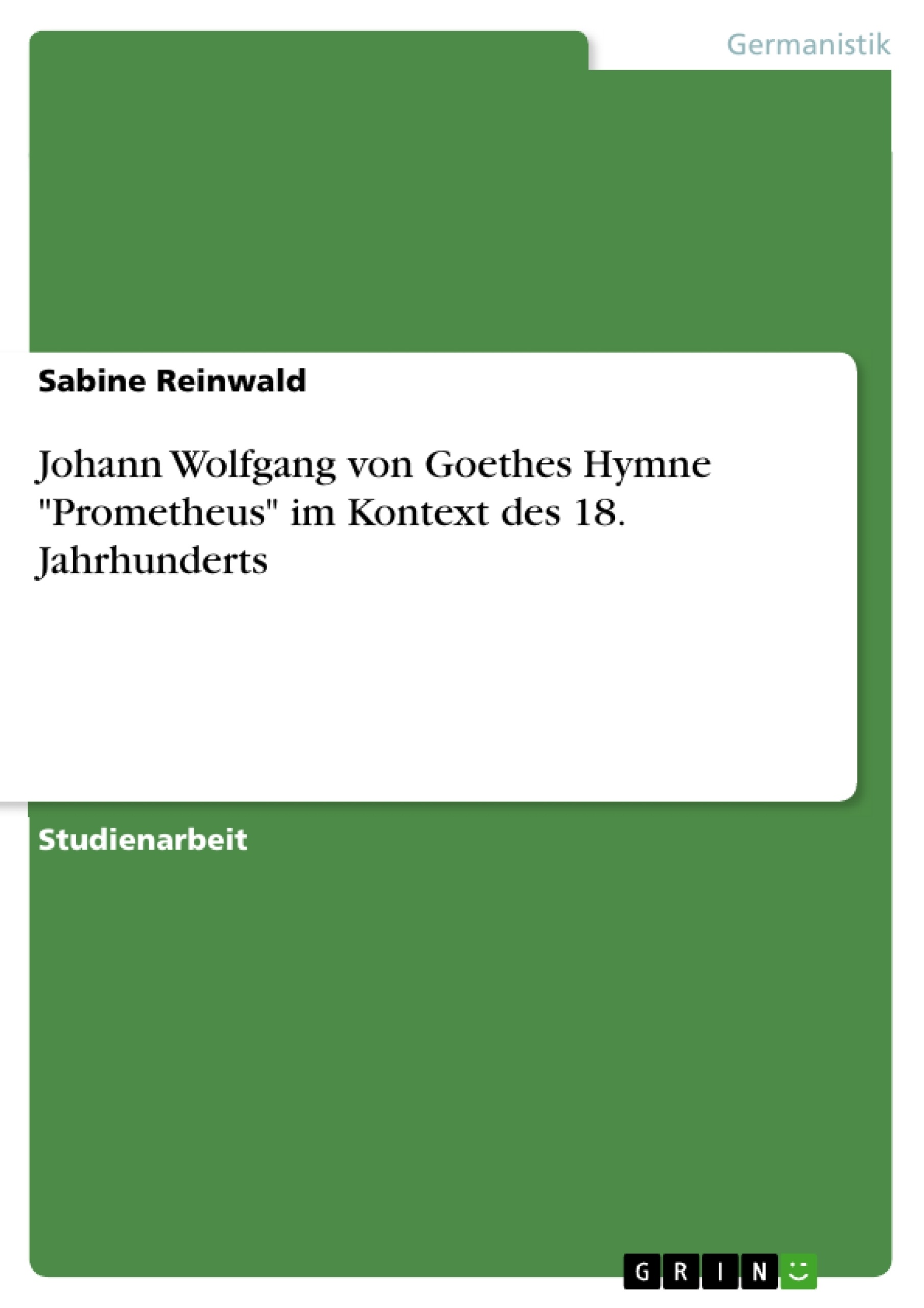Die vorliegende Hausarbeit behandelt die Einbettung des Mythos des Halbgottes Prometheus in Johann Wolfgang von Goethes gleichnamigen Gedicht „Prometheus“ und fokussiert vor allem deren Einordnung in die Zeit des Sturm und Drangs und des Genie-Zeitalters. Es soll im Folgenden untersucht werden, inwiefern das Gedicht in die Zeit um 1800 eingeordnet werden kann und welche Wirkung der Dichter evozieren möchte.
Das Verwenden mythischer Figuren in Werken der Zeit im deutschsprachigen 18.Jahrhundert – „Mythopoetische Texte“ genannt- erfährt eine neue Dimension, insofern „mythologische Motive und Stoffe omnipräsent in der europäischen Kunst und Literatur“ war. So bedienten sich neben Johann Wolfgang von Goethe vor allem Gotthold Ephraim Lessing, Johann Gottfried Herder, Friedrich Schiller sowie diverse Schriftsteller der Romantik des aussagekräftigen Stoffes, um die Intention ihrer Stücke zu bekräftigen.
Die „unbeweisbare, fiktional-erzählende Rede“ , wie der Mythos in einschlägigen Lexika definiert wird, gab und gibt vielen Autoren Anlass zur deren Übernahme in eigene Werke. Neben zahlreichen Autoren des 18. Jahrhundert – und auch heute noch - bedient sich auch Johann Wolfgang von Goethe 1774 der nicht beweisbaren, aber sinnstiftenden Erzählung , um soziale Missstände in der Gesellschaft des späten 18. Jahrhunderts aufzudecken und anzuklagen. Das Leben im Deutschen Reich gestaltete sich nach dem Westfälischen Frieden vom 24.Oktober 1648 als schwierig, insofern sich das Machtverhältnis zuungunsten der Bürger veränderte und zu Unzufriedenheit vor allem im Bürgertum führte.
Eines der bekanntesten Gedichte, welches die Schwierigkeiten im Kontext des veränderten Deutschen Reichs zum Gegenstand macht, ist sicherlich Goethes „Prometheus“, welches er zwischen 1773 und 1774 verfasste. Über die Entstehungszeit herrscht Uneinigkeit in der Literatur, nicht zuletzt daher, weil Goethe das Gedicht erst seinen Freunden zukommen ließ bevor er es erst später veröffentlichte .
Goethe greift auf den „Prometheus“-Mythos zurück, indem er seinen Kern in einer Hymne verarbeitet. Interessant für die Hausarbeit ist es, die Zusammenhänge zwischen der Epoche des Sturm und Drang und der Prometheus-Erzählung zu ziehen. Hinblickend auf die Intention des Autors soll im Folgenden der Blick auf die Termini Mythos, Sturm und Drang und Hymne gerichtet werden, um anschließend den Prometheus-Mythos mit Goethes Version in Verbindung zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mythos
- Einbettung des Mythos in Literatur und Kunst
- Epoche des Sturm und Drang
- Der Dichter im Sturm und Drang
- Goethes „Prometheus“ als Renaissance der Mythologie im 18. Jahrhundert
- Literaturgeschichtliche Einbettung der Prometheus-Hymne Goethes
- Der Prometheus-Mythos
- Interpretation der Hymne „Prometheus“
- Hymne
- Interpretation und Aufbau der Antihymne „Prometheus“
- Fazit
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Einordnung des Prometheus-Mythos in Johann Wolfgang von Goethes Gedicht „Prometheus“ und untersucht insbesondere dessen Kontextualisierung in der Zeit des Sturm und Drangs und des Genie-Zeitalters. Die Arbeit analysiert, inwiefern das Gedicht in die Zeit um 1800 eingeordnet werden kann und welche Wirkung der Dichter evozieren möchte.
- Die Verwendung mythischer Figuren in Werken des 18. Jahrhunderts, insbesondere im deutschsprachigen Raum
- Die Rolle der Mythologie im Sturm und Drang
- Die Interpretation der Prometheus-Hymne von Goethe
- Die Relevanz des Mythos für die Gesellschaft des späten 18. Jahrhunderts
- Die Intention des Autors in Bezug auf die zeitgenössischen sozialen Missstände
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Prometheus-Mythos in Goethes Gedicht „Prometheus“ ein und legt den Fokus auf die Einordnung in das Sturm und Drang sowie das Genie-Zeitalter. Die Arbeit analysiert die Verwendung mythischer Figuren in der Literatur des 18. Jahrhunderts und beleuchtet insbesondere die Rolle des Mythos als Mittel zur Kritik an der Gesellschaft.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff des Mythos und seiner Bedeutung in der Literatur und Kunst. Es werden verschiedene Ansätze zur Definition des Mythos vorgestellt und die Rolle des Mythos als Ausdruck eines vorrationalen Weltverständnisses sowie als Mittel zur Erklärung unbegreiflicher Geschehnisse hervorgehoben.
Das dritte Kapitel widmet sich der Epoche des Sturm und Drangs und seiner charakteristischen Merkmale. Die Arbeit analysiert die Rolle des Dichters im Sturm und Drang und seine Intention, die bestehenden gesellschaftlichen Normen und Konventionen in Frage zu stellen.
Kapitel 5 beleuchtet Goethes „Prometheus“ als ein Werk der Renaissance der Mythologie im 18. Jahrhundert. Es werden die spezifischen Merkmale des Gedichts im Kontext der Epoche untersucht, insbesondere die Verwendung des Prometheus-Mythos als Mittel zur Kritik an der bestehenden Machtstruktur.
Kapitel 6 befasst sich mit der literaturgeschichtlichen Einbettung der Prometheus-Hymne Goethes. Es werden die wichtigsten Einflüsse und Vorbilder auf Goethes Werk analysiert, sowie die Relevanz des Gedichts im Kontext der Zeit.
Kapitel 7 untersucht den Prometheus-Mythos selbst und seine verschiedenen Interpretationen in der Literatur. Die Arbeit beleuchtet die wichtigsten Merkmale des Mythos und seine Relevanz für die Gesellschaft.
Kapitel 8 widmet sich der Interpretation der Hymne „Prometheus“ und analysiert den Aufbau und die Bedeutung des Gedichts. Es werden die wichtigsten Aspekte der Interpretation beleuchtet, insbesondere die Kritik an der bestehenden Machtstruktur und die Forderung nach Freiheit und Selbstbestimmung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf zentrale Themen wie den Prometheus-Mythos, das Sturm und Drang, das Genie-Zeitalter, die deutsche Literatur des 18. Jahrhunderts, Kritik an der Machtstruktur, Freiheit, Selbstbestimmung, Mythologie, Literaturinterpretation, Mythopoetische Texte, und die Bedeutung von Mythen in der Zeit des Umbruchs.
Häufig gestellte Fragen
In welche literarische Epoche gehört Goethes „Prometheus“?
Das Gedicht ist eines der bedeutendsten Werke des Sturm und Drang (ca. 1770–1785), auch bekannt als Genie-Zeit.
Was symbolisiert die Figur des Prometheus bei Goethe?
Prometheus verkörpert den rebellischen Schöpfergeist, die Selbstbestimmung des Menschen und den Widerstand gegen willkürliche göttliche (oder herrschaftliche) Macht.
Warum wird das Gedicht oft als „Antihymne“ bezeichnet?
Während eine klassische Hymne eine Gottheit preist, richtet sich Prometheus bei Goethe voller Verachtung und Anklage gegen Zeus und die Götter.
Welchen gesellschaftlichen Kontext hatte das Gedicht im 18. Jahrhundert?
Es spiegelt die Unzufriedenheit des Bürgertums mit den absolutistischen Machtverhältnissen im Deutschen Reich nach dem Westfälischen Frieden wider.
Welche Rolle spielt der Begriff „Genie“ in diesem Werk?
Das „Genie“ im Sturm und Drang ist ein autonomer Schöpfer, der sich nicht an überkommene Regeln hält, sondern aus sich selbst heraus Neues schafft – genau wie Prometheus die Menschen formt.
Wie hängen Mythos und soziale Kritik hier zusammen?
Goethe nutzt den antiken Stoff als „mythopoetischen Text“, um zeitgenössische soziale Missstände aufzudecken und die Forderung nach individueller Freiheit zu bekräftigen.
- Citar trabajo
- Sabine Reinwald (Autor), 2010, Johann Wolfgang von Goethes Hymne "Prometheus" im Kontext des 18. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161684