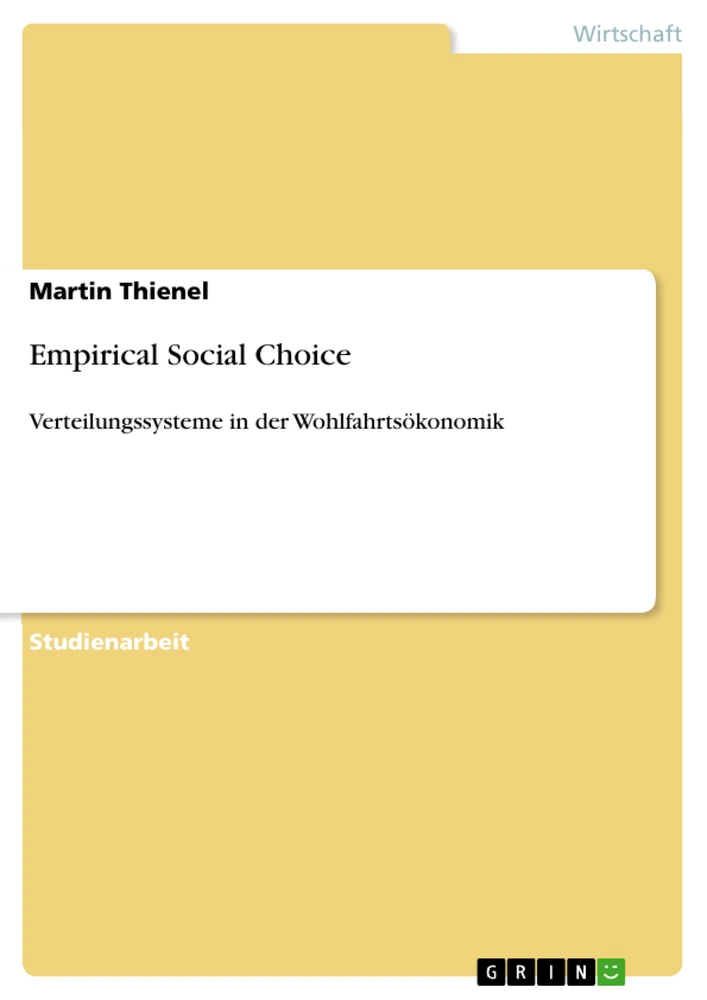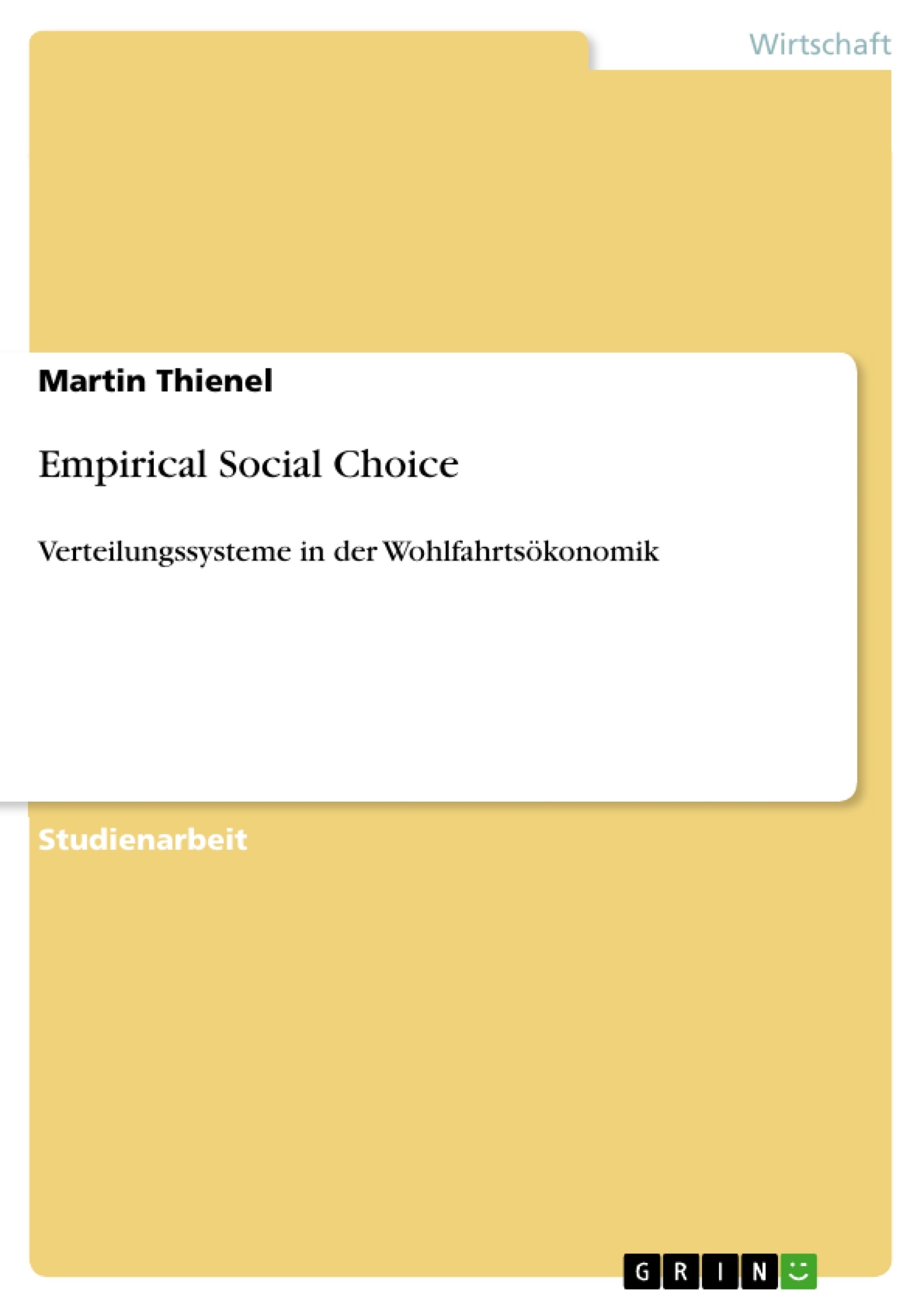Die Theorie der Sozialwahl als interdisziplinäres Wissenschaftsfeld zwischen Ökonomie, den Sozialwissenschaften und der Psychologie thematisiert die kollektive Präferenzbildung. Im Bereich der Ökonomie werden dabei zumeist Verteilungsfragen diskutiert, theoretisch aufgearbeitet und praktischer Betrachtung in der Realität unterzogen. Letzteres bildet das Kerngebiet der Empirischen Sozialwahl, welche im Rahmen des Seminars thematischer Schwerpunkt von Laura Mahl und meiner Person war. Aufbauend auf die in Gaertner (2006) vorgestellten Studien durch Yaari und Bar-Hillel (1984) und Gaertner und Jungeilges (2002) wird vor diesem Hintergrund betrachtet, welche Faktoren die individuelle wie kollektive Präferenzbildung beeinflussen. Dabei steht eine Kategorisierung von sozialen nach Rawls (1971) Maximin-Prinzip zur Besserstellung der Schwächsten konstruierten und utilitaristischen Präferenztendenzen im Mittelpunkt. Ein Ziel besteht darin, Situationen und die diese begründenden Eigenschaften in ihrer Bedeutung für die Präferenzbildung zu analysieren und Schlüsse für die Ausgestaltung zum Beispiel von Entscheidungssituationen im politischen Prozess zu ziehen. Weiterhin werden anhand der Studienergebnisse Interpretationen angestellt, welche realen Faktoren für beobachtete Präferenzmuster konstitutiv sein können. Dahingehend wurden Betrach-tungen über die Zeit und hinsichtlich politökonomischer Charakteristika mittels wiederholter Durchführung der Studien auch an verschiedenen Standorten vorgenommen. Im ersten Abschnitt der Arbeit werden ganz allgemein zur Theorie der Sozialwahl der Entwicklungsprozess, die zentralen Fragestellungen und Probleme sowie notwendige formale Anforderungen betrachtet. Anschließend wird eine Einführung in die Empirische Sozialwahl gegeben und im Vorgriff auf die Studienbetrachtung wichtige Begriffe erläutert. Der Kern der Arbeit gibt einen Einblick in die Arbeit von Gaertner und Jungeilges (2002) und bietet weiterführende Interpretationsansätze an. Diese werden in Zusammenhang mit Thesen des Wissenschaftsfeldes aus der Literatur gestellt und diskutiert. Abschließend wird ein Überblick über die zentralen Ergebnisse gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Social Choice Theory
- Historische Einordung und Überblick
- Ein intuitiver Aggregationsansatz
- Soziale Wohlfahrtsfunktion
- Empirical Social Choice
- Verteilungskonzepte
- Rawlssches Äquitätsprinzip
- Utilitarismus
- Empirische Studie zur Sozialwahl
- Problemstellung
- Theoretische Fundierung
- Ergebnisdarstellung
- Problem 1 ohne Ordnungskenntnis - zeitlich
- Problem 1 mit Ordnungskenntnis - zeitlich
- Problem 2 ohne Ordnungskenntnis - zeitlich
- Problem 2 mit Ordnungskenntnis - zeitlich
- Problem 1 ohne Ordnungskenntnis - geographisch
- Diskussion im Thesenkontext in der Literatur
- Zusammenfassung
- Analyse von Verteilungsfragen und Präferenzbildung
- Einflussfaktoren auf die Präferenzbildung
- Anwendung des Rawlsschen Maximin-Prinzips und des Utilitarismus
- Untersuchung von Entscheidungssituationen im politischen Prozess
- Interpretation von realen Faktoren, die beobachtete Präferenzmuster prägen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der empirischen Sozialwahltheorie und untersucht, wie individuelle und kollektive Präferenzen in realen Entscheidungssituationen entstehen. Dabei steht die Analyse von Verteilungsfragen im Vordergrund, die im Kontext der Ökonomie, der Sozialwissenschaften und der Psychologie relevant sind. Die Studie baut auf den Arbeiten von Yaari und Bar-Hillel (1984) sowie Gaertner und Jungeilges (2002) auf, die verschiedene Faktoren beleuchten, die die Präferenzbildung beeinflussen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit führt in das Themenfeld der Sozialwahltheorie ein, beleuchtet die Relevanz für verschiedene Disziplinen und stellt den Fokus auf die empirische Sozialwahl dar. Sie skizziert die Zielsetzung der Studie und die zu analysierenden Aspekte.
Social Choice Theory: Dieses Kapitel bietet eine historische Einordnung und einen Überblick über die Sozialwahltheorie. Es werden die zentralen Fragestellungen und Probleme sowie notwendige formale Anforderungen betrachtet. Weiterhin wird ein intuitiver Aggregationsansatz vorgestellt und die Soziale Wohlfahrtsfunktion erläutert.
Empirical Social Choice: Dieses Kapitel befasst sich mit Verteilungskonzepten, insbesondere dem Rawlsschen Äquitätsprinzip und dem Utilitarismus. Es werden empirische Studien zur Sozialwahl vorgestellt, die die Problemstellung, die theoretische Fundierung und die Ergebnisse der Studien untersuchen. Die Diskussion der Ergebnisse im Kontext von Thesen aus der Literatur rundet das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Sozialwahltheorie, wie der Präferenzbildung, Verteilungsfragen, dem Rawlsschen Maximin-Prinzip, dem Utilitarismus und empirischen Studien zur Sozialwahl. Besondere Aufmerksamkeit erhält die Interpretation von realen Faktoren, die beobachtete Präferenzmuster prägen. Die Arbeit analysiert Entscheidungssituationen im politischen Prozess und trägt zur Diskussion von alternativen Verteilungskonzepten bei.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kerngebiet der Empirischen Sozialwahl (Empirical Social Choice)?
Sie untersucht praktisch und empirisch, wie Menschen kollektive Präferenzen bilden und welche Faktoren Verteilungsentscheidungen in der Realität beeinflussen.
Was ist das Maximin-Prinzip von John Rawls?
Es ist ein Gerechtigkeitsprinzip, das besagt, dass soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten so gestaltet sein müssen, dass sie den am wenigsten begünstigten Mitgliedern der Gesellschaft den größten Vorteil bringen.
Wie unterscheidet sich der Utilitarismus vom Rawlsschen Prinzip?
Während Rawls die Schwächsten schützt, zielt der Utilitarismus auf die Maximierung des Gesamtnutzens oder der Summe des Wohlergehens aller Individuen ab.
Welche Faktoren beeinflussen laut der Studie von Gaertner und Jungeilges die Präferenzbildung?
Die Studie untersucht unter anderem den Einfluss von Ordnungskenntnis, zeitlichen Entwicklungen und politökonomischen Charakteristika an verschiedenen Standorten.
Welchen Nutzen haben diese Erkenntnisse für den politischen Prozess?
Sie helfen dabei, Entscheidungssituationen so zu gestalten, dass sie gesellschaftlich akzeptierte Verteilungsmuster widerspiegeln und Gerechtigkeitsvorstellungen integrieren.
- Arbeit zitieren
- Martin Thienel (Autor:in), 2008, Empirical Social Choice, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161711