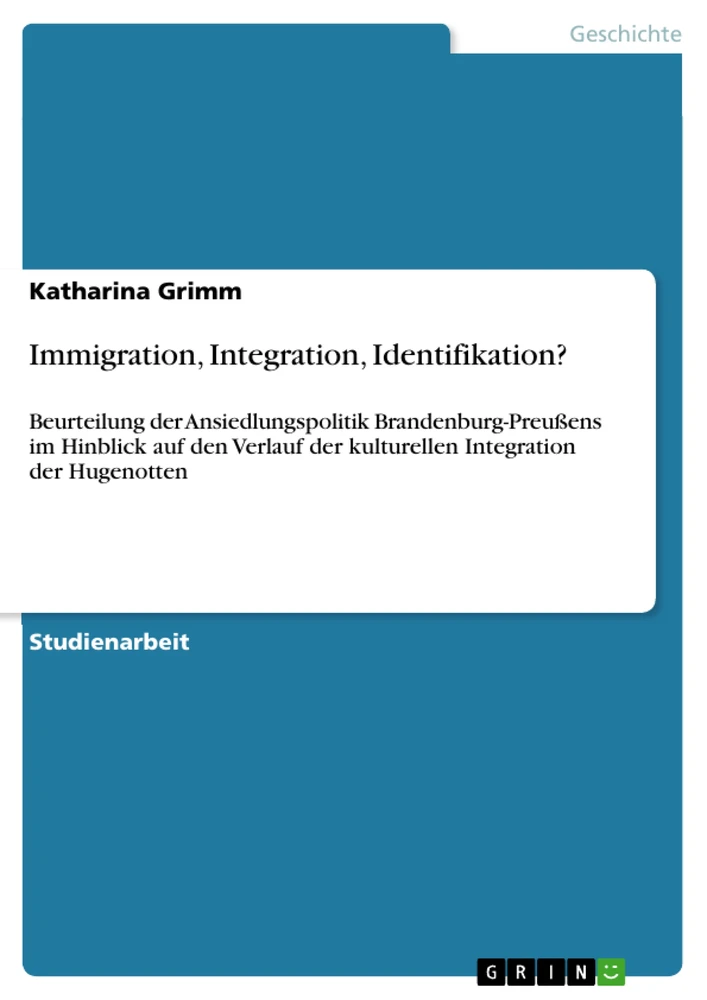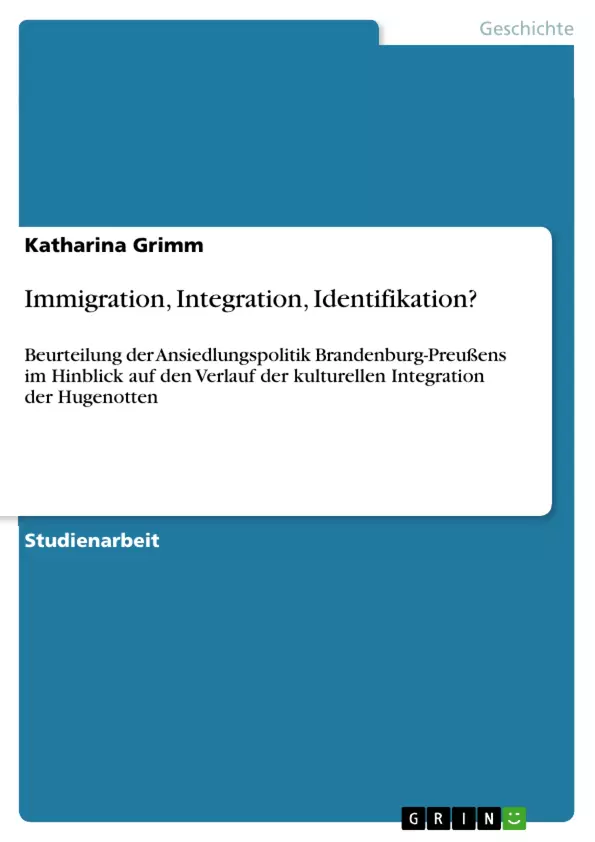Die Neuansiedlung von etwa 20.000 verfolgten Hugenotten im Brandenburg-Preußen des 17. Jahrhunderts stellt einen der entscheidensten Migrationsprozesse der europäischen Geschichte dar1. Insgesamt machen sie die Hälfte aller nach Deutschland geflohenen französischen Protestanten aus, die aufgrund ihrer Konfession aus dem katholischen Frankreich mittels politischer Zwangsmaßnahmen vertrieben wurden. Die hohe Anzahl an hugenottischen Flüchtlingen in Brandenburg-‐Preußen lässt sich dabei durch die Ansiedlungspolitik von Kurfürst Friedrich Wilhelm erklären, der den Hugenotten durch das Edikt von Potsdam eine Reihe von Privilegien in seinem Reich einräumte.
In Literatur und Forschung lassen sich heute zahlreiche Ergebnisse zu
Motiven, Hintergründen und anderen Details der von Friedrich Wilhelm gewährten Vorteile finden. Das gleiche gilt für Edikte und Gesetzesentwürfe auf der französischen Seite, die die Glaubensverfolgung der Hugenotten politisch und juristisch legitimierten. Weniger häufig hingegen werden vor deren Hintergrund
jedoch tatsächliche Dekulturations- und Akkulturationsprozesse
beleuchtet, die mit der gewaltsamen Vertreibung aus dem eigenen und der Ansiedlung in einem fremden Land einhergehen. So muss behandelt werden, inwiefern eine rechtliche Privilegierung in der neuen Heimat
eine Integration in die hiesige Bevölkerung fördert oder hemmt. Dabei
geht es um die Schaffung einer Balance, genauer um die Antwort auf die Frage, wie eine Bevölkerungsgruppe durch Freiheiten und Privilegierung ins Land gezogen und trotz dieser rechtlichen Sonderstellung Akzeptanz unter den neuen Mitbürgern finden kann.
[...]
1 Pfister 2007, S. 111
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rahmenbedingungen der Migration
- Entwicklung der Ausgangssituation in Frankreich
- Die Ansiedlungspolitik Friedrich Wilhelms: Beweggründe und Ziele
- Der Integrationsprozess
- Hürden und Herausforderungen
- Maßnahmen zur gezielten Integration
- Erfolg der Maßnahmen vor dem Hintergrund von Hürden und Zielen der Integration
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Integration der Hugenotten in Brandenburg-Preußen im 17. Jahrhundert. Sie untersucht die Rolle der staatlichen Integrationspolitik im Vergleich zum tatsächlichen Akkulturationsprozess der Flüchtlinge. Dabei werden die Bedürfnisse, die eine solche Ansiedlung an eine Integrationspolitik stellt, sowie der Umgang beider Bevölkerungsgruppen mit der Situation analysiert.
- Die politische Ausgangslage in Frankreich und Brandenburg-Preußen
- Die Ansiedlungspolitik Friedrich Wilhelms und deren Ziele
- Die Herausforderungen und Hürden des Integrationsprozesses
- Der Einfluss staatlicher Integrationsmaßnahmen auf die Akkulturation der Hugenotten
- Die Bedeutung von Institutionen und Medien für die Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Hugenotten-Migration für die europäische Geschichte dar und führt in das Thema der Arbeit ein. Sie beleuchtet die mangelnde Erforschung der Dekulturations- und Akkulturationsprozesse und die Frage, inwieweit rechtliche Privilegierung die Integration fördert oder hemmt.
Rahmenbedingungen der Migration
Entwicklung der Ausgangssituation in Frankreich
Dieser Abschnitt beschreibt die politische und religiöse Situation in Frankreich im 17. Jahrhundert, die zur Verfolgung der Hugenotten führte. Er beleuchtet die Reformation, die Religionskriege und die Aufhebung des Edikts von Nantes durch Ludwig XIV.
Die Ansiedlungspolitik Friedrich Wilhelms: Beweggründe und Ziele
Hier werden die Beweggründe und Ziele der Ansiedlungspolitik Friedrich Wilhelms dargestellt. Das Edikt von Potsdam und andere Gesetze, die den Hugenotten Privilegien gewährten, werden erläutert.
Der Integrationsprozess
Hürden und Herausforderungen
Dieser Abschnitt beleuchtet die Herausforderungen und Hürden, die mit der Integration einer fremdkulturellen Bevölkerungsgruppe verbunden waren. Er analysiert die Unterschiede in Sprache, Kultur, Religion und Lebensweise.
Maßnahmen zur gezielten Integration
Hier werden die von Friedrich Wilhelm ergriffenen Maßnahmen zur Integration der Hugenotten vorgestellt. Dazu gehören die Schaffung von Siedlungen, die Förderung von Handwerk und Gewerbe sowie die Unterstützung beim Spracherwerb.
Erfolg der Maßnahmen vor dem Hintergrund von Hürden und Zielen der Integration
Dieser Abschnitt betrachtet die Erfolge und Misserfolge der Integrationspolitik. Er analysiert, inwieweit die Hugenotten in die brandenburg-preußische Gesellschaft integriert wurden und welche Faktoren zu diesem Prozess beigetragen haben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der Hugenotten-Migration, der Ansiedlungspolitik Friedrich Wilhelms, der Integration, der Akkulturation, der Dekulturation, der Religionsfreiheit, der Staatsreligion und der Rolle von Institutionen und Medien im Integrationsprozess. Sie verwendet Begriffe wie Edikt von Potsdam, Edikt von Nantes, Bartholomäusnacht, Religionskriege, Konfession, Privilegien und Identität.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Hugenotten?
Hugenotten waren französische Protestanten, die im 17. Jahrhundert aufgrund ihres Glaubens aus dem katholischen Frankreich vertrieben wurden.
Was war das Edikt von Potsdam (1685)?
Ein Toleranzedikt des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, das den verfolgten Hugenotten sichere Aufnahme und Privilegien in Brandenburg-Preußen garantierte.
Welche Privilegien erhielten die Hugenotten?
Dazu gehörten Steuerbefreiungen, Unterstützung beim Hausbau, Religionsfreiheit und das Recht auf eigene Gerichtsbarkeit und Sprache.
War die Integration der Hugenotten erfolgreich?
Ja, trotz kultureller Hürden trugen sie maßgeblich zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg Brandenburg-Preußens bei.
Was bedeutet Akkulturation im Kontext der Hugenotten?
Es beschreibt den Prozess der Anpassung an die neue Kultur bei gleichzeitigem Erhalt bestimmter französischer Traditionen und Identitätsmerkmale.
- Quote paper
- Katharina Grimm (Author), 2010, Immigration, Integration, Identifikation? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161721