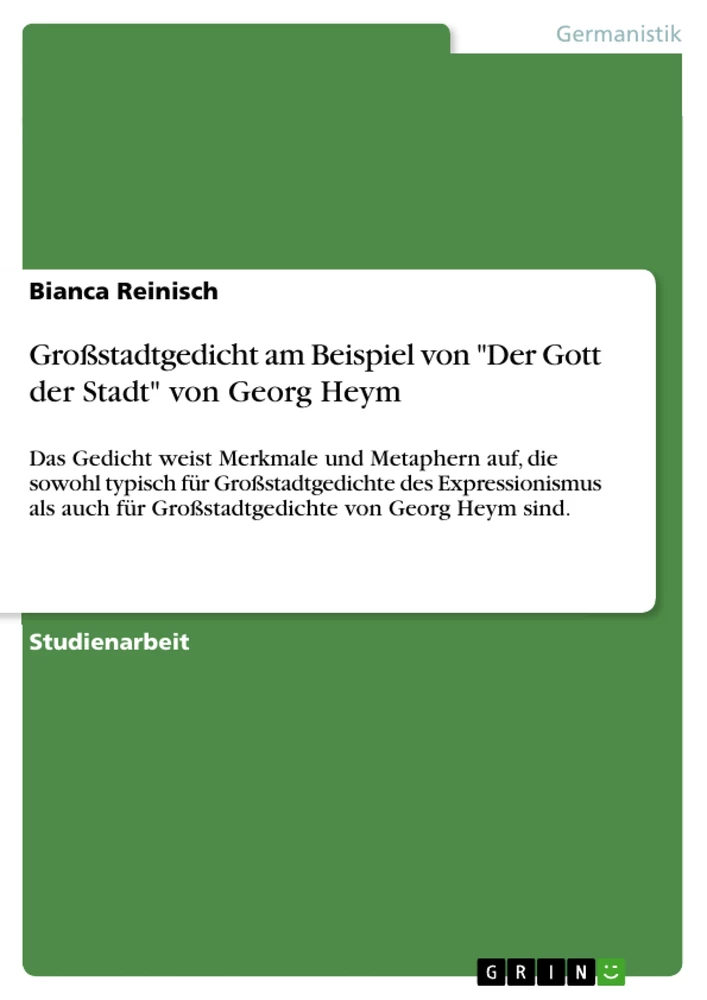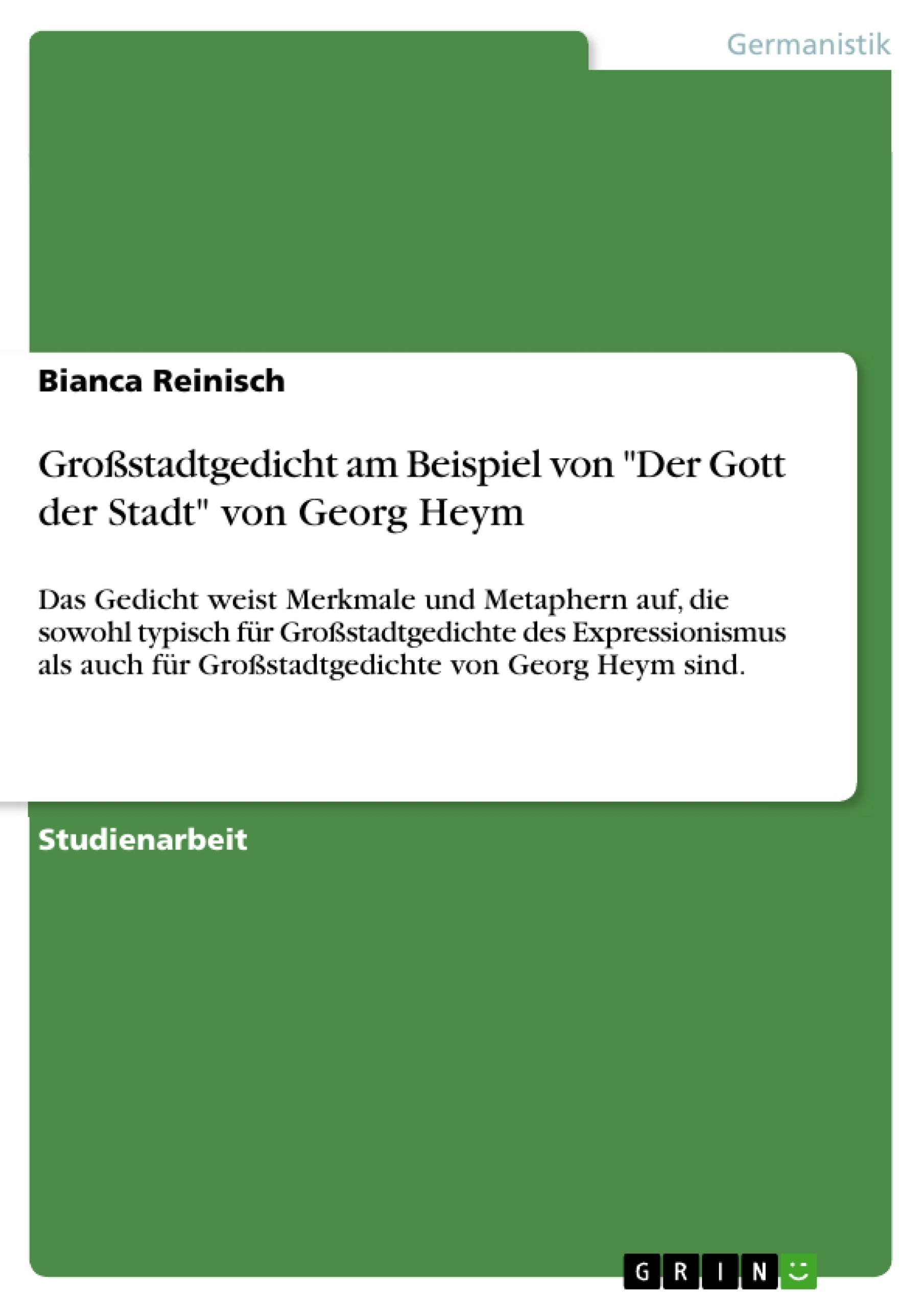Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 3
2. Die Stadt im Expressionismus 3
2.1. Einordnung des Expressionismus in den historischen Kontext mit besonderem Blickpunkt auf die Entwicklung der Großstädte im beginnenden 19. Jahrhundert 3
2.2. Die Reaktionen der expressionistischen Autoren, insbesondere der Lyriker auf diese Entwicklung 5
3. Das Motiv „Stadt“ bei Georg Heym 6
3.1. Biografische Bezüge Heyms zu Städten und Großstädten 6
3.2. Die Verarbeitung des Themas „Stadt“ in den lyrischen Werken Heyms 7
4. „Der Gott der Stadt“ als typisches Werk Georg Heyms und des Expressionismus 9
5. Zusammenfassung der Ergebnisse 11
Literaturverzeichnis 12
1. Einleitung
In der vorliegenden Hausarbeit möchte ich mich mit dem Gedicht „ Der Gott der Stadt“ von Georg Heym beschäftigen und beweisen, dass dieses Werk sowohl typisch für den Expressionismus als auch für Georg Heym ist. Insbesondere die Thematik ‚Stadt‘ war immer wieder Bestandteil lyrischer Werke der expressionistischen Autoren und wurde vielfältig umgesetzt. Georg Heym selbst gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Epoche und prägte sie, obwohl nur zwei Jahre als seine Hauptschaffensphase bezeichnet werden können, sehr stark. Anhand von „Der Gott der Stadt“ möchte ich die persönliche Herangehensweise Heyms an die Thematik aufweisen und zeigen, dass viele Merkmale und Metaphern des Gedichtes übereinstimmen mit denen, die auch von anderen Expressionisten verwendet wurden.
Zu Beginn werde ich jedoch erst einmal den geschichtlichen Aspekt der Epoche näher betrachten, um ein klares Bild zu bekommen in welchem Umfeld die damaligen Lyriker lebten und arbeiteten und woher sie die Themen und Motive für ihre Werke bezogen. Im nächsten Kapitel möchte ich auf biografische Bezüge Heyms zum Thema ‚Stadt‘ und seine Erfahrungen mit der Großstadt eingehen. Auch wie er diese Eindrücke umsetzte, wird Bestandteil dieser Arbeit sein. Zuletzt möchte ich beweisen, dass das Gedicht „Der Gott der Stadt“ viele Merkmale aufweist, die sowohl charakteristisch für die Großstadtlyrik des Expressionismus als auch für die Großstadtlyrik von Heym sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Stadt im Expressionismus
- Einordnung des Expressionismus in den historischen Kontext mit besonderem Blickpunkt auf die Entwicklung der Großstädte im beginnenden 19. Jahrhundert.
- Die Reaktionen der expressionistischen Autoren, insbesondere der Lyriker auf diese Entwicklung
- Das Motiv „Stadt“ bei Georg Heym
- Biografische Bezüge Heyms zu Städten und Großstädten
- Die Verarbeitung des Themas „Stadt“ in den lyrischen Werken Heyms
- „Der Gott der Stadt“ als typisches Werk Georg Heyms und des Expressionismus.
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Georg Heyms Gedicht „Der Gott der Stadt“ und zeigt auf, dass dieses Werk sowohl typisch für den Expressionismus als auch für Heyms eigene Poetik ist. Im Fokus steht die Thematik der Stadt, die in der expressionistischen Literatur eine zentrale Rolle spielt und in vielfältiger Weise behandelt wird. Die Arbeit untersucht Heyms persönliche Sicht auf die Stadt und seine künstlerische Auseinandersetzung mit den urbanen Lebensbedingungen. Darüber hinaus werden die Gemeinsamkeiten zwischen Heyms Gedicht und der expressionistischen Großstadtlyrik im Allgemeinen aufgezeigt.
- Die Einordnung des Expressionismus in den historischen Kontext mit besonderer Berücksichtigung der urbanen Entwicklung
- Die Reaktion der expressionistischen Lyriker auf die Industrialisierung und Urbanisierung
- Die Rolle der Stadt in Georg Heyms Leben und Werk
- „Der Gott der Stadt“ als exemplarische Darstellung der Großstadtlyrik des Expressionismus
- Die Analyse von typischen Merkmalen und Metaphern in Heyms Gedicht
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema und die Zielsetzung der Hausarbeit vor und führt in die Thematik der Großstadt im Expressionismus ein.
- Kapitel 2 beleuchtet den historischen Kontext des Expressionismus mit einem besonderen Fokus auf die Entwicklung der Großstädte im 19. Jahrhundert. Es werden die Auswirkungen der Industrialisierung, Urbanisierung und des Ersten Weltkriegs auf die Lebensbedingungen der Menschen in der Stadt dargestellt.
- Kapitel 3 behandelt die Reaktion der expressionistischen Autoren, insbesondere der Lyriker, auf diese Entwicklung. Es wird deutlich, dass die Industrialisierung und die Urbanisierung als negative Prozesse wahrgenommen wurden, die zur Verfalls- und Untergangsstimmung der Epoche beitrugen. Die Lyriker suchten nach einer Flucht in die Natur oder das Ursprüngliche.
- Kapitel 4 widmet sich dem Motiv der Stadt im Werk von Georg Heym. Es wird auf seine biografischen Erfahrungen mit der Großstadt eingegangen und die Verarbeitung dieser Eindrücke in seinen lyrischen Werken untersucht.
- Kapitel 5 analysiert Heyms Gedicht „Der Gott der Stadt“ als typisches Werk des Expressionismus. Es werden die spezifischen Merkmale des Gedichts untersucht und herausgearbeitet, welche Gemeinsamkeiten es mit der expressionistischen Großstadtlyrik aufweist.
Schlüsselwörter
Expressionismus, Großstadtlyrik, Industrialisierung, Urbanisierung, Georg Heym, „Der Gott der Stadt“, Verfall, Untergang, Natur, Ursprünglichkeit, Stadt als Metapher, Lebensbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Georg Heyms „Der Gott der Stadt“ ein typisches expressionistisches Werk?
Das Gedicht nutzt typische Metaphern des Verfalls und des Untergangs und thematisiert die Stadt als dämonische, alles verschlingende Kraft.
Wie wird die Stadt im Expressionismus dargestellt?
Die Stadt wird oft als negativer, lebensfeindlicher Ort der Industrialisierung und Urbanisierung wahrgenommen, der zur Entfremdung des Individuums führt.
Welchen biografischen Bezug hatte Georg Heym zur Großstadt?
Die Arbeit untersucht Heyms persönliche Erfahrungen in urbanen Zentren und wie diese seine düstere lyrische Verarbeitung des Themas prägten.
Was symbolisiert der „Gott“ in Heyms Gedicht?
Der Gott (oft als Baal interpretiert) symbolisiert die grausame, unpersönliche Macht der modernen Großstadt, die über die Menschen herrscht.
Welche historischen Ereignisse beeinflussten die expressionistische Lyrik?
Die rasante Industrialisierung im 19. Jahrhundert und die damit verbundene Urbanisierung schufen das soziale Umfeld, auf das die Expressionisten mit ihren Werken reagierten.
- Quote paper
- Bianca Reinisch (Author), 2008, Großstadtgedicht am Beispiel von "Der Gott der Stadt" von Georg Heym, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161726