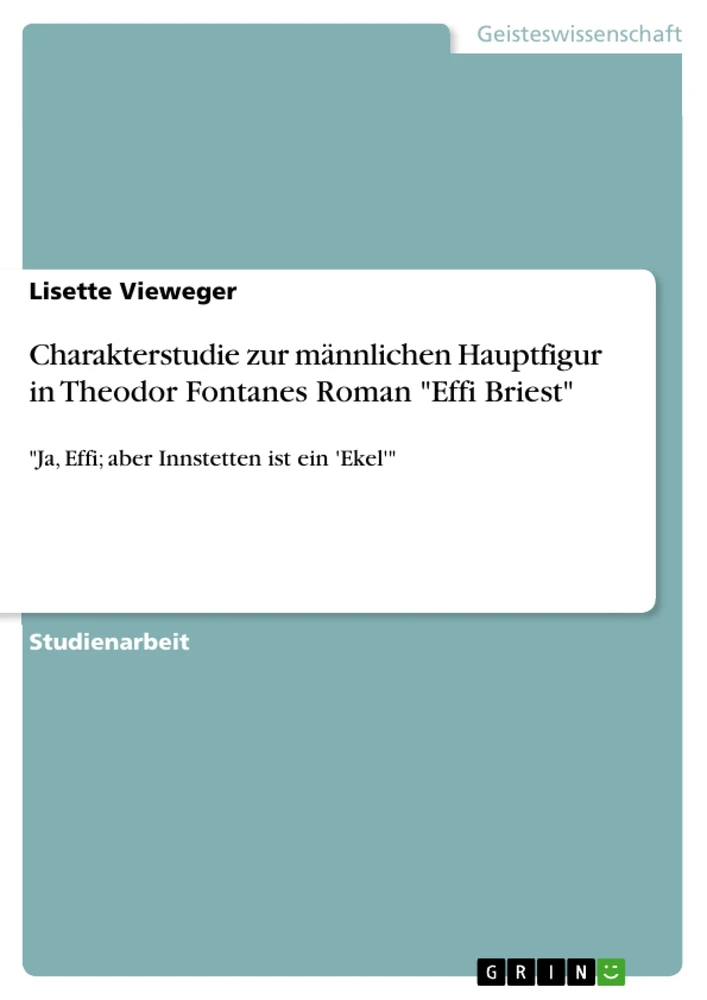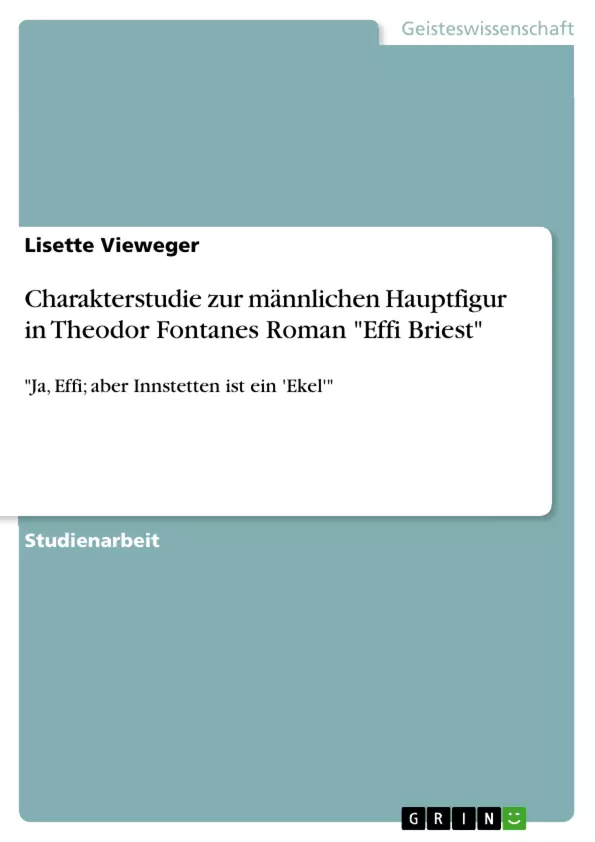Die männliche Hauptfigur in Fontanes von 1889-1894 entstandenem Roman Effi Briest ist von Lesern und Kritikern größtenteils wenig wohlwollend bewertet worden. Wie aus Fontanes Briefen hervorgeht, wurde Innstetten von ihm jedoch nicht notwendigerweise als ausgesprochen negativ besetzte Figur konzipiert.
Andererseits gibt Fontane zu, sich regelmäßig in seine Frauengestalten zu verlieben, und zwar um ihrer Menschlichkeit und Schwächen willen. Bei ihnen, wie auch bei Effi deutlich zu erkennen, obwohl auch sie nur ein Produkt der Gesellschaft ist, in der sie lebt, legt er vor allem Wert auf Natürlichkeit, während eine Figur wie Innstetten ein reines Kunstprodukt ist; seine ganze Tugend, seine Prinzipien wie auch sein gesamtes Wesen stellen ein Konstrukt dar, dem jegliche Menschlichkeit fehlt, und das schließlich am Schluß des Romans einer Rechtfertigung nicht standhält, weil der Baron das, was er für sein Glück gehalten hatte, trotzdem verliert. Zur Interpretation der Figur Innstetten gibt es verschiedene Ansätze. Zumeist wird die psychologische Erklärung für sein Verhalten in seiner Vorgeschichte gesucht, welche durch Effi noch vor seinem eigentlichen Auftritt in einer unzusammenhängenden Erzählung ihren Freundinnen gegenüber vorgestellt wird. Der sich dabei stellenden Frage, warum Innstetten um die Tochter seiner Jugendliebe Luise, die damals anstatt seiner den älteren Briest geheiratet hat, wirbt, und der Deutung seiner Persönlichkeitsentwicklung kann man sich auf unterschiedliche Weise annähern. Eine besonders außergewöhnliche und so gewagte wie neuartige Interpretation wird von Michael Masanetz vorgestellt. Den ersten Kapiteln des Romans mit der Vorgeschichte von Effis Eltern möchte ich hier besonders viel Aufmerksamkeit widmen, da dieser Teil die Erklärung für Innstettens spätere Verhaltensmotive liefert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vorlage für den Roman Effi Briest
- Die Einführung der Figur Innstetten in die Handlung
- Michael Masanetz' Deutung der Vorgeschichte und Innstettens Heiratsmotive
- Innstettens Unbeliebtheit
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figur des Innstetten in Theodor Fontanes Roman "Effi Briest". Ziel ist es, die mehrheitlich negative Rezeption dieser Figur zu beleuchten und verschiedene Interpretationsansätze zu präsentieren, insbesondere im Hinblick auf Innstettens Vorgeschichte und seine Motivationen. Die Arbeit analysiert Fontanes eigene Sicht auf die Figur und beleuchtet die literarische Verarbeitung einer realen Begebenheit.
- Die Rezeption der Figur Innstetten
- Fontanes Intentionen bei der Gestaltung der Figur Innstetten
- Die Vorgeschichte und die Heiratsmotive Innstettens
- Die literarische Verarbeitung einer wahren Begebenheit
- Psychologische Interpretation von Innstettens Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die überwiegend negative Wahrnehmung der Figur Innstetten durch Leser und Kritiker und stellt Fontanes eigene, differenziertere Sichtweise gegenüber. Sie führt in die Thematik der Arbeit ein und skizziert den Ansatz der Untersuchung verschiedener Interpretationsansätze.
Die Vorlage für den Roman Effi Briest: Dieses Kapitel beleuchtet die realen Ereignisse, die als Grundlage für Fontanes Roman dienten. Es beschreibt die Begegnung Fontanes mit der Geschichte und die entscheidenden Elemente, die ihn zur literarischen Bearbeitung inspirierten. Im Fokus steht der Vergleich zwischen der realen Elisabeth von Plotho und Armand von Ardenne und ihren fiktiven Gegenstücken Effi Briest und Innstetten, sowie die Ähnlichkeiten und Unterschiede in ihren Leben. Die Rolle der unverbrannten Briefe und deren literarische Umsetzung werden als kritischer Punkt des Romans diskutiert. Fontanes eigene Reflexionen über die Wahrscheinlichkeit und Trivialität dieser Ereignisse werden eingebunden.
Häufig gestellte Fragen zu "Effi Briest": Innstetten - Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Figur des Innstetten in Theodor Fontanes Roman "Effi Briest". Im Mittelpunkt steht die überwiegend negative Rezeption dieser Figur und die Untersuchung verschiedener Interpretationsansätze, insbesondere hinsichtlich Innstettens Vorgeschichte und Motivationen. Die Arbeit beleuchtet Fontanes eigene Sicht auf die Figur und die literarische Verarbeitung einer realen Begebenheit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Rezeption der Figur Innstetten, Fontanes Intentionen bei der Gestaltung dieser Figur, Innstettens Vorgeschichte und Heiratsmotiven, der literarischen Verarbeitung einer wahren Begebenheit und einer psychologischen Interpretation von Innstettens Verhalten. Es wird auch der Vergleich zwischen der realen Vorlage und der literarischen Figur gezogen und die Rolle der unverbrannten Briefe diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel wie Einleitung, die Vorlage für den Roman Effi Briest (inkl. Vergleich zwischen realen und fiktiven Figuren und der Bedeutung der unverbrannten Briefe), die Einführung der Figur Innstetten in die Handlung, Michael Masanetz' Deutung der Vorgeschichte und Innstettens Heiratsmotive, Innstettens Unbeliebtheit und ein Resümee. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Fontanes Roman "Effi Briest" selbst und analysiert verschiedene Interpretationen und Rezeptionen der Figur Innstetten. Die Untersuchung berücksichtigt die reale Begebenheit, die als Grundlage für den Roman diente, und bezieht Fontanes eigene Reflexionen mit ein. Die Arbeit zitiert explizit die Deutung von Michael Masanetz.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die mehrheitlich negative Wahrnehmung der Figur Innstetten zu beleuchten und verschiedene Interpretationsansätze zu präsentieren. Es geht darum, ein differenziertes Bild von Innstetten zu zeichnen und Fontanes Intentionen bei der Gestaltung dieser Figur zu verstehen. Die Arbeit zielt auf ein tieferes Verständnis des Romans und seiner literarischen Gestaltungsmittel ab.
Wie wird die Figur Innstetten dargestellt?
Die Arbeit präsentiert Innstetten als eine komplexe Figur, deren Rezeption überwiegend negativ ist. Die Analyse zielt darauf ab, die Gründe für diese negative Wahrnehmung zu ergründen und verschiedene Perspektiven auf die Figur und ihre Motivationen zu beleuchten. Der Fokus liegt auf einem differenzierten Verständnis der Figur, anstatt einer einfachen moralischen Bewertung.
- Citar trabajo
- Lisette Vieweger (Autor), 2008, Charakterstudie zur männlichen Hauptfigur in Theodor Fontanes Roman "Effi Briest", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161755