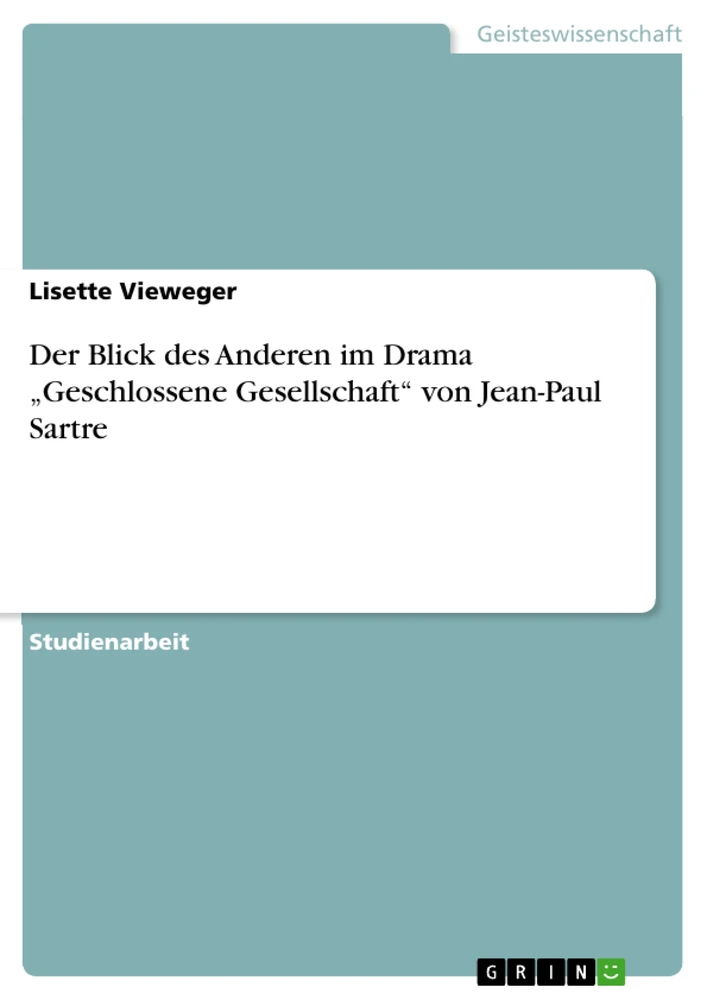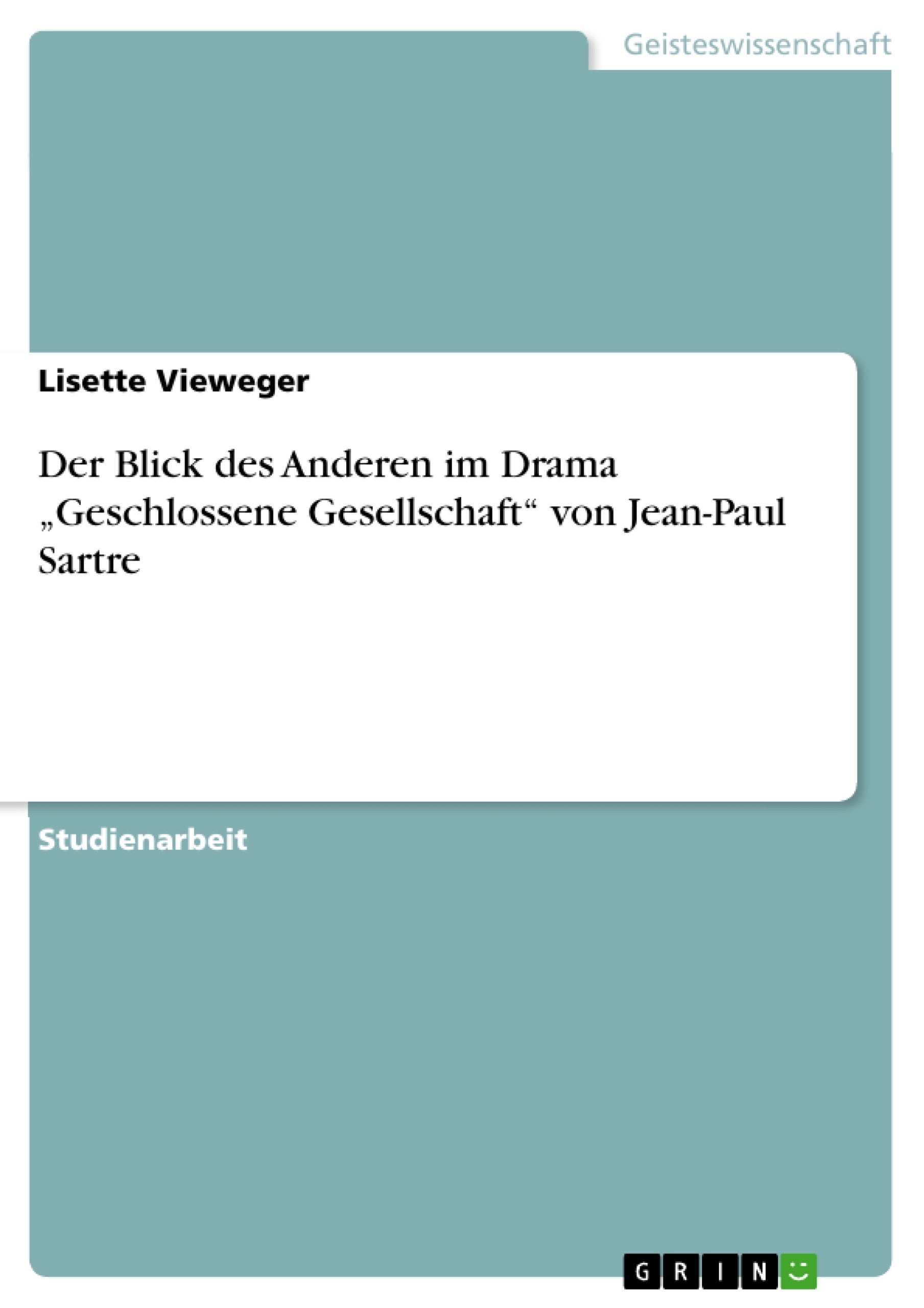Jean-Paul Sartre (1905-1980) hat seine Gedanken nicht nur in zahlreichen philosophischen Abhandlungen festgehalten, sondern sich auch anderer Literaturgattungen bedient, unter anderem des Romans und des Dramas. Eines dieser Dramen ist ‚Geschlossene Gesellschaft‘ (Huis clos, 1944). Die Thematik des Stückes korrespondiert mit Sartres Überlegungen zum Blick, zur Freiheit und zu zwischenmenschlichen Beziehungen im allgemeinen, welche er zu einem großen Teil in seinem philosophischen Hauptwerk ‚Das Sein und das Nichts‘ (L’être et le néant, 1943) behandelt. Einige Autoren, die sich analytisch mit Sartres Theaterstücken beschäftigt haben, weisen jedoch auf den Umstand hin, daß „viele Theaterstücke Sartres vor allem in Deutschland falsch inszeniert werden, d. h. zu ernst genommen, nämlich auf angeblich eindeutige existentialistische Botschaften hin stilisiert werden.“ Sartre selbst betonte, daß der vielzitierte Satz „Die Hölle, das sind die andern“ immer falsch verstanden worden sei in dem Sinne, daß man glaubte, er wolle „damit sagen, daß unsere Beziehungen zu andren immer vergiftet sind, daß es immer teuflische Beziehungen sind. Es ist aber etwas ganz andres, was ich sagen will. Ich will sagen, wenn die Beziehungen zu andern verquer, vertrackt sind, dann kann der andre nur die Hölle sein.“ Dieser Zustand intensiviert sich umso mehr, je stärker eine Person vom Urteil anderer abhängig ist. Auf diesem Verhältnis und seiner Darstellung in ‚Geschlossene Gesellschaft‘ soll das Augenmerk der folgenden Untersuchung liegen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Theater Sartres
- 2. Das Drama „Geschlossene Gesellschaft“
- 2.1 Entstehung
- 2.2 Ansatzpunkte der Analyse
- 3. Der Blick
- 3.1 Das Theaterpublikum
- 3.2 Der Blick des Anderen in „Huis clos“
- 4. Das Motiv der Freiheit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Jean-Paul Sartres Drama „Geschlossene Gesellschaft“ (Huis clos) und analysiert dessen Darstellung zwischenmenschlicher Beziehungen im Kontext von Sartres Philosophie der Freiheit und des Blicks des Anderen. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Inszenierung des Verhältnisses zwischen individueller Freiheit und der Abhängigkeit vom Urteil anderer.
- Sartres Theatertheorie und deren Anwendung in „Geschlossene Gesellschaft“
- Der Einfluss des Blicks des Anderen auf die Figuren und deren Handlungsfreiheit
- Das Motiv der Freiheit und die existenzielle Situation der Figuren
- Die Rolle des Absurden und Grotesken als Mittel des theatralischen Diskurses
- Die Bedeutung der Sprache und Gestik in Sartres Drama
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Dramas „Geschlossene Gesellschaft“ ein und skizziert den Zusammenhang zwischen Sartres philosophischer Arbeit und seinem Theater. Sie hebt die Bedeutung des Blicks des Anderen, der Freiheit und zwischenmenschlicher Beziehungen hervor, und betont die Notwendigkeit, Sartres Theater nicht einseitig auf existentialistische Botschaften zu reduzieren. Der Fokus der Arbeit wird auf das Verhältnis zwischen den Figuren und deren Abhängigkeit vom Urteil der anderen gelegt.
1. Das Theater Sartres: Dieses Kapitel beleuchtet Sartres Theatertheorie und seine Abkehr von rein philosophischer Darstellung. Es diskutiert die Bedeutung des absurden und grotesken Elements als Mittel der theatralischen Verfremdung, und stellt Sartres Theater in Bezug zu anderen zeitgenössischen Strömungen wie dem epischen Theater Brechts. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit von Distanz und Identifikation für den Zuschauer sowie der Bedeutung von Sprache und Gestik in Sartres dramatischer Gestaltung. Die Wahl der „Hölle“ als Schauplatz von „Geschlossene Gesellschaft“ wird als Mittel zur räumlichen Distanzierung analysiert, jedoch auch als Ausdruck eines existenziellen Zustands.
2. Das Drama „Geschlossene Gesellschaft“: Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehung des Stücks und analysiert seine Ansatzpunkte. Die Entstehung wird im Kontext des Auftrags und der Anforderungen an eine leicht zu inszenierende Bühnenfassung für eine Tournee dargestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Vorbereitung der anschließenden Analyse, die in den folgenden Kapiteln durchgeführt wird.
Häufig gestellte Fragen zu Jean-Paul Sartres „Geschlossene Gesellschaft“
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Jean-Paul Sartres Drama „Geschlossene Gesellschaft“ (Huis clos) und untersucht die Darstellung zwischenmenschlicher Beziehungen im Kontext von Sartres Philosophie der Freiheit und des Blicks des Anderen. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis zwischen individueller Freiheit und der Abhängigkeit vom Urteil anderer.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Sartres Theatertheorie und deren Anwendung in „Geschlossene Gesellschaft“, den Einfluss des Blicks des Anderen auf die Figuren und deren Handlungsfreiheit, das Motiv der Freiheit und die existenzielle Situation der Figuren, die Rolle des Absurden und Grotesken, sowie die Bedeutung von Sprache und Gestik in Sartres Drama.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Sartres Theater, ein Kapitel zum Drama „Geschlossene Gesellschaft“ (mit Unterkapiteln zur Entstehung und den Ansatzpunkten der Analyse), ein Kapitel zum Thema „Der Blick“, ein Kapitel zum Motiv der Freiheit und einen Schluss.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, skizziert den Zusammenhang zwischen Sartres Philosophie und seinem Theater, hebt die Bedeutung des Blicks des Anderen, der Freiheit und zwischenmenschlicher Beziehungen hervor und betont den Fokus auf das Verhältnis zwischen den Figuren und deren Abhängigkeit vom Urteil der anderen.
Worum geht es im Kapitel über Sartres Theater?
Dieses Kapitel beleuchtet Sartres Theatertheorie, seine Abkehr von rein philosophischer Darstellung, die Bedeutung des Absurden und Grotesken, den Bezug zu anderen zeitgenössischen Strömungen und die Bedeutung von Distanz, Identifikation, Sprache und Gestik im Zuschauererlebnis. Die Wahl der „Hölle“ als Schauplatz wird analysiert.
Was wird im Kapitel über „Geschlossene Gesellschaft“ behandelt?
Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehung des Stücks im Kontext seines Auftrags und der Anforderungen an eine leicht zu inszenierende Bühnenfassung und analysiert dessen Ansatzpunkte zur Vorbereitung der folgenden Analyse.
Was beinhaltet das Kapitel „Der Blick“?
Dieses Kapitel behandelt den Blick des Theaterpublikums und den Blick des Anderen in „Huis clos“ im Detail.
Wie wird das Motiv der Freiheit behandelt?
Das Kapitel zum Motiv der Freiheit untersucht die existenzielle Situation der Figuren im Kontext ihrer Freiheit und Abhängigkeit von den Urteilen anderer.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Jean-Paul Sartre, Geschlossene Gesellschaft (Huis clos), Existenzialismus, Theatertheorie, Blick des Anderen, Freiheit, zwischenmenschliche Beziehungen, Absurdes, Groteskes, Sprache, Gestik.
- Citar trabajo
- Lisette Vieweger (Autor), 2006, Der Blick des Anderen im Drama „Geschlossene Gesellschaft“ von Jean-Paul Sartre, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161757