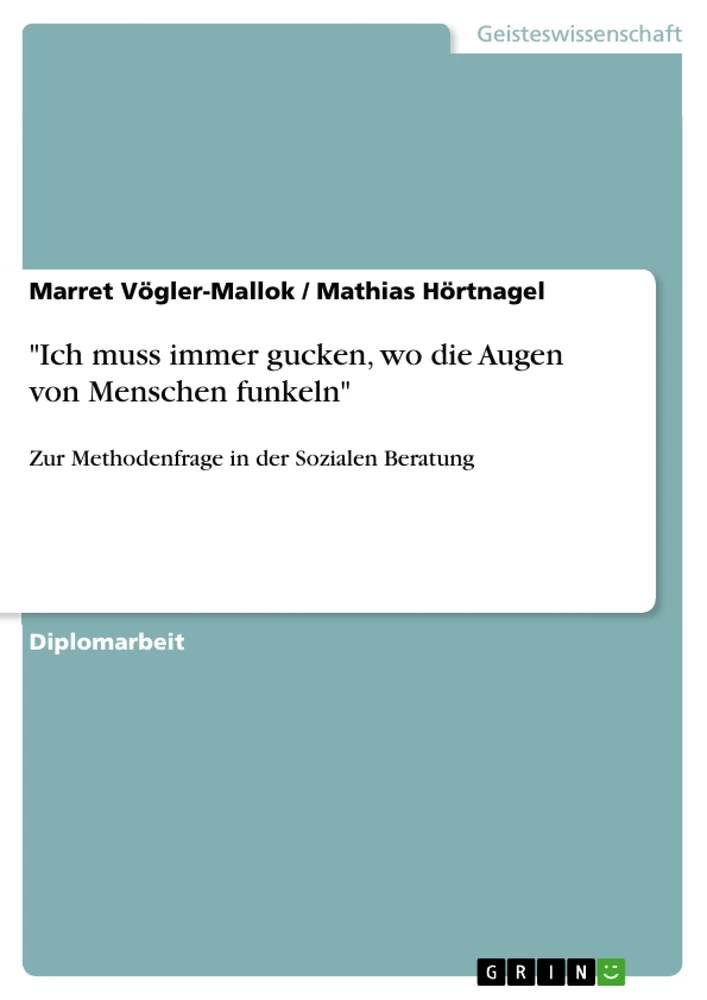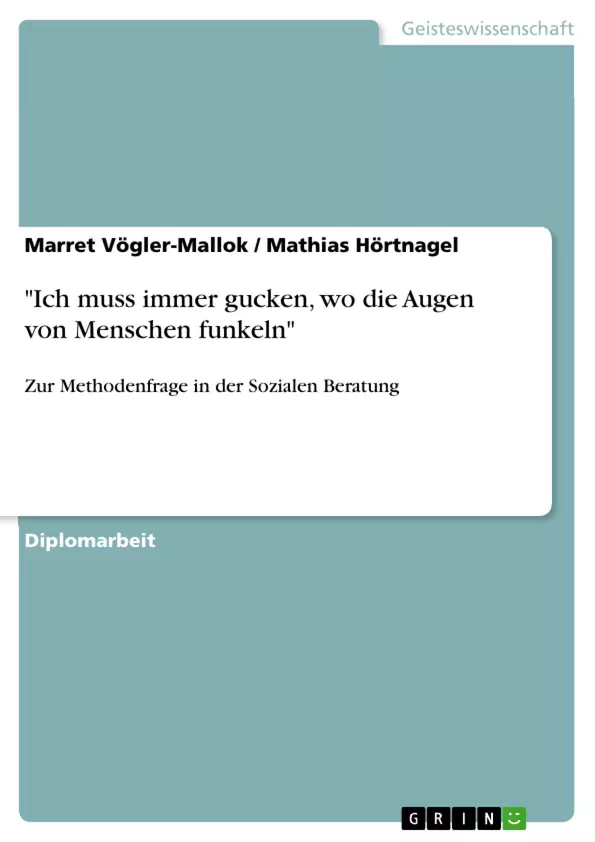In der Sozialen Arbeit ist seit Beginn des neuen Jahrtausends verschärft eine Diskussion über Beratungsmethoden in verschiedenen Handlungsfeldern ausgebrochen (vgl. z.B. Neuffer 2000). Dieses steht natürlich in engem Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Umwälzungen im Zuge von Globalisierung, Ökonomisierung und Individualisierung. Traditionelle Netzwerke (Familie etc.) verlieren zunehmend an Bedeutung, Lebensrisiken werden aufgrund der Finanzkrise der öffentlichen Haushalte immer stärker privatisiert. Somit sind Menschen mehr und mehr gezwungen, ihr Leben eigenständig zu gestalten. Dies kann neue Freiräume eröffnen, aber gleichzeitig die Gefahr der
Überforderung in sich bergen. Die „Risikogesellschaft“ (Ulrich Beck) produziert einen großen Bedarf an Beratung in den unterschiedlichsten sozialen Bereichen. Menschen, die zu den Globalisierungsgewinnern gehören, suchen nach Unterstützung, ihren Alltag möglichst ökonomisch zu gestalten. Beratung dient hier vor allem dem Coaching und Zeitmanagement. Auf der anderen Seite wächst die Zahl derer, die aufgrund der wirtschaftlichen Umbrüche („Turbokapitalismus“) auf der Strecke bleiben, in finanzielle und persönliche Not geraten, aus der sie aus eigener Kraft nicht herausfinden können, und daher
entsprechende professionelle Hilfe (Schuldnerberatung etc.) benötigen.
Für die Soziale Arbeit bedeutet dieser vielfältige Beratungsbedarf eine enorme Herausforderung. Die Frage nach der Gestaltung von Beratung, d.h. dem Aufbau von Beziehungen zu den Klienten, dem Schaffen geeigneter Settings, der Anwendung von spezifischen Gesprächsführungstechniken usw., rückt immer mehr in den Fokus.
Hinzu kommt der Ökonomisierungsdruck, der immer stärker auf den Trägern
und Institutionen Sozialer Arbeit lastet. Geldgeber erwarten, dass
Beratungsleistungen transparent, effizient und effektiv sind.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung (Ziel und Aufbau der Arbeit)
- A. Allgemeiner Teil
- 2. Einführung ins und Hinführung zum Thema
- 2.1 Begriffsklärung und Standortbestimmung
- 2.2 Geschichte der Beratung und ihrer Methoden
- 3. Ausgewählte Konzeptionen von Beratung
- 3.1 Klientenzentrierte Beratung und Engaging
- 3.2 Systemische Beratung
- 3.3 Ressourcenorientierte Beratung
- 3.4 Life Model of Social Work Practice
- 3.5 Alltagsnahe Konzepte Sozialer Beratung
- 3.5.1 Lebensweltorientierte Soziale Beratung
- 3.5.2 Soziale Beratung für Ratsuchende in prekären Lebenslagen
- B. Spezieller Teil
- 4. Methodische Dimensionen Sozialer Beratung
- 4.1 Klärung des Methodenbegriffs
- 4.2 Möglichkeiten und Grenzen der Methodik Sozialer Beratung als multi-professionellem Handeln
- 5. Feldstudie: Keine eigenständigen Methoden? Zur Beratungspraxis in der Sozialen Arbeit anhand ausgewählter Fallbeispiele
- 5.1 Vorstellung exemplarischer Handlungsfelder in der Sozialen Arbeit und ihrer Konzeptionen
- 5.1.1 Soziale Beratung in der Klinischen Sozialarbeit
- 5.1.2 Arbeitslosenberatung
- 5.1.3 Beratung in der Schulsozialarbeit
- 5.2 Forschungsdesign
- 5.3 Auswertungsteil: Anspruch und Wirklichkeit von Beratung aus verschiedenen Perspektiven
- 5.3.1 Die Sicht der Klienten Sozialer Beratung
- 5.3.2 Die Sicht von professionell Beratenden
- 5.3.3 Die Sicht von Experten
- 5.3.4 Exkurs: Die Sicht von Studierenden der Sozialen Arbeit
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die methodische Fundierung der Sozialen Beratung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen und ökonomischen Drucks. Sie beleuchtet den Anspruch auf eigenständige Methoden der Sozialen Arbeit im Kontext der Beratung und analysiert, inwieweit dieser Anspruch in der Praxis umgesetzt wird.
- Methodenvielfalt und -entwicklung in der Sozialen Beratung
- Eigenständige Methoden der Sozialen Arbeit im Vergleich zu Methoden anderer Disziplinen
- Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf die Soziale Beratung
- Auswirkungen des Ökonomisierungsdrucks auf die Praxis der Sozialen Beratung
- Analyse der Perspektiven verschiedener Akteure (Klienten, Berater, Experten) auf die Beratungspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung (Ziel und Aufbau der Arbeit): Die Einleitung beschreibt den aktuellen Diskurs um Beratungsmethoden in der Sozialen Arbeit, der durch gesellschaftliche Umbrüche (Globalisierung, Ökonomisierung, Individualisierung) verstärkt wird. Sie skizziert den steigenden Beratungsbedarf, sowohl bei Menschen in prekären Situationen als auch bei solchen, die ihr Leben effizienter gestalten wollen. Die Arbeit untersucht die Frage nach eigenständigen Methoden in der Sozialen Beratung und deren Umsetzung in der Praxis, wobei die Positionen von Belardi und Ansen kritisch beleuchtet werden. Das Ziel ist es, den Anspruch auf originäre Beratungskonzeptionen in der Sozialen Arbeit zu untersuchen und die Perspektiven verschiedener Akteure zu analysieren.
2. Einführung ins und Hinführung zum Thema: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Arbeit. Der Begriff der Sozialen Beratung wird geklärt und im Kontext der Sozialen Arbeit verortet. Darüber hinaus wird ein historischer Überblick über die Entwicklung der Beratungsmethoden gegeben, der die Entstehung und die Veränderung verschiedener Ansätze beleuchtet und den aktuellen Stand der Diskussion vorbereitet.
3. Ausgewählte Konzeptionen von Beratung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Beratungsansätze, von klientenzentrierten und systemischen Methoden bis hin zu ressourcenorientierten und alltagsnahen Konzepten. Es wird eine differenzierte Darstellung der jeweiligen theoretischen Grundlagen, Arbeitsweisen und Anwendungsbereiche geliefert. Die Kapitel analysiert die Stärken und Schwächen der einzelnen Ansätze im Kontext Sozialer Arbeit und deren Relevanz für verschiedene Klientengruppen und Handlungsfeld.
4. Methodische Dimensionen Sozialer Beratung: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Klärung des Methodenbegriffs in der Sozialen Beratung. Es beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen verschiedener methodischer Ansätze im multiprofessionellen Kontext der Sozialen Arbeit. Der Fokus liegt auf der Diskussion über eigenständige Methoden der Sozialen Arbeit im Vergleich zu Methoden anderer Disziplinen.
5. Feldstudie: Keine eigenständigen Methoden? Zur Beratungspraxis in der Sozialen Arbeit anhand ausgewählter Fallbeispiele: Diese Kapitel präsentiert eine Feldstudie zur Beratungspraxis. Anhand ausgewählter Fallbeispiele aus verschiedenen Handlungsfeldern (Klinische Sozialarbeit, Arbeitslosenberatung, Schulsozialarbeit) wird die tatsächliche Anwendung von Methoden in der Sozialen Arbeit untersucht und analysiert. Es werden die Perspektiven von Klienten, Beratern und Experten beleuchtet und miteinander verglichen, um ein umfassendes Bild der Beratungsrealität zu zeichnen.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Methodische Fundierung Sozialer Beratung
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die methodische Fundierung Sozialer Beratung unter dem Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen und ökonomischer Zwänge. Im Mittelpunkt steht die Frage nach eigenständigen Methoden der Sozialen Arbeit im Beratungsfeld und deren praktische Umsetzung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen allgemeinen und einen speziellen Teil. Der allgemeine Teil umfasst eine Einleitung, eine Einführung in das Thema Soziale Beratung mit Begriffsklärung und historischem Überblick, sowie eine Darstellung ausgewählter Beratungsansätze. Der spezielle Teil beinhaltet eine Auseinandersetzung mit den methodischen Dimensionen Sozialer Beratung und eine Feldstudie zur Beratungspraxis in verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit.
Welche Beratungsansätze werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Beratungsansätze, darunter klientenzentrierte Beratung, systemische Beratung, ressourcenorientierte Beratung, das Life Model of Social Work Practice und alltagsnahe Konzepte wie lebensweltorientierte Soziale Beratung und Soziale Beratung für Ratsuchende in prekären Lebenslagen.
Was ist das Ziel der Feldstudie?
Die Feldstudie analysiert die Praxis der Sozialen Beratung anhand von Fallbeispielen aus der Klinischen Sozialarbeit, Arbeitslosenberatung und Schulsozialarbeit. Sie untersucht die Perspektiven von Klienten, Beratern und Experten auf die Anwendung von Methoden in der Sozialen Arbeit und vergleicht den Anspruch auf eigenständige Methoden mit der Realität.
Welche Perspektiven werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die Perspektiven verschiedener Akteure, darunter Klienten der Sozialen Beratung, professionell Beratende, Experten und (als Exkurs) Studierende der Sozialen Arbeit. Der Vergleich dieser Perspektiven soll ein umfassendes Bild der Beratungsrealität ermöglichen.
Welche gesellschaftlichen Faktoren werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert den Einfluss von Globalisierung, Ökonomisierung und Individualisierung auf die Soziale Beratung und deren methodische Ausgestaltung. Der ökonomische Druck auf die Praxis der Sozialen Beratung wird besonders beleuchtet.
Welche Forschungsfrage steht im Zentrum der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwieweit werden die Ansprüche auf eigenständige Methoden in der Sozialen Beratung in der Praxis umgesetzt, und wie wirken sich gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen darauf aus?
Welche Methoden werden in der Arbeit eingesetzt?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, die auf einer Feldstudie mit Fallbeispielanalysen und der Einbeziehung verschiedener Perspektiven beruht. Die Auswertung dieser Daten liefert Erkenntnisse über die tatsächliche Anwendung von Methoden in der Sozialen Beratung.
- Arbeit zitieren
- Marret Vögler-Mallok (Autor:in), Mathias Hörtnagel (Autor:in), 2009, "Ich muss immer gucken, wo die Augen von Menschen funkeln", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161805