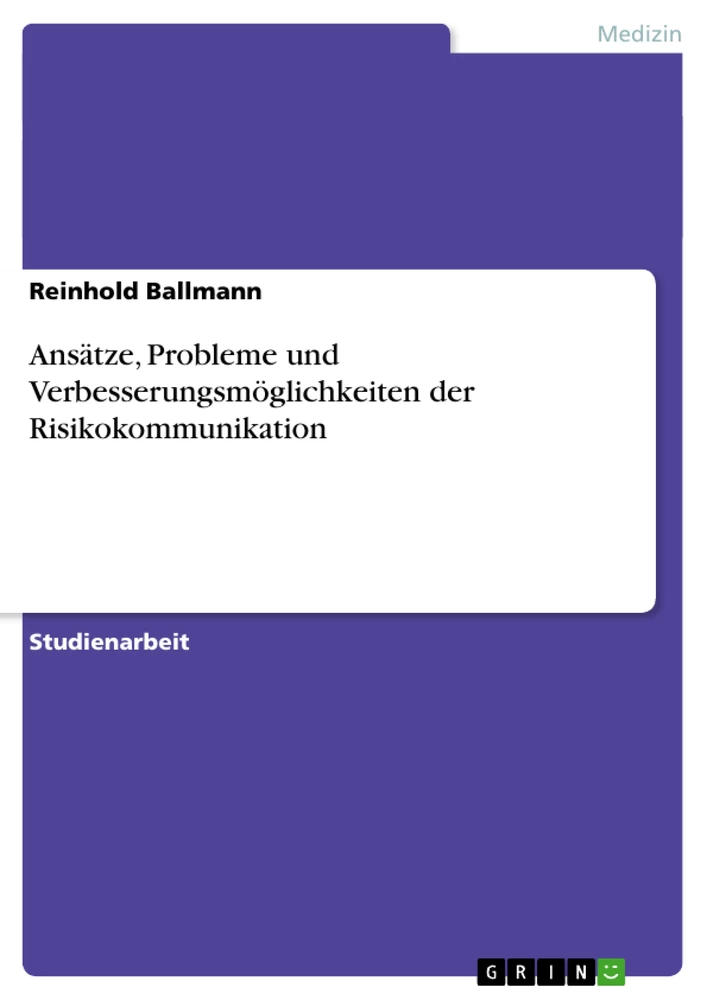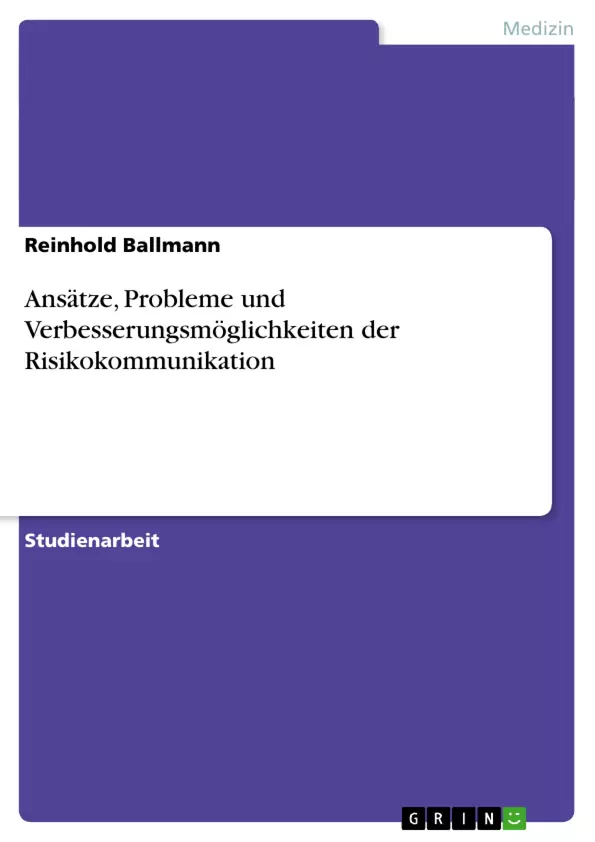wird prinzipiell von Wissenslücken, von Unglücken, von Katastrophen, vom „Schiefgehen“ begleitet.“
(Obermeier (1999) S. 9) Von Risiko lässt sich nur dann sinnvoll sprechen, wenn Einfluss
auf die Ungesichertheit ausgeübt werden kann. Gilt dies nicht, handelt es sich um Bedrohungen
bzw. Gefahren, denen man ausgesetzt ist. Das deutet bereits auf den fundamentalen
Zwiespalt der Risikokommunikation hin: was die einen nur als „Risiko“ ansehen, stellt sich für
die anderen als „reale Gefahr“ dar. Wir unterscheiden zwischen gerichteter Risikokommunikation
und „frei floatender“ Risikokommunikation (Krimsky et al. (1988)). Frei floatende Risikokommunikation
ist eine Grundvariante der Kommunikation moderner Gesellschaften. Sie tritt in unterschiedlicher
Gestalt auf: als Gerücht, Pressebericht, PR-Kampagne oder Unternehmensinformation.
Diese Form der Risikokommunikation hat oft keine spezielle Zielgruppe und stammt aus
verschiedenen Quellen. Im Unterschied dazu bezieht sich gerichtete Risikokommunikation auf
alle Kommunikationsprozesse, die sowohl die Identifikation, Analyse, Bewertung und das Maagement
von Risiken als auch die dafür nötigen Voraussetzungen und Beziehungen zwischen den
daran beteiligten Personen, Gruppen und Institutionen zum Gegenstand haben. Gerichtete Risikokommunikation
ist Teil des Risikomanagements. Sie ist ziel- und zweckbezogen und gemäß dem
National Research Council der USA (NRC (1996)) eine Querschnittsfunktion, die den gesamten
Managementprozess von der Identifikation und Bewertung der Risiken, über die Entscheidung
bis hin zur Risikokontrolle betrifft.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Risikokommunikation und Risikomanagement
- Theorien und Modelle der Kommunikation
- Die Informationstheorie von Claude E. Shannon
- Die Kybernetik von Norbert Wiener
- Die Transaktionstheorie der Kommunikation von Raymond A. Bauer
- Die Axiome der Kommunikation von Paul Watzlawick
- Die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas
- Gerold Ungeheuers anthropologische Kommunikationstheorie
- Die sozialbehavioristische Kommunikationstheorie von George Herbert Mead
- Die selbstreferentielle Kommunikationstheorie von Niklas Luhmann
- Ursachen und Ziele der Risikokommunikation
- Das Gelingen von Risikokommunikation
- Divergenzen bei der Risikobewertung
- Bewertungsdivergenzen zwischen Laien und Experten
- Ein allgemeines Modell von Bewertungsdifferenzen
- Gattungen von Risikokommunikation
- Koordination von Risikodialogen und -diskursen
- Risikoaufklärung
- Ansätze zur Verbesserung der institutionellen Risikokommunikation
- Vorschläge für die Verbesserung der Risikokommunikation
- Strukturelle und institutionelle Verbesserungen
- Organisatorische Verbesserungen
- Forschung und Entwicklung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit „Ansätze, Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten der Risikokommunikation“ analysiert die Herausforderungen der Kommunikation von Risiken in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Sie beleuchtet verschiedene Theorien und Modelle der Kommunikation und untersucht, wie diese zur Klärung von Konflikten und zur effektiven Gestaltung von Risikomanagement beitragen können.
- Divergenzen zwischen Laien und Experten in der Risikobewertung
- Entwicklung von Modellen zur Verbesserung der Risikobewertung
- Ansätze zur Optimierung der Risikokommunikation in institutionellen Kontexten
- Vorschläge für die Verbesserung der Risikokommunikation durch strukturelle, organisatorische und wissenschaftliche Maßnahmen
- Bedeutung der Berücksichtigung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlichen Werten in der Risikokommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Risikokommunikation und ihrem Zusammenhang mit dem Risikomanagement. Es wird die Unterscheidung zwischen gerichteter und frei floatender Risikokommunikation eingeführt und die Bedeutung des National Research Council der USA (NRC) für das Risikomanagement hervorgehoben.
Kapitel zwei beleuchtet verschiedene Theorien und Modelle der Kommunikation, darunter die Informationstheorie von Claude E. Shannon, die Kybernetik von Norbert Wiener, die Transaktionstheorie der Kommunikation von Raymond A. Bauer sowie die Axiome der Kommunikation von Paul Watzlawick. Die Kapitel diskutieren die unterschiedlichen Ansätze dieser Theorien, ihre Stärken und Schwächen sowie ihre Relevanz für die Risikokommunikation.
Kapitel drei konzentriert sich auf die Ursachen und Ziele der Risikokommunikation, wobei die Bedeutung des Verständnisses von Risiken und die Notwendigkeit einer effektiven Kommunikation zwischen Experten und der Öffentlichkeit hervorgehoben werden. Das vierte Kapitel untersucht die Faktoren, die zum Gelingen der Risikokommunikation beitragen, und analysiert die Bedeutung einer transparenten und verständlichen Kommunikation von Risiken.
Das fünfte Kapitel analysiert die Divergenzen bei der Risikobewertung, insbesondere die Unterschiede zwischen Laien und Experten. Es werden Modelle vorgestellt, die zur Überwindung dieser Divergenzen beitragen können, und die Bedeutung der Einbeziehung von Laien in die Risikobewertungsprozess wird hervorgehoben.
Kapitel sechs beschäftigt sich mit den verschiedenen Gattungen der Risikokommunikation, wie z. B. der Koordination von Risikodialogen und -diskursen sowie der Risikoaufklärung. Es werden wichtige Ansätze zur Gestaltung effektiver Kommunikationsformen in unterschiedlichen Kontexten vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Risikokommunikation, das Risikomanagement, Kommunikationstheorien, Bewertungsdivergenzen, Risikodialog, Risikoaufklärung, institutionelle Risikokommunikation und Verbesserungsmöglichkeiten. Die Arbeit beleuchtet wissenschaftliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Werte, die eine wichtige Rolle in der effektiven Risikokommunikation spielen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen gerichteter und frei floatender Risikokommunikation?
Gerichtete Kommunikation ist zielbezogener Teil des Risikomanagements, während frei floatende Kommunikation als Gerücht oder Pressebericht ohne spezifische Zielgruppe auftritt.
Warum bewerten Laien und Experten Risiken unterschiedlich?
Experten stützen sich oft auf statistische Wahrscheinlichkeiten, während Laien Risiken eher subjektiv und emotional (z.B. nach Gefahrenpotenzial) bewerten.
Welche Kommunikationstheorien sind für Risiken relevant?
Theorien von Watzlawick (Axiome), Habermas (kommunikatives Handeln) und Luhmann (Selbstreferenz) bieten wichtige Erklärungsmodelle.
Wie kann institutionelle Risikokommunikation verbessert werden?
Durch strukturelle Verbesserungen, mehr Transparenz und die Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Dialog mit der Öffentlichkeit.
Was ist das Ziel von Risikodialogen?
Ziel ist die Koordination von Diskursen, um Wissenslücken zu schließen und ein gemeinsames Verständnis für den Umgang mit Gefahren zu schaffen.
- Quote paper
- Reinhold Ballmann (Author), 2003, Ansätze, Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten der Risikokommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16186