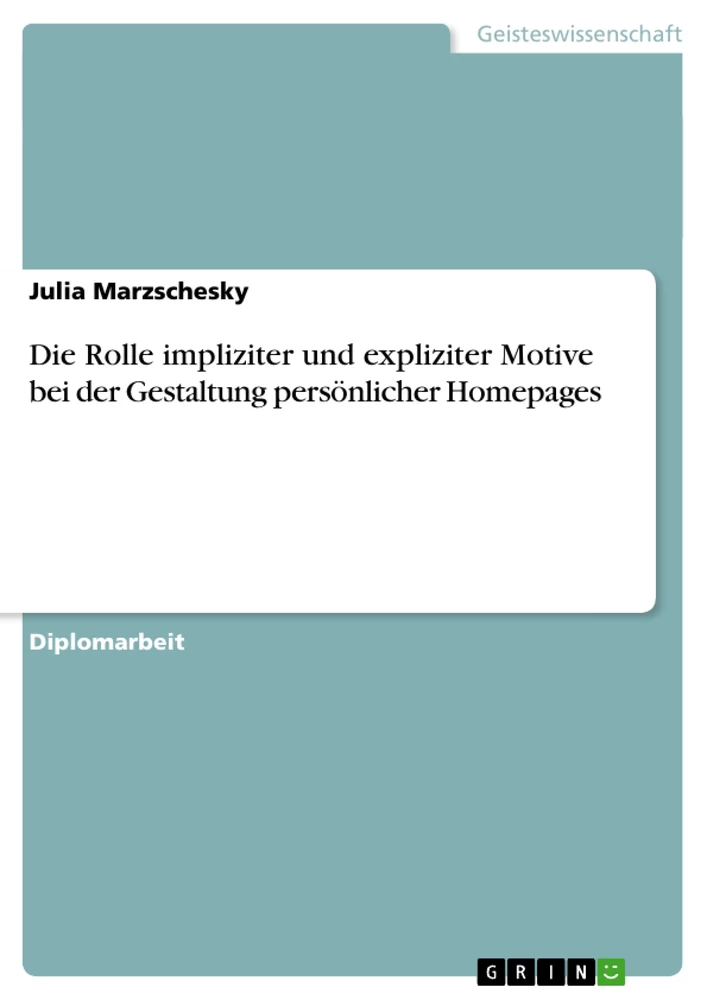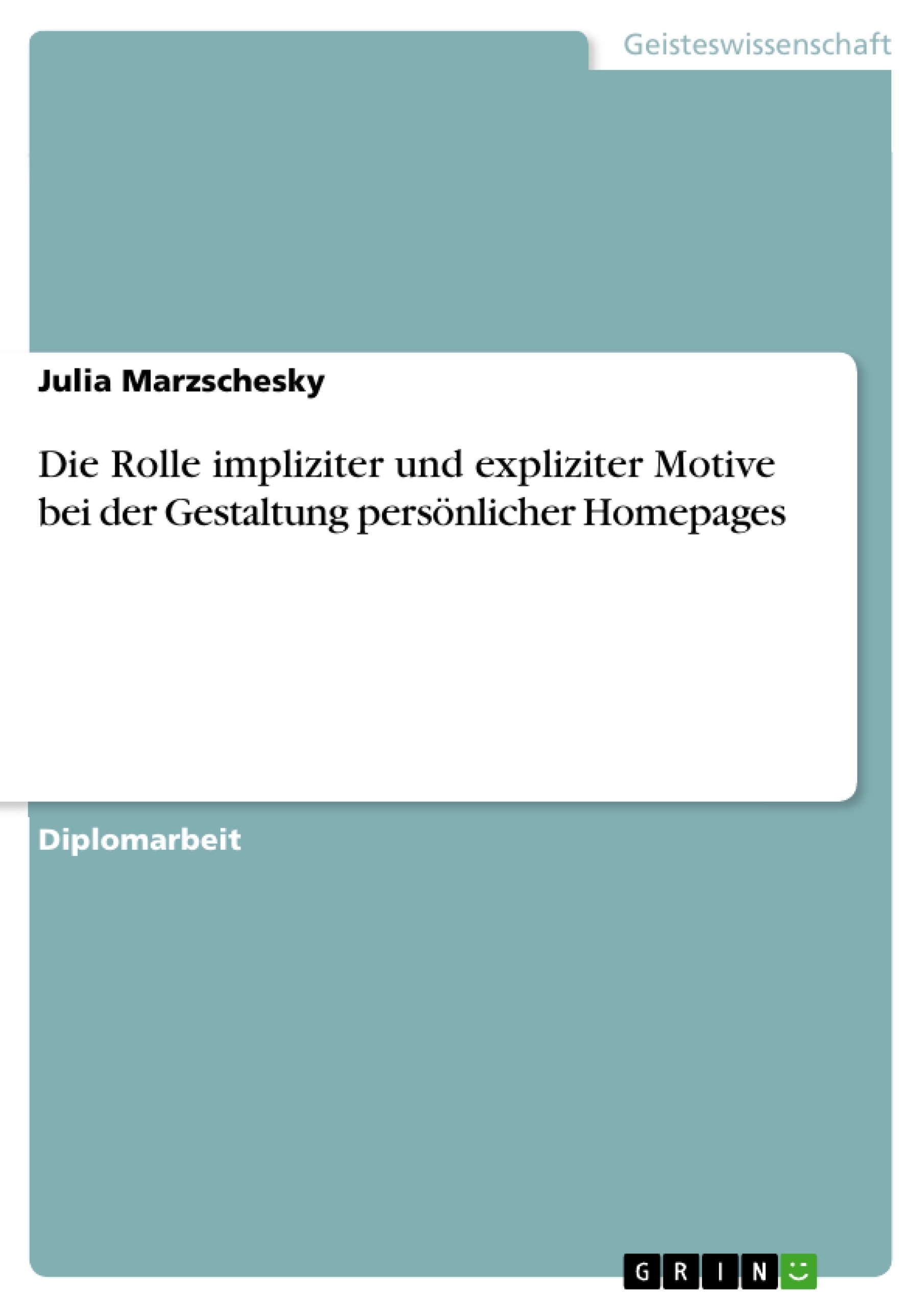Die weiterhin steigende Zahl der, bei der zentralen Registrierungsstelle DENIC eG registrierten Homepages in Deutschland belegt die anhaltende Aktualität des Themas Homepages. Die Motive der Besitzer persönlicher Homepages, der Öffentlichkeit Details aus
ihrem Privat- und Berufsleben zu präsentieren, sind in Anbetracht der Vielzahl unterschiedlicher persönlicher Homepages offensichtlich keineswegs einheitlich. Die bestehende Forschung auf dem Gebiet persönlicher Homepages weist bisher eher explorativen Charakter auf (Schütz, Machilek & Marcus, 2003) und lässt kaum Rückschlüsse auf die tatsächlichen Motive der Homepagebesitzer für ihre persönliche
Homepage zu. McClelland, Koestner und Weinberger postulierten 1989 ein Modell, das von der unabhängigen Koexistenz impliziter und expliziter Motive ausgeht (McClelland, Koestner & Weinberger, 1989). Vor dem Hintergrund der Selbstdarstellungstheorie wird im Rahmen
dieser Arbeit der Frage nachgegangen, inwiefern sich die impliziten und expliziten Motive von Homepagebesitzern bei der Selbstdarstellung auf ihren persönlichen Homepages widerspiegeln. Zudem ergibt sich eine Validitätsfragestellung in Hinblick auf die
Vorhersagekraft motivthematischer Homepageinhalte für Skalen der PRF (Stumpf et al.,1985) und des MMG (Schmalt et al., 1999).
Das explizite Machtmotiv erwies sich als Prädiktor macht- und leistungsmotivthematischer Homepageinhalte. Das implizite Anschlussmotiv steht in negativem Zusammenhang zu leistungsmotivthematischen Homepageinhalten. Rubriken, die sich auf die Selbstdarstellung der eigenen Person, sowie auf bereits bestehende soziale Kontakte beziehen, zeigen besonders große Relevanz für eine persönliche Homepage. Neben dem Erleben von
Kreativität spielen vor allem Gründe für eine persönliche Homepage eine wichtige Rolle, die Bezug zu sozialer Interaktion und Kommunikation haben. Selbstbezogene Motive hingegen scheinen eher in den Hintergrund zu treten. Probanden, die bereits an einer parallel
durchgeführten Untersuchung teilgenommen und in diesem Zusammenhang ebenfalls PRF (Stumpf et al., 1985), MMG (Schmalt et al., 1999) und die Selbstdarstellung auf einer persönlichen Homepage bearbeitet hatten, wiesen sowohl für das implizite Macht- und Anschlussmotiv signifikant niedrigere Werte, als auch tendenziell niedrigere Werte für das Anschlussmotiv in der Selbstdarstellung auf der persönlichen Homepage auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Motive
- 2.1 Zwei Analyseperspektiven: Druck oder Zug
- 2.2 Motivstärke
- 2.3 Motivkomponenten
- 2.4 Primäre und sekundäre Motive
- 2.5 Die klassische Motivtrias: Leistung, Macht und Anschluss
- 2.5.1 Das Leistungsmotiv
- 2.5.2 Das Machtmotiv
- 2.5.3 Das Anschlussmotiv
- 2.6 Implizite versus explizite Motive
- 2.6.1 Implizite Motive
- 2.6.2 Explizite Motive
- 2.6.3 Die Interaktionshypothese
- 2.6.4 Validitätsbereiche impliziter und expliziter Motive
- 2.7 Motivdiagnostik
- 2.7.1 Projektive Verfahren
- 2.7.2 Fragebogenverfahren am Beispiel der Personality Research Form
- 2.7.3 Semiprojektive Verfahren am Beispiel des Multi-Motiv Gitters
- 3. Persönliche Homepages
- 3.1 Definition persönlicher Homepages
- 3.2 Klassifikation persönlicher Homepages
- 3.3 Verbreitung persönlicher Homepages
- 3.4 Inhalte persönlicher Homepages
- 3.5 Motive für persönliche Homepages
- 3.6 Zielgruppen persönlicher Homepages
- 3.7 Selbstdarstellungstheorie
- 4. Ziel der Untersuchung
- 5. Fragestellung und Hypothesen
- 6. Methode
- 6.1 Allgemeine Beschreibung der Untersuchung
- 6.1.1 Untersuchungsinstrumente
- 6.1.2 Untersuchungsmaterialien
- 6.1.3 Umgang mit Störvariablen
- 6.2 Stichprobenbeschreibung
- 6.3 Untersuchungsdesign
- 6.3.1 Prädiktorvariablen
- 6.3.2 Responsevariablen
- 6.3.3 Zusätzliche Variablen
- 6.4 Untersuchungsablauf
- 6.1 Allgemeine Beschreibung der Untersuchung
- 7. Ergebnisse
- 7.1 Interraterübereinstimmungen
- 7.2 Motivthematische Homepageinhalte und Motive der Probanden
- 7.3 Fragebogen „Persönliche Homepages“
- 7.3.1 Gewünschte Rubriken auf persönlichen Homepages
- 7.3.2 Gründe für eine persönliche Homepage
- 7.3.3 Erfahrungen mit persönlichen Homepages
- 7.3.4 Teilnahme an der „Untersuchung zur Wahrnehmung von Persönlichkeitsmerkmalen“
- 8. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die motivationalen Grundlagen der Gestaltung persönlicher Homepages. Sie zielt darauf ab, den Einfluss sowohl expliziter als auch impliziter Motive auf die Gestaltung dieser Webseiten zu erforschen und deren jeweilige Bedeutung zu beleuchten. Die Studie untersucht, ob bewusste, selbstberichteten Motive oder unbewusste, implizite Motive die Gestaltung stärker beeinflussen.
- Die Rolle impliziter und expliziter Motive bei der Homepagegestaltung
- Der Vergleich verschiedener Motivmessungmethoden (projektiv, Fragebogen)
- Die Analyse von Homepageinhalten im Hinblick auf zugrundeliegende Motive
- Die Beziehung zwischen individuellen Motiven und der Selbstdarstellung im Internet
- Empirische Überprüfung der Interaktionshypothese von impliziten und expliziten Motiven im Kontext persönlicher Homepages
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Das Kapitel liefert eine Einführung in die Thematik der persönlichen Homepages im Internet und skizziert den Forschungsstand. Es betont die zunehmende Verbreitung persönlicher Homepages und die bisherige Forschungslücke bezüglich der Rolle impliziter und expliziter Motive bei deren Gestaltung.
2. Motive: Dieses Kapitel gibt einen umfassenden Überblick über die Motivationsforschung. Es werden verschiedene Perspektiven auf Motive (Druck vs. Zug), die Motivstärke, Motivkomponenten und die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Motiven diskutiert. Schwerpunkt ist die klassische Motivtrias (Leistung, Macht, Anschluss), wobei jedes Motiv ausführlich erklärt wird. Der zentrale Teil befasst sich mit dem Unterschied zwischen impliziten und expliziten Motiven, der Interaktionshypothese und den Validitätsbereichen der jeweiligen Messmethoden. Schließlich werden verschiedene Methoden der Motivdiagnostik (projektive, Fragebogen-, semiprojektive Verfahren) vorgestellt und verglichen.
3. Persönliche Homepages: Dieses Kapitel definiert den Begriff der persönlichen Homepage und bietet eine Klassifizierung verschiedener Arten von Homepages. Es beleuchtet die Verbreitung, die Inhalte, die Motive für die Erstellung und die Zielgruppen persönlicher Homepages. Die Selbstdarstellungstheorie wird als theoretischer Rahmen eingeführt, um die Motivationen hinter der Gestaltung zu verstehen.
Schlüsselwörter
Implizite Motive, Explizite Motive, Persönliche Homepages, Motivdiagnostik, Selbstdarstellung, Internet, Interaktionshypothese, Leistung, Macht, Anschluss, Homepagegestaltung, Motivmessung, Projektive Verfahren, Fragebogenverfahren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Motivationalen Grundlagen der Gestaltung persönlicher Homepages
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die motivationalen Grundlagen der Gestaltung persönlicher Homepages. Der Fokus liegt auf dem Einfluss expliziter und impliziter Motive auf die Gestaltung dieser Webseiten und deren jeweilige Bedeutung.
Welche Motive werden betrachtet?
Die Arbeit befasst sich mit der klassischen Motivtrias (Leistung, Macht, Anschluss), unterscheidet zwischen expliziten (bewussten, selbstberichteten) und impliziten (unbewussten) Motiven und analysiert deren Interaktion (Interaktionshypothese).
Welche Methoden der Motivmessung werden verwendet?
Die Arbeit beschreibt und vergleicht verschiedene Methoden der Motivdiagnostik, darunter projektive Verfahren (z.B. TAT), Fragebogenverfahren (z.B. Personality Research Form) und semiprojektive Verfahren (z.B. Multi-Motiv-Gitter).
Wie werden persönliche Homepages in der Arbeit klassifiziert?
Das Kapitel zu persönlichen Homepages bietet eine Klassifizierung verschiedener Arten von Homepages, betrachtet deren Verbreitung, Inhalte, Erstellungsmotive und Zielgruppen.
Welche Rolle spielt die Selbstdarstellungstheorie?
Die Selbstdarstellungstheorie dient als theoretischer Rahmen, um die Motivationen hinter der Gestaltung persönlicher Homepages zu verstehen.
Welche Hypothesen werden untersucht?
Die Arbeit formuliert Hypothesen zum Einfluss expliziter und impliziter Motive auf die Homepagegestaltung und prüft diese empirisch. Ein Schwerpunkt liegt auf der Überprüfung der Interaktionshypothese.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen die Analyse der Übereinstimmung zwischen Ratern, den Zusammenhang zwischen motivthematischen Homepageinhalten und den Motiven der Probanden sowie die Auswertung von Fragebogendaten zu gewünschten Rubriken, Gründen für eine Homepage, Erfahrungen mit Homepages und der Teilnahme an einer Zusatzuntersuchung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Implizite Motive, Explizite Motive, Persönliche Homepages, Motivdiagnostik, Selbstdarstellung, Internet, Interaktionshypothese, Leistung, Macht, Anschluss, Homepagegestaltung, Motivmessung, Projektive Verfahren, Fragebogenverfahren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zu Motiven, persönlichen Homepages, der Zielsetzung, Fragestellungen und Hypothesen, der Methode, den Ergebnissen und der Diskussion. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die Kapitelstruktur.
- Quote paper
- Julia Marzschesky (Author), 2007, Die Rolle impliziter und expliziter Motive bei der Gestaltung persönlicher Homepages, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161879