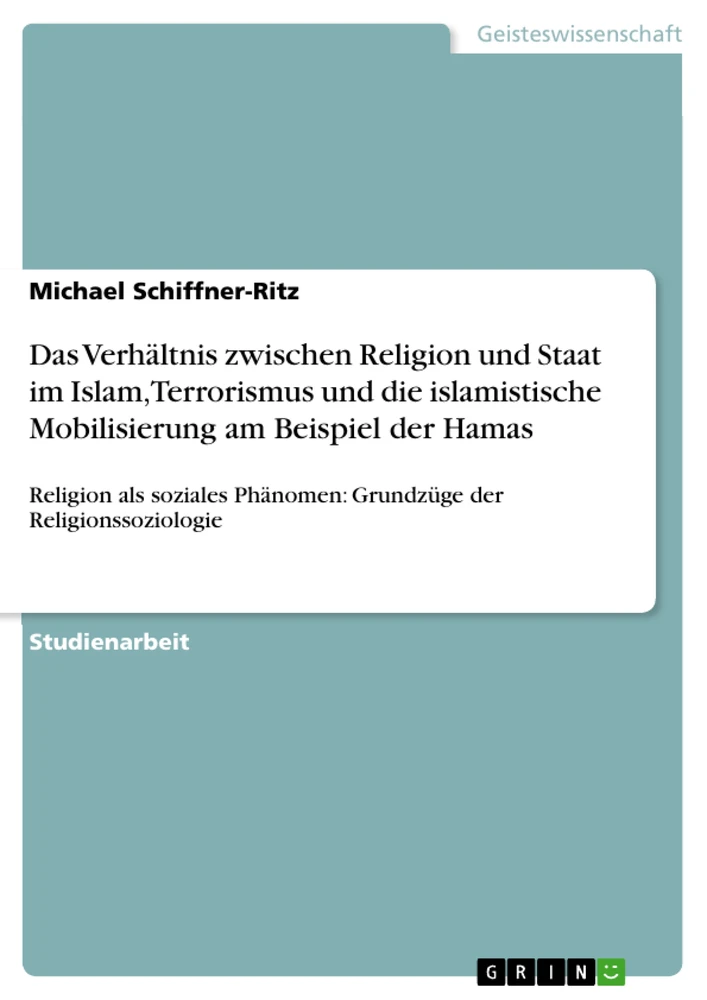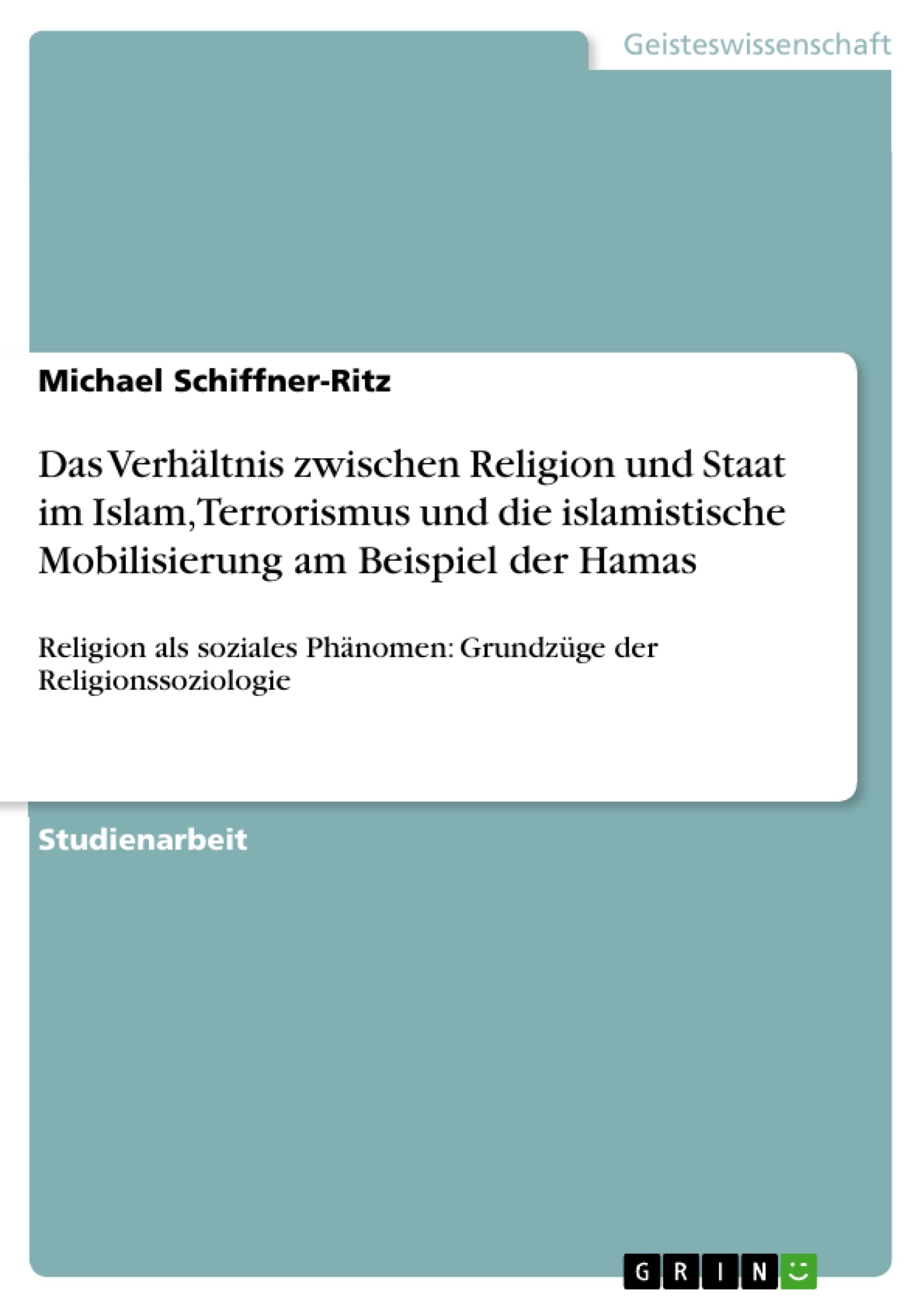Die Globalisierung und die daraus folgende Internationalisierung kultureller, politischer und wirtschaftlicher Beziehungen stellt eine Herausforderung für die unterschiedlichen Kulturkreise dar.
Diskurse in der westlichen Welt wurden in den letzten Jahren häufig von der Auseinandersetzung mit dem Islam bestimmt. Einwanderer muslimischen Glaubens, die Ihren religiösen Pflichten nachkommen, irritieren Menschen, die in einem zwar säkularisierten, aber von christlichen Werten geprägten Umfeld erzogen wurden. Drastischer wird diese Situation, wenn gläubige Muslime offensiv und radikal ihre Vorstellung einer idealen Gesellschaft propagieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Der Staat im Islam, ein islamischer Staat?
- 2.1 Sichtweise des Koran
- 2.2 Die Charta der Hamas
- 3.0 Islamistischer Terrorismus am Beispiel der Hamas
- 3.1 Die Organisation
- 3.2 Gründungsgeschichte
- 3.3 Motive des islamistischen Terrorismus
- 3.3.1 Psychologie und Religion
- 3.3.2 Globalisierung und Deprivation
- 3.3.3 Gesamtgesellschaftliche Prozesse
- 4.0 Son of Hamas. Die Hamas aus der Einzelperspektive.
- 5.0 Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Verhältnis zwischen Religion und Staat im Islam, insbesondere im Kontext des islamistischen Terrorismus und der Mobilisierung durch die Hamas. Die Arbeit analysiert die islamische Sichtweise des Staates, untersucht die Rolle des Korans und der Hamas-Charta, und beleuchtet die Motive hinter islamistischem Terrorismus unter verschiedenen Aspekten.
- Der islamische Staatsbegriff und seine Interpretationen
- Die Rolle des Korans in der Definition des Staates
- Motive des islamistischen Terrorismus (psychologische, sozioökonomische, gesellschaftliche Faktoren)
- Die Hamas als Beispiel für islamistische Mobilisierung
- Die individuelle Perspektive innerhalb der Hamas
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Kontext der Arbeit vor dem Hintergrund des „Karikaturenstreits“ von 2005/2006. Der Konflikt wird als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Verhältnis von Religion und Staat im Islam und der Mobilisierungspotenz des Islamismus genutzt. Die Arbeit fokussiert sich auf die Hamas als Fallbeispiel und betont die Herausforderung, als Muslim und Verfechter der Aufklärung, dieses Thema zu bearbeiten.
2.0 Der Staat im Islam- ein islamischer Staat?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Konzeption des Staates aus islamischer Perspektive. Es beginnt mit der Darstellung gängiger, oft negativer, westlicher Vorstellungen von „Islamstaaten“ und relativiert diese durch eine differenzierte Betrachtung. Der Autor erklärt den Unterschied zwischen „Islamstaaten“, wo die Scharia angewendet wird, und „islamischen Staaten“, wo die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch ist, die Verfassung aber nicht zwingend auf dem Islam basiert. Die Bedeutung einer klaren Unterscheidung zwischen Islamisten und säkularen Muslimen wird hervorgehoben.
3.0 Islamistischer Terrorismus am Beispiel der Hamas: Dieses Kapitel analysiert den islamistischen Terrorismus, insbesondere die Hamas. Es beschreibt die Organisation, ihre Gründungsgeschichte und die vielschichtigen Motive des Terrorismus. Die Analyse betrachtet psychologische und religiöse Faktoren, die Rolle von Globalisierung und Deprivation sowie gesamtgesellschaftliche Prozesse. Es ist eine umfassende Untersuchung der Ursachen und Hintergründe des Terrors.
4.0 Son of Hamas. Die Hamas aus der Einzelperspektive.: Dieses Kapitel dürfte sich mit individuellen Erfahrungen und Perspektiven von Menschen innerhalb der Hamas beschäftigen. Es bietet einen Einblick in die menschliche Seite des Konflikts und kann kontrastierende Ansichten und Motivationen präsentieren, im Gegensatz zur Gesamtbetrachtung der vorhergehenden Kapitel. Dies ermöglicht es, das Thema aus einer anderen Perspektive zu betrachten und das Verständnis des Phänomens zu vertiefen.
Schlüsselwörter
Islam, Staat, Islamismus, Terrorismus, Hamas, Koran, Scharia, Globalisierung, Deprivation, Religionssoziologie, Mobilisierung, Säkularisierung, Karikaturenstreit, Umma.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Der Staat im Islam und der Islamistische Terrorismus am Beispiel der Hamas"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das komplexe Verhältnis zwischen Religion und Staat im Islam, insbesondere im Kontext des islamistischen Terrorismus und der Mobilisierung durch die Hamas. Sie analysiert die islamische Sichtweise des Staates, die Rolle des Korans und der Hamas-Charta und beleuchtet die Motive hinter islamistischem Terrorismus aus verschiedenen Perspektiven.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem islamischen Staatsbegriff und seinen Interpretationen, der Rolle des Korans in der Definition des Staates, den Motiven des islamistischen Terrorismus (psychologische, sozioökonomische und gesellschaftliche Faktoren), der Hamas als Beispiel für islamistische Mobilisierung und der individuellen Perspektive innerhalb der Hamas.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum islamischen Staatsbegriff, ein Kapitel zum islamistischen Terrorismus am Beispiel der Hamas, ein Kapitel über die individuelle Perspektive innerhalb der Hamas ("Son of Hamas") und abschließende Schlussbetrachtungen. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten.
Wie wird der islamische Staatsbegriff dargestellt?
Die Arbeit differenziert zwischen „Islamstaaten“, wo die Scharia angewendet wird, und „islamischen Staaten“, wo die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch ist, die Verfassung aber nicht zwingend auf dem Islam basiert. Sie betont die Bedeutung einer klaren Unterscheidung zwischen Islamisten und säkularen Muslimen und relativiert gängige, oft negative westliche Vorstellungen von „Islamstaaten“.
Welche Aspekte des islamistischen Terrorismus werden analysiert?
Das Kapitel zum islamistischen Terrorismus analysiert die Hamas als Fallbeispiel und betrachtet die vielschichtigen Motive des Terrorismus. Die Analyse umfasst psychologische und religiöse Faktoren, die Rolle von Globalisierung und Deprivation sowie gesamtgesellschaftliche Prozesse.
Was ist das Besondere am Kapitel "Son of Hamas"?
Dieses Kapitel bietet einen Einblick in die individuelle Perspektive von Menschen innerhalb der Hamas. Es präsentiert kontrastierende Ansichten und Motivationen und ermöglicht ein vertieftes Verständnis des Phänomens jenseits der Gesamtbetrachtung der vorhergehenden Kapitel.
Welche Rolle spielt der Koran in der Arbeit?
Der Koran spielt eine wichtige Rolle als zentrale Schrift des Islam und wird im Kontext der Interpretation des islamischen Staatsbegriffes und der Motive des islamistischen Terrorismus analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Islam, Staat, Islamismus, Terrorismus, Hamas, Koran, Scharia, Globalisierung, Deprivation, Religionssoziologie, Mobilisierung, Säkularisierung, Karikaturenstreit, Umma.
Welchen Kontext bietet die Einleitung?
Die Einleitung situiert die Arbeit vor dem Hintergrund des „Karikaturenstreits“ von 2005/2006 und nutzt diesen Konflikt als Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Religion und Staat im Islam und der Mobilisierungspotenz des Islamismus.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im Kapitel "Schlussbetrachtungen" präsentiert und fassen die zentralen Ergebnisse der Analyse zusammen.
- Arbeit zitieren
- Michael Schiffner-Ritz (Autor:in), 2010, Das Verhältnis zwischen Religion und Staat im Islam, Terrorismus und die islamistische Mobilisierung am Beispiel der Hamas, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161953