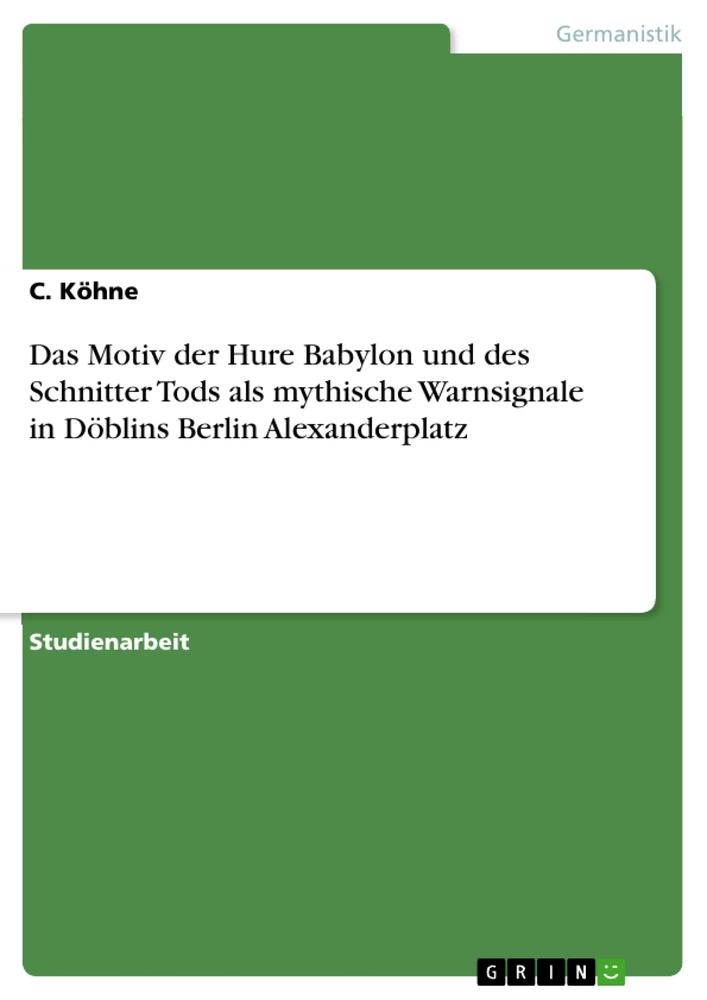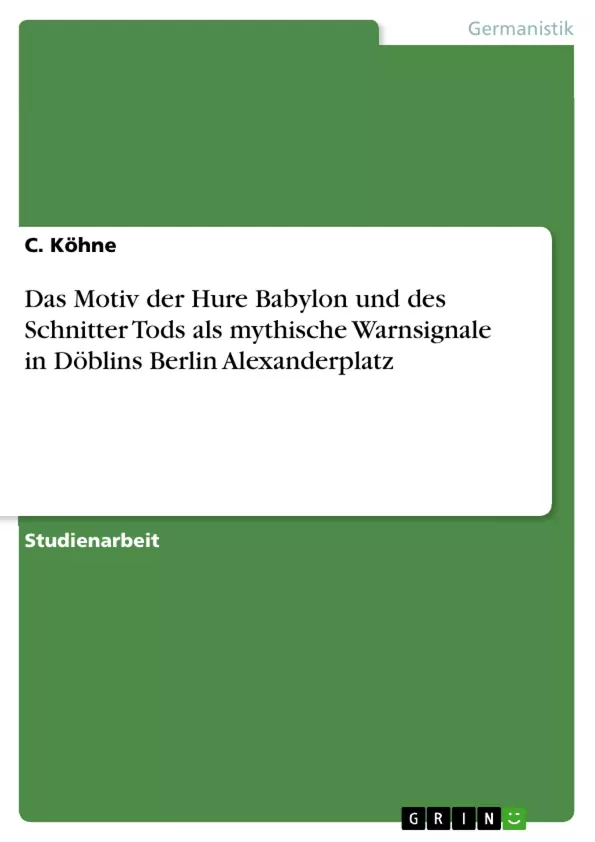Mit der Einbettung des Mythischen in seinem Roman hat sich vor allem Barbara Becker-Cantarino in ihrem Aufsatz „Die Hure Babylon – Zur Mythisierung von Gewalt in Döblins Berlin Alexanderplatz“ beschäftigt. Unter anderem widmeten sich diesem Ansatz Sang-Nam Park, Helmut Becker und Helmut Kiesel, aber mit weniger Ausführlichkeit. Aufgrund der Seltenheit, mit der dieses Thema Titel einer Arbeit wird, erkennt man, dass dieser Aspekt des Romans von den anderen Untersuchungspunkten, vor allem der Montagetechnik Döblins, in den Hintergrund gedrängt wurde. Gerade deshalb ist es interessant oder sogar verpflichtend, mehr über Döblins mythische Absicht in Erfahrung zu bringen.
In Döblins Berlin Alexanderplatz werden zum Einen die Hure Babylon und zum Anderen der Schnitter Tod zu den mythischen Akteuren gezählt. „Die große Hure Babylon und der Tod sind zwei symbolische Gestalten, die mehrmals an verschiedenen Stellen des Romans auftauchen.“3 Diese Textstellen sollen hier in dieser Arbeit als Grundstock für die nachfolgenden Interpretationsansätze dienen. Als erstes wird auf das Motiv der Hure Babylon eingegangen, da es wesentlich weitläufiger dargestellt wird, als das des Schnitter Tods. Nicht immer muss sie durch ein und dieselbe Person verkörpert werden. Die wissenschaftlichen Ansätze bieten ein breites Spektrum der Personifikation durch die Hure, über Frauen, die als Nebenfiguren eher eine nicht relevante Rolle spielen, bis hin zur Großstadt Berlin, die ihre Einwohner verführen soll. Die ansteigende Verstädterung verbindet in sich die rasante Technisierung und die immer weitere Entfernung von den eigenen Wurzeln, der Natur, zu einem gefährlichen Bollwerk.
Der Schnitter Tod kommt in der Sehweise der Hauptperson Franz Biberkopf zum Einen nur als Stimme und zum Anderen als identifizierte Person zu seinem Auftritt. Ob auch er von Döblin eine warnende Aufgabe erhalten hat, soll auf den letzten Seiten versucht werden zu klären.
Mittelpunkt dieser Ausarbeitung wird also die Frage sein, ob Alfred Döblin durch die gezielte Einsetzung dieser mythischen Figuren eine bestimmte Absicht hegte. Es soll untersucht werden, inwiefern er seine Leser oder auch die Bewohner der Großstädte mit Hilfe der beiden Gegenspieler eine, in Rätsel gefasste, Warnung aussprechen wollte.
1 STAUFFACHER, Werner (Hg.): Internationale Alfred-Döblin-Kolloquien, Münster 1989. S.235.
2 vgl. ebd. S.234.
3 BERNSHEIMER, Helmut: Lektüreschlüssel. Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz, Stuttgart 2002.S. 24.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Motiv der Hure Babylon
- Unter welchen Umständen und in welcher Form tritt das Motiv auf?
- Die Beziehung zwischen Babylon und Berlin
- Die Mythisierung als Antwort auf die ungebremste Technisierung in den 1920ern
- Der Schnitter Tod
- Wann kommt die Todesgestalt zum Einsatz?
- Der Tod als „Aufklärer“
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die mythischen Komponenten in Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz, insbesondere die Rolle der Hure Babylon und des Schnitter Tods. Ziel ist es, Döblins Intention hinter der Einbettung dieser mythischen Figuren zu ergründen und zu analysieren, inwiefern er eine Warnung an seine Leser formulieren wollte.
- Die mythische Ebene in Döblins Berlin Alexanderplatz
- Die Funktion der Hure Babylon als Leitmotiv und ihre verschiedenen Manifestationen
- Der Schnitter Tod als Gegenspieler und seine warnenden Aspekte
- Die Verbindung zwischen Mythisierung und der rasanten Technisierung der 1920er Jahre
- Döblins Absicht hinter der Verwendung mythischer Figuren zur Gesellschaftskritik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die vernachlässigte mythische Komponente in der bisherigen Rezeption von Döblins Berlin Alexanderplatz. Sie führt die zentrale Fragestellung ein: Welche Absicht verfolgte Döblin mit der Integration mythischer Figuren wie der Hure Babylon und dem Schnitter Tod? Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse dieser Figuren und deren Funktion innerhalb des Romans als mögliche Warnung vor den Gefahren der Großstadt und des Sittenverfalls. Der Fokus liegt auf der Interpretation der mythischen Elemente und deren Bedeutung für das Verständnis des Romans.
Das Motiv der Hure Babylon: Dieses Kapitel analysiert das Motiv der Hure Babylon aus der Offenbarung des Johannes im Kontext von Döblins Werk. Es wird untersucht, wie dieses Motiv im Roman dargestellt wird, welche Rolle es im Leben von Franz Biberkopf spielt und wie es die Gewalt und den Sittenverfall der Großstadt Berlin symbolisiert. Die verschiedenen Interpretationen der Personifikation der Hure Babylon, von konkreten Frauenfiguren bis hin zur Stadt selbst, werden diskutiert. Der Fokus liegt auf der Wirkung des Motivs auf die Handlung und die Entwicklung von Biberkopf.
Der Schnitter Tod: Dieser Abschnitt beleuchtet die Figur des Schnitter Tods in Berlin Alexanderplatz. Im Gegensatz zur ausführlicher dargestellten Hure Babylon wird hier die spärlichere Darstellung der Todesfigur untersucht. Die Arbeit analysiert, wann und in welcher Form der Tod in der Perspektive Franz Biberkopfs auftritt (als Stimme oder als identifizierte Person) und ob auch er als warnendes Element in Döblins Roman fungiert. Die Analyse konzentriert sich auf die Rolle des Todes im Kontext der Handlung und Biberkopfs innerem Kampf.
Schlüsselwörter
Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, Mythisierung, Hure Babylon, Schnitter Tod, Gewalt, Großstadt, Technisierung, Sittenverfall, Gesellschaftskritik, Warnung, Symbolismus.
Häufig gestellte Fragen zu Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" - Mythische Komponenten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert die mythischen Komponenten in Alfred Döblins Roman "Berlin Alexanderplatz", insbesondere die Rolle der "Hure Babylon" und des "Schnitter Tod". Der Fokus liegt auf der Interpretation dieser Figuren und ihrer Funktion als mögliche Warnung vor den Gefahren der Großstadt und des Sittenverfalls der 1920er Jahre.
Welche Themen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht die mythische Ebene in Döblins Werk, die Funktion der "Hure Babylon" als Leitmotiv und ihre verschiedenen Manifestationen, den "Schnitter Tod" als Gegenspieler und seine warnenden Aspekte, die Verbindung zwischen Mythisierung und der rasanten Technisierung der 1920er Jahre sowie Döblins Absicht hinter der Verwendung mythischer Figuren zur Gesellschaftskritik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Motiv der "Hure Babylon", ein Kapitel zum "Schnitter Tod" und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung betont die bisher vernachlässigte mythische Komponente in der Rezeption des Romans und stellt die zentrale Forschungsfrage nach Döblins Intention bei der Integration mythischer Figuren. Die Kapitel analysieren detailliert die jeweiligen Motive und deren Funktion innerhalb des Romans.
Wie wird das Motiv der "Hure Babylon" behandelt?
Das Kapitel zum Motiv der "Hure Babylon" analysiert die Darstellung dieses Motivs aus der Offenbarung des Johannes im Kontext von Döblins Werk. Es untersucht die Rolle der "Hure Babylon" im Leben von Franz Biberkopf und wie sie Gewalt und Sittenverfall der Großstadt symbolisiert. Verschiedene Interpretationen der Personifikation – von konkreten Frauenfiguren bis hin zur Stadt selbst – werden diskutiert.
Wie wird die Figur des "Schnitter Tod" dargestellt?
Der Abschnitt zum "Schnitter Tod" beleuchtet die spärlichere Darstellung dieser Figur im Vergleich zur "Hure Babylon". Analysiert wird, wann und in welcher Form der Tod in Franz Biberkopfs Perspektive auftritt und ob er ebenfalls als warnendes Element in Döblins Roman fungiert. Der Fokus liegt auf der Rolle des Todes im Kontext der Handlung und Biberkopfs innerem Kampf.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und diskutiert die Bedeutung der mythischen Elemente für das Verständnis von Döblins "Berlin Alexanderplatz". Es wird beleuchtet, inwiefern Döblin durch die Integration mythischer Figuren eine Warnung vor den Gefahren der modernen Großstadt und des Sittenverfalls formulieren wollte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, Mythisierung, Hure Babylon, Schnitter Tod, Gewalt, Großstadt, Technisierung, Sittenverfall, Gesellschaftskritik, Warnung, Symbolismus.
- Citation du texte
- C. Köhne (Auteur), 2007, Das Motiv der Hure Babylon und des Schnitter Tods als mythische Warnsignale in Döblins Berlin Alexanderplatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162002