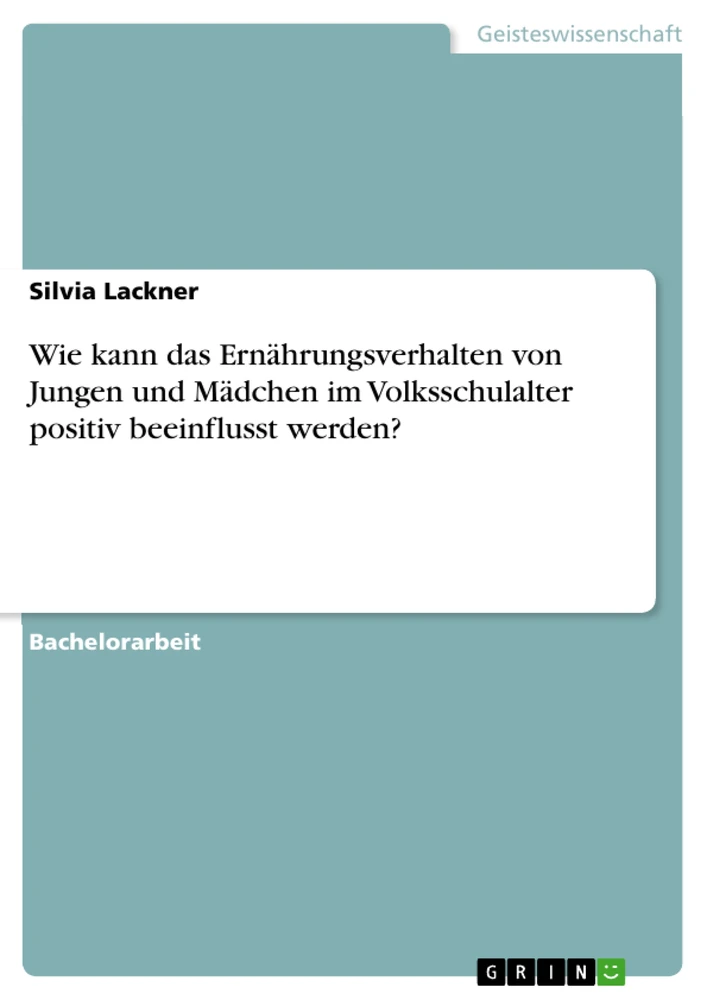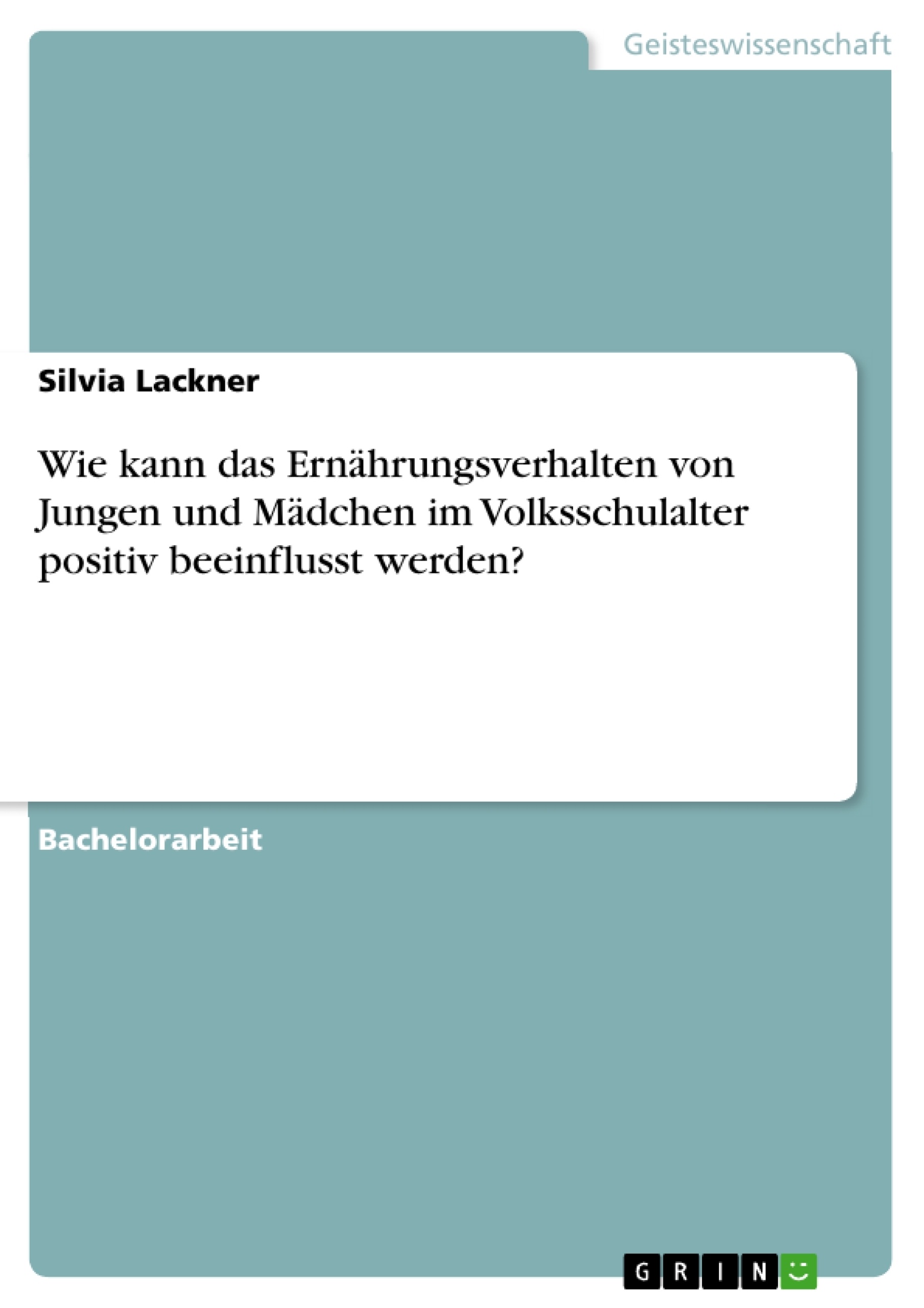Ein Blick in ein Klassenzimmer einer österreichischen Volksschule verrät es: jedes 4. bis 5. Kind leidet bereits in jungen Jahren an einer massiven Essstörung. Wird dann noch der Blick in das Innere einer Jausenbox eines der Kinder gestattet, wird schnell klar, woher das Zuviel auf den Rippen kommen könnte. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, wie es sein kann, dass trotz der ständigen Medienpräsenz des Themas „gesunde Ernährung“ das Übergewicht (Adipositas) sogar bei den Kleinen ein so großes Problem darstellt. Welche Faktoren beeinflussen das Ernährungsverhalten bzw. welche Faktoren müssen berücksichtigt werden, um eine tatsächliche Verhaltensänderung in Bereich der gesunden Ernährung herbei zu führen? Ein Praxisleitfaden am Ende der Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen, um die Komplexität des Themas nochmals zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Forschungsfrage
- Aufbau und Recherche / Methode
- Aufbau der Arbeit
- Begrifflichkeiten
- Sex / Gender / Gender Mainstreaming
- Doing gender beim Essverhalten
- Essen vs. Ernährung
- Gesunde Ernährung
- Ernährungsbedingte Krankheiten
- Adipositas
- Psychosoziale Folgen von Adipositas
- Risikofaktoren für Adipositas
- BMI (Body-Mass-Index)
- Prävention
- Grundlegende Annahmen und Konstrukte
- Entwicklung der Geschlechtsidentität
- Erklärungsansätze für die Entwicklung der Geschlechtsidentität
- Entwicklung des Essverhalten
- Pränatale Prägung
- Postnatale Prägung
- Mere Exposure Effekt
- Spezifisch-sensorische Sättigung
- Essen und Emotionen: Geschlechtsunterschiede
- Kognitive Steuerung
- Gesundheitspsychologische Theorien und Ernährungsverhalten
- Health Belief Model (Einstellungsmodell)
- Sozialkognitive Theorie von Bandura
- Ernährung der Vorbilder: Männer und Frauen in Österreich
- Ist-Situation Ernährung Jungen und Mädchen in Österreich
- Therapiekonzepte für adipöse Jungen und Mädchen
- Ernährungsmanagement
- Sport und Bewegung für Jungen und Mädchen
- Verhaltenstherapeutische Ansätze für Jungen und Mädchen
- Ernährungserziehung / Ernährungswissen
- Adipositas Prävention im Kindesalter: Settingbezogene Maßnahmen
- Schulbasierte Prävention der Adipositas
- Ansatzpunkt Sportunterricht
- Ansatzpunkt Ernährung in der Schule
- Ansatzpunkt Familie bzw. Eltern und Schule
- Schluss / Fazit
- Praxisleitfaden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Herausforderungen des Ernährungsverhaltens bei Jungen und Mädchen im Volksschulalter und erörtert Möglichkeiten zur positiven Beeinflussung. Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Essgewohnheiten mit dem Ziel, ein langfristiges Wohlbefinden zu fördern.
- Die Entwicklung der Geschlechtsidentität und ihre Auswirkungen auf das Essverhalten.
- Einflüsse und Herausforderungen im Bereich der Ernährungserziehung.
- Präventionsmaßnahmen im schulischen Umfeld zur Vermeidung von Adipositas.
- Therapeutische Ansätze zur Behandlung von Übergewicht bei Kindern.
- Die Bedeutung von geschlechtsspezifischen Bedürfnissen und Rollenerwartungen im Kontext von Ernährungsverhalten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und Forschungsfrage vor und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Die verschiedenen Kapitel erörtern relevante Begrifflichkeiten und grundlegende Annahmen, die das Ernährungsverhalten von Kindern beeinflussen. Dabei werden sowohl biologische und psychologische Aspekte als auch gesellschaftliche Einflüsse beleuchtet. Weiterhin werden Therapiekonzepte für adipöse Jungen und Mädchen vorgestellt und Präventionsmaßnahmen im schulischen Kontext diskutiert. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Praxisleitfaden, der wichtige Punkte für die positive Beeinflussung des Ernährungsverhaltens zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf das Ernährungsverhalten von Kindern im Volksschulalter, insbesondere im Hinblick auf die Prävention von Adipositas. Zentrale Begriffe sind: Geschlechtsidentität, Esskultur, gesunde Ernährung, Ernährungsbedingte Krankheiten, Prävention, Schulbasierte Interventionen, Verhaltenstherapie, Gender Mainstreaming, Body-Mass-Index (BMI), Health Belief Model und Sozialkognitive Theorie.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst das Geschlecht das Ernährungsverhalten von Kindern?
Die Arbeit untersucht das „Doing Gender“ beim Essen und wie Geschlechtsidentität sowie Rollenerwartungen das Essverhalten von Jungen und Mädchen im Volksschulalter prägen.
Was ist der Mere-Exposure-Effekt im Kontext der Ernährung?
Dieser Effekt beschreibt, wie die wiederholte Darbietung bestimmter Lebensmittel die Akzeptanz und Vorlieben bei Kindern positiv beeinflussen kann.
Welche Rolle spielt die Schule bei der Adipositas-Prävention?
Die Arbeit zeigt schulbasierte Maßnahmen auf, wie die Gestaltung des Sportunterrichts, das Angebot gesunder Ernährung in der Schule und die Einbindung der Eltern.
Was sind psychosoziale Folgen von Adipositas bei Kindern?
Neben körperlichen Krankheiten werden psychosoziale Belastungen wie Stigmatisierung und ein geringeres Selbstwertgefühl als wesentliche Folgen von Übergewicht thematisiert.
Welche gesundheitspsychologischen Theorien werden herangezogen?
Die Arbeit nutzt das Health Belief Model (Einstellungsmodell) und die Sozialkognitive Theorie von Bandura, um Verhaltensänderungen im Bereich Ernährung zu erklären.
- Quote paper
- Silvia Lackner (Author), 2010, Wie kann das Ernährungsverhalten von Jungen und Mädchen im Volksschulalter positiv beeinflusst werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162005