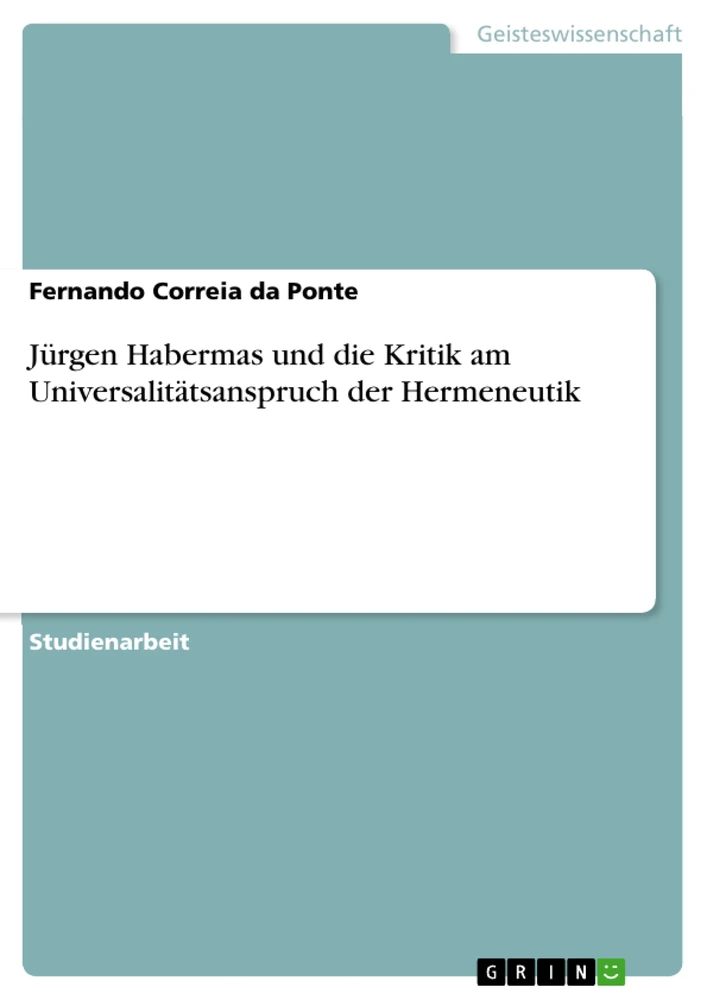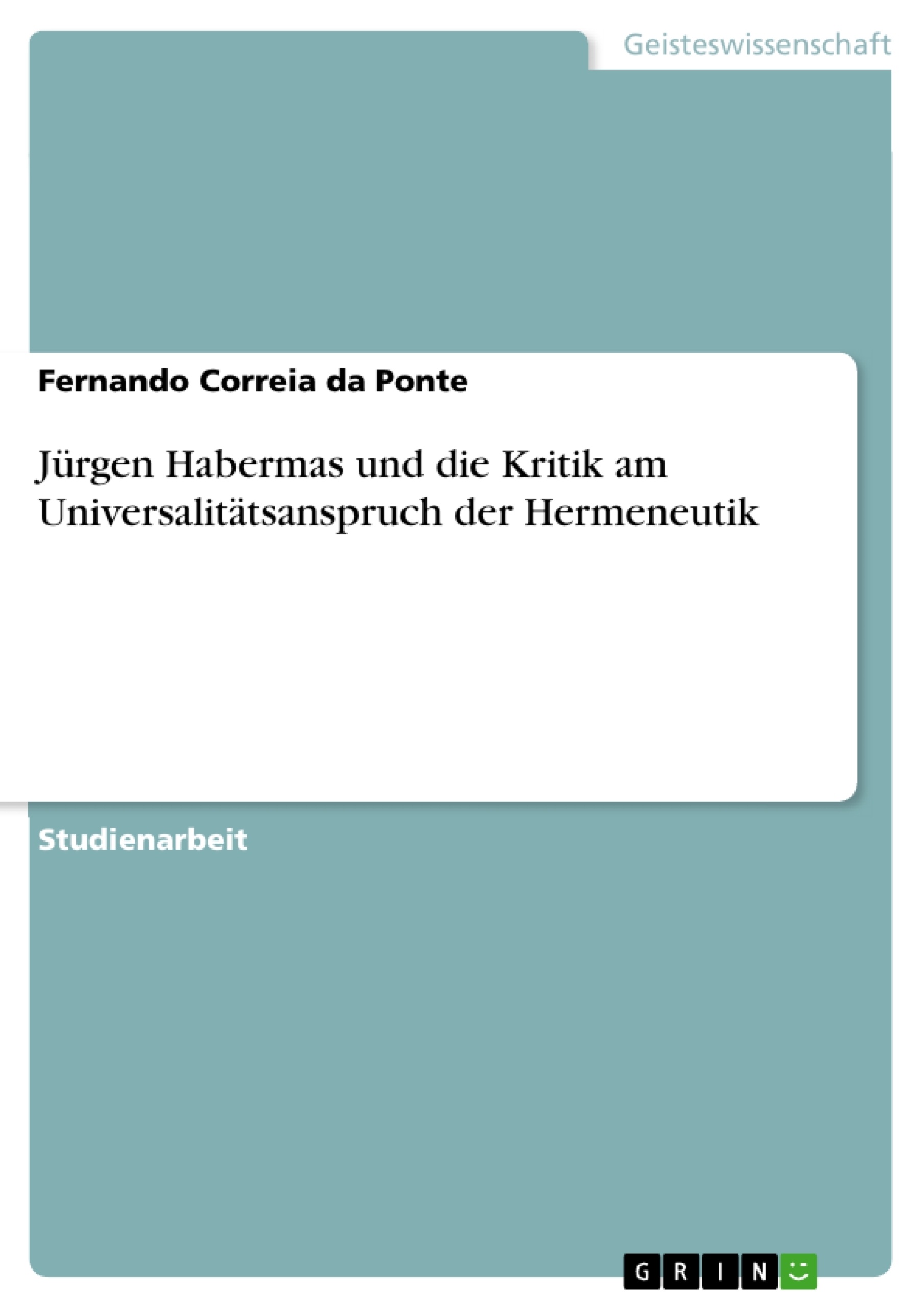Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik.
Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik, den Hans Georg Gadamer in seinem Hauptwerk Methode und Wahrheit (1960) erhebt, steht bei Jürgen Habermas unter Kritik. Eine Methode, die diesen Anspruch erhebt, ist für einen Denker der kritischen Theorie wie Habermas stets suspekt.
In dieser Arbeit soll es darum gehen, die Argumente gegen Gadamer herauszuarbeiten und die Antworten Gadamers auf die Habermasche Kritik hin zu prüfen. Ausgehend vom Aufsatz Zur Logik der Sozialwissenschaft – Zu Gadamers 'Wahrheit und Methode'(1967) und Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik (1970), soll in Ansätzen die Brücke geschlagen werden zu Erkenntnis und Interesse. In den Aufsätzen Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik und Replik (1971) finden sich Gadamers Antworten wieder. Der Fokus liegt auf der Kritik von Habermas und und bezieht Gadamers Repliken mit ein.
Inhaltsverzeichnis
- Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik.
- Gadamers Universalitätsanspruch der Hermeneutik.
- Habermas über Gadamer: Autorität und Tradition.
- Entgegnung Gadamers.
- Habermas Antwort.
- Das Habermasche Bezugssystem.
- Habermas: Erkenntnis und Interesse.
- Gadamer: Sprache, Autorität und Erkenntnis.
- Die Ohrfeigen. ......
- Zusammenfassung..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Kritik von Jürgen Habermas am Universalitätsanspruch der Hermeneutik, wie er von Hans Georg Gadamer vertreten wird. Sie untersucht die Argumente Habermas' und die Gegenargumente von Gadamer, um die Debatte zwischen diesen beiden Denkern zu beleuchten.
- Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik
- Die Kritik Habermas' am Universalitätsanspruch
- Die Rolle von Sprache, Autorität und Tradition in der Hermeneutik
- Die Bedeutung von Erkenntnis und Interesse in der Theorie der Gesellschaft
- Die Verbindung zwischen Hermeneutik und Ideologiekritik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt den Universalitätsanspruch der Hermeneutik, der auf der Annahme basiert, dass Verstehen keine Grenzen hat. Gadamer argumentiert, dass Sprache die Grundlage für jegliches Verstehen ist und somit unbegrenzte Möglichkeiten bietet. In diesem Zusammenhang wird die Rolle von Tradition und Autorität diskutiert, die für Gadamer eng miteinander verknüpft sind.
Im zweiten Kapitel stellt Habermas seine Kritik an Gadamers Universalitätsanspruch dar. Er argumentiert, dass die Hermeneutik eine Gefahr für die kritische Theorie darstellt, da sie den Anspruch erhebt, alle Bereiche des Lebens verstehen zu können. Habermas betont stattdessen die Bedeutung von Erkenntnis und Interesse als Grundlage für die Analyse der Gesellschaft.
Im dritten Kapitel wird die Gegenargumentation von Gadamer vorgestellt. Er verteidigt seinen Universalitätsanspruch und setzt sich mit den Kritikpunkten von Habermas auseinander.
Schlüsselwörter
Hermeneutik, Universalitätsanspruch, Hans Georg Gadamer, Jürgen Habermas, Sprache, Autorität, Tradition, Erkenntnis, Interesse, Ideologiekritik, Theorie der Gesellschaft, Sozialtechnologie, Systemtheorie.
- Quote paper
- Fernando Correia da Ponte (Author), 2006, Jürgen Habermas und die Kritik am Universalitätsanspruch der Hermeneutik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162023