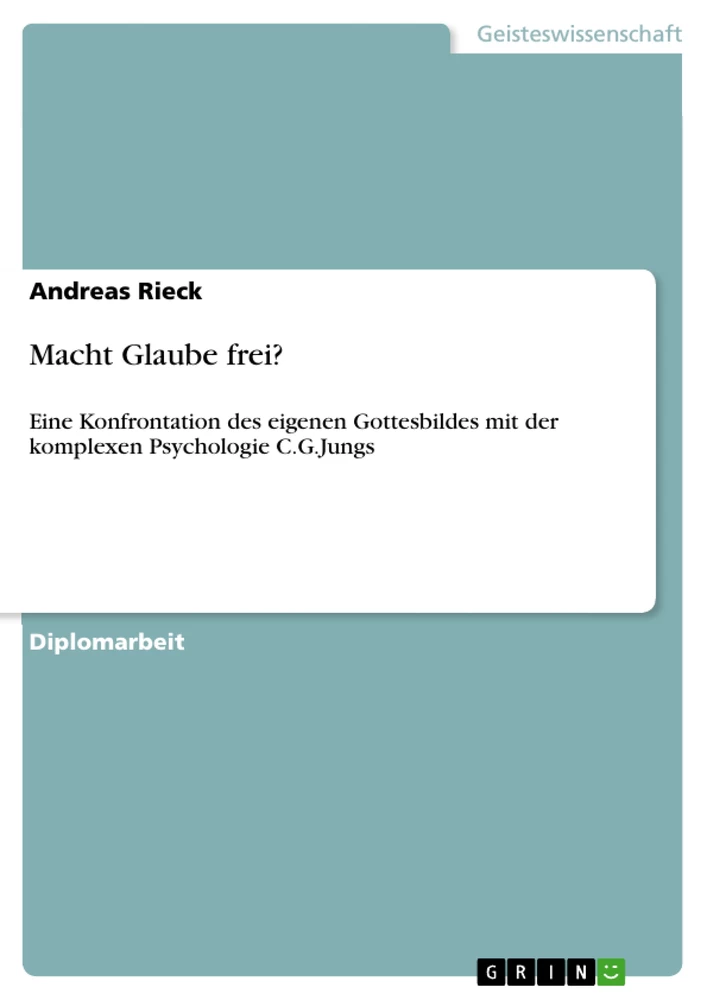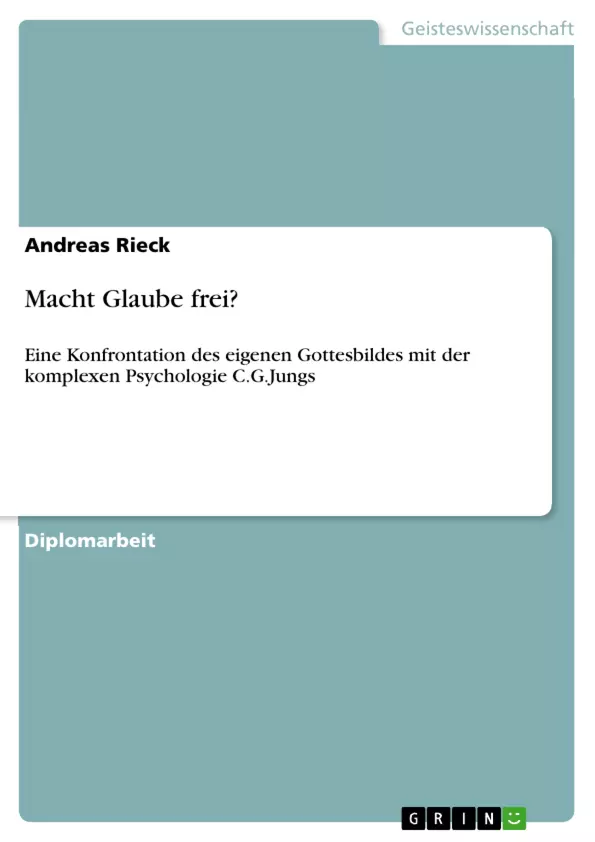„Was bringt`s?“ – so lautet die Frage, an der sich gegenwärtig der Wert einer Sache oder Handlung messen lassen muss. ‚Effizienz’ ist das große Stichwort, das alle Lebensbereiche durchdringt und an der sich letztendlich auch der Wert des Einzelnen misst. Wir alle haben diese Maxime mehr oder weniger internalisiert und ergeben uns der Illusion, eines Tages vollkommen den Ansprüchen zu genügen!
Und Gott? Welche Rolle spielt Gott in diesem Kampf? Befreit er uns aus dem Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Haben unsere Schwächen und unser Scheitern wenigstens in unserer Beziehung zu ihm Berechtigung? Bei vielen – so scheint es – ist dem nicht so. Im Gegenteil: Viele Christen tragen ein Gottesbild in sich, das sie in ihrer Lebensfreude zusätzlich einschränkt. Sie befinden sich in der ausweglosen Situation, es nicht nur ihrem Umfeld, sondern auch ihrem Gott recht machen zu müssen und dabei zu erfahren, dass sie an ihren Idealen immer wieder scheitern. Die Bibel lesen sie als eine Ansammlung von Anforderungen, Geboten und Verboten. Insgeheim kann es sein, dass sie erkennen, dass dieser Weg nicht in die Weite und in das von Jesus verheißene „Leben in Fülle“ führt. Die – oft unbewusste – Angst vor der Strafe Gottes und vor dem Misslingen ihres Lebens hält sie jedoch davor ab, den Kurs zu ändern und gegen die Stimme des inneren Anklägers zu handeln. Die Konsequenz ist, dass sie von diesem Gott loskommen wollen, es aber nicht schaffen, weil die Furcht vor seiner ‚gerechten’ Strafe zu groß ist. Dadurch verstärken sich die Schuldgefühle, die einhergehen mit dem Bewusstsein, diesen Gott nicht zu ‚lieben’ und deshalb zusätzlich versagt zu haben.
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie - ausgehend von C.G. Jung und seiner Lehre der Individuation - ein „Leben in Fülle“ zu erreichen ist. Den Weg der ganzheitlichen Selbstwerdung mit möglichen Hindernissen auf demselben werden in vorliegender Arbeit untersucht und dargelegt. Das Anliegen dieser Arbeit ist dabei ein grundlegend theologisches: es geht um die Frage nach gelingendem Leben – einem „Leben in Fülle“.
Im ersten, psychoanalytischen Teil, wird C. G. Jungs Theorie der Individuation beleuchtet.
Im zweiten Teil erfolgt eine Konkretisierung der vorangegangenen Ausführungen. Aus Sicht der Entwicklungs- und Pastoralpsychologie wird die Frage der Entstehung (dämonsicher) Gottesbilder und deren unbewusster Auswirkung auf die Selbstwerdung beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I. C. G. Jungs Theorie der Individuation: Der Weg vom Ich zum Selbst.
- Die Individuation
- Der Prozess des Bewusstwerdens
- Der Schatten
- Inhalt und Entstehung
- Der Umgang mit dem persönlichen Schatten
- Annahme des Schattens
- Verdrängung und Projektion
- Gelingende Auseinandersetzung: Persönlichkeitsentfaltung hin zur Ganzheit
- Die Bedeutung des Symbols
- Jung und Freud
- Das symbolische Leben
- Das Böse
- Die quantitative psychische Wertigkeit und qualitative Wertung des Bösen
- Die Dimension des, vorläufigen Bösen'
- Das Gesetz der Enantiodromie
- Das Verständnis von Schuld in der Psychoanalyse
- Der Sündenfall: Eintritt in die Welt der Unterscheidung
- Der Exodus und das Dilemma
- Das Motiv der felix culpa
- Das Schuldgefühl
- Die Entwicklung der Moral
- Ziel der Individuation: Selbstbegegnung und Gottesbegegnung
- Teil II. Der Einfluss dämonischer Gottesbilder auf die Individuation.
- C. G. Jungs Kritik an der christlichen Kultur
- Die Entstehung von Gottesbildern
- Die pränatale Phase
- Die frühkindliche Zeit
- Die Phase des Urvertrauens oder: „Ich bin, was man mir gibt.“
- Phase der Autonomie oder: „Ich bin, was ich will.“
- Die Phase der Initiative gegen Schuldgefühle oder: „Ich bin, was ich mir zu werden vorstellen kann.“
- Die Hintergründe widersprüchlicher Gottesbilder
- Die Auswirkungen der Schlüsselposition und des Schlüsselwortes auf das Gottesbild
- Die Schlüsselposition
- Das Schlüsselwort
- Der Weg der Auseinandersetzung mit dem eigenen Schlüsselwort
- Mögliche Gründe für unterlassene Aufarbeitung
- Dämonische Gottesbilder
- Was heißt, dämonisch'?
- Die dämonischen Gottesbilder im Einzelnen
- Der, strafende Richtergott'
- Der Willkürgott
- Der strenge und allmächtige Vatergott
- Der dämonische Todes-Gott
- Der Buchhalter- und Gesetzesgott
- Der Leistungsgott
- Schlussfolgerungen
- Der Gott Jesu Christi
- Der Einstieg Gottes in die menschliche Krisengeschichte
- Ein Beispiel für heilsame Gottesbilder des Neuen Testaments: Der barmherzige ,mütterliche' Vater
- Henri J. M. Nouwen: „Du bist der geliebte Mensch“
- Teil III. Fazit: Worauf es ankommt
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die komplexen Theorien von C. G. Jung zur Individuation die eigene Gottesvorstellung beeinflussen können. Es geht darum, die Beziehung zwischen innerer Seelenentwicklung und dem Gottesbild zu beleuchten und die Auswirkungen eines möglicherweise dämonischen Gottesbildes auf den Prozess der Individuation zu analysieren. Die Arbeit verfolgt das Ziel, den Leser zum eigenen Gottesbild zu befragen und zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Spiritualität anzuregen.
- Individuation und Selbstverwirklichung nach C. G. Jung
- Der Schatten und die Bedeutung des Unbewussten
- Die Entstehung und der Einfluss von Gottesbildern
- Dämonische Gottesbilder und ihre Auswirkungen auf die Seelenentwicklung
- Die Bedeutung eines heilsamen Gottesbildes für die Lebensfreude und die Entfaltung des Einzelnen
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I. C. G. Jungs Theorie der Individuation: Der Weg vom Ich zum Selbst.
Dieses Kapitel führt in die komplexen Theorien von Carl Gustav Jung zur Individuation ein und beleuchtet die zentralen Konzepte der Jung'schen Psychologie. Es werden die Phasen des Bewusstwerdens, die Bedeutung des Schattens und die Rolle des Symbols für die Entwicklung des Individuums analysiert. Der Umgang mit dem persönlichen Schatten und die Bedeutung seiner Integration in die Persönlichkeit werden ausführlich behandelt. Es werden verschiedene Aspekte des Bösen und dessen Einfluss auf die Seelenentwicklung untersucht, wobei insbesondere die Dimension des „vorläufigen Bösen“ und das Gesetz der Enantiodromie beleuchtet werden.
Teil II. Der Einfluss dämonischer Gottesbilder auf die Individuation.
In diesem Teil wird die Frage erörtert, wie die Gottesbilder des Einzelnen aus der frühen Kindheit geprägt werden und welche Auswirkungen dies auf die spätere Individuation hat. Die Entstehung von Gottesbildern in den verschiedenen Entwicklungsphasen des Kindes wird analysiert und auf die pränatale Phase sowie auf die frühkindlichen Erfahrungen mit dem Elternbild eingegangen. Es wird untersucht, wie die Schlüsselposition und das Schlüsselwort in der frühen Entwicklung das Gottesbild prägen und welche Auswirkungen dies auf die Individuation haben kann. Besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse dämonischer Gottesbilder und ihrer Auswirkungen auf die Seelenentwicklung. Es werden verschiedene Typen dämonischer Gottesbilder vorgestellt und deren Auswirkungen auf die Lebensfreude und die Entfaltung des Individuums erörtert. Die Frage nach der Bedeutung eines heilsamen Gottesbildes für die Lebensfreude und die Entfaltung des Einzelnen wird gestellt.
Schlüsselwörter
Individuation, C.G. Jung, Gottesbild, Schatten, Unbewusstes, Archetypen, Dämon, Heilsames Gottesbild, Seelenentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Lebensfreude, Entfaltung, Symbol, Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht C.G. Jung unter Individuation?
Individuation ist der Prozess der Selbstwerdung, bei dem ein Mensch zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit reift, indem er unbewusste Anteile (wie den Schatten) integriert.
Wie beeinflussen Gottesbilder die psychische Entwicklung?
Dämonische oder strafende Gottesbilder können Ängste und Schuldgefühle verstärken und den Weg zur individuellen Freiheit und Lebensfreude blockieren.
Was ist der "Schatten" in der Analytischen Psychologie?
Der Schatten umfasst alle Persönlichkeitsanteile, die das Ich nicht wahrhaben möchte oder die gesellschaftlich verpönt sind. Ihre Integration ist für die Ganzheit essenziell.
Welche Rolle spielt die Kindheit bei der Entstehung von Gottesbildern?
Frühe Erfahrungen mit Bezugspersonen prägen oft unbewusst das Bild von Gott (z.B. Gott als strenger Vater), was später aufgearbeitet werden muss.
Was ist ein "heilsames Gottesbild"?
Ein heilsames Gottesbild, wie das des barmherzigen Vaters im Neuen Testament, fördert das Selbstvertrauen und unterstützt den Menschen in seiner Entfaltung.
- Arbeit zitieren
- Andreas Rieck (Autor:in), 2006, Macht Glaube frei?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162030