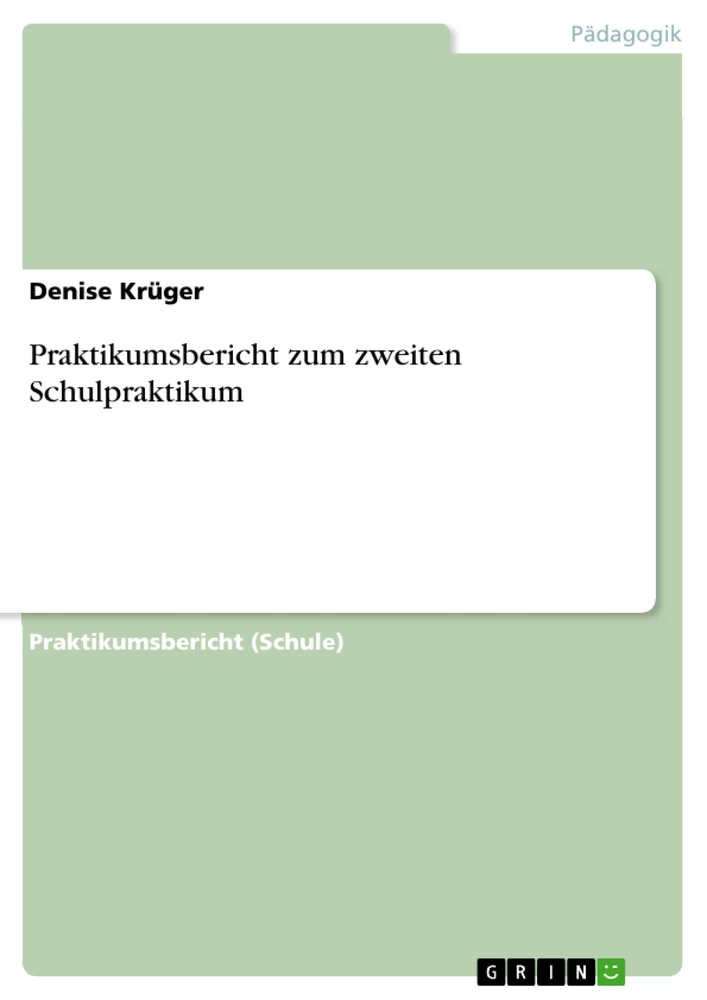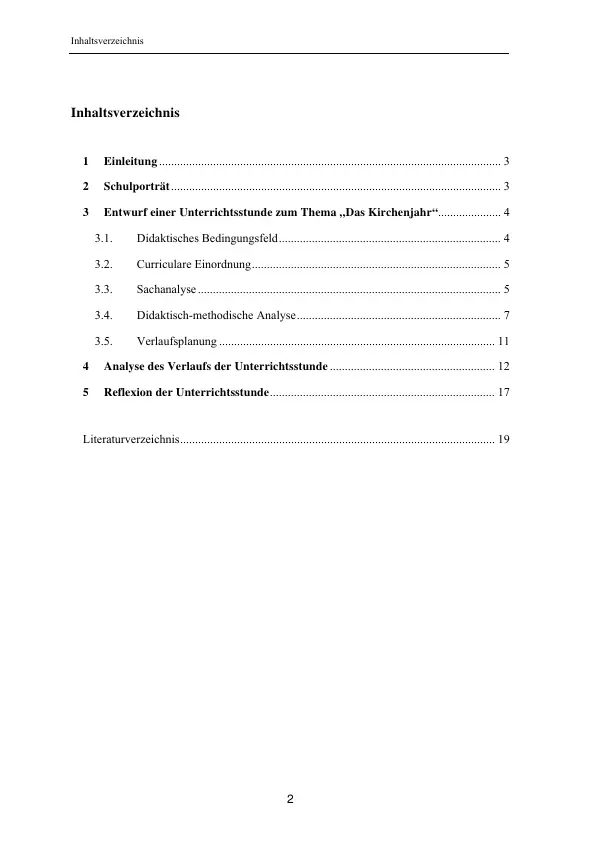Im Rahmen meines zweiten universitären Schulpraktikums hatte ich die Gelegenheit, vier erfahrungsreiche und gewinnbringende Wochen an der staatlichen Grundschule XXXX zu verbringen. In diesem Zeitraum habe ich in den Fächern Mathematik, Deutsch und Re-ligion in allen vier Schuljahrgängen und bei verschiedenen Lehrkräften hospitiert und mich insbesondere auch im eigenen Unterrichten versucht. Für die Dokumentation und Reflexion meiner Unterrichtstätigkeit in dem vorliegenden Praktikumsbeleg habe ich eine Unterrichtsstunde zum Thema „Das Kirchenjahr“ ausgewählt, die ich am 03.09.2010 im Religi-onsunterricht erteilt habe. Meine Wahl begründet sich vor allem darin, dass ich selbst in der Praxis meines Drittfach noch die meisten Unsicherheiten und Schwächen meinerseits sehe. Ehe ich im Folgenden meinen Entwurf der Unterrichtsstunde darstellen werde, möchte ich zunächst in einem kurzen Porträt einen Eindruck von meiner Praktikumsschule vermitteln. In einem dritten Teil werde ich mich dann der Analyse einer konkreten Szene des unterrichtlichen Verlaufs widmen und schließlich eine Reflexion auf Grundlage wissen-schaftlicher Literatur vornehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schulporträt
- Entwurf einer Unterrichtsstunde zum Thema „Das Kirchenjahr“
- Didaktisches Bedingungsfeld
- Curriculare Einordnung
- Sachanalyse
- Didaktisch-methodische Analyse
- Verlaufsplanung
- Analyse des Verlaufs der Unterrichtsstunde
- Reflexion der Unterrichtsstunde
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde zum Thema „Das Kirchenjahr“ im Rahmen eines universitären Schulpraktikums.
- Didaktische Analyse einer Unterrichtsstunde zum Thema „Das Kirchenjahr“
- Einordnung der Unterrichtsstunde in den curricularen Rahmen
- Darstellung der didaktischen Bedingungen und methodischen Überlegungen
- Reflexion der Unterrichtseinheit unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Literatur
- Einblick in das Schulporträt der Praktikumsschule
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text führt in die Thematik der Unterrichtsstunde „Das Kirchenjahr“ ein und stellt den Kontext des universitären Schulpraktikums dar.
- Schulporträt: Dieser Abschnitt bietet einen Einblick in die Praktikumsschule, ihre Strukturen und Besonderheiten.
- Didaktisches Bedingungsfeld: Hier werden die Voraussetzungen der Unterrichtsstunde, wie Lerngruppenzusammensetzung und räumliche Bedingungen, beschrieben.
- Curriculare Einordnung: Der Abschnitt erläutert die Einordnung der Unterrichtsstunde in den Fachlehrplan und die relevanten Kompetenzen.
- Sachanalyse: Dieser Abschnitt beleuchtet das Kirchenjahr als ein komplexes System von Feiern und Traditionen. Er definiert das Kirchenjahr und erläutert seine Struktur und Besonderheiten.
Schlüsselwörter
Der Text konzentriert sich auf die didaktische Analyse und Reflexion einer Unterrichtsstunde zum Thema „Das Kirchenjahr“. Die zentralen Themenbereiche sind das Kirchenjahr, die Planung und Durchführung von Religionsunterricht, die Einordnung der Unterrichtsstunde in den curricularen Rahmen, die didaktischen Bedingungen und methodischen Überlegungen sowie die Reflexion der Unterrichtseinheit unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Literatur. Der Text beinhaltet auch eine Beschreibung der Praktikumsschule, ihrer Strukturen und Besonderheiten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der beschriebenen Unterrichtsstunde?
Die Unterrichtsstunde befasst sich mit dem Thema „Das Kirchenjahr“ im Rahmen des Religionsunterrichts einer Grundschule.
Was umfasst die Sachanalyse zum Kirchenjahr?
Sie definiert das Kirchenjahr als System von christlichen Feiern und Traditionen und erläutert dessen Struktur (z. B. Advent, Weihnachten, Ostern, Pfingsten).
Was gehört zum didaktischen Bedingungsfeld?
Dazu zählen die Zusammensetzung der Lerngruppe, die räumlichen Bedingungen in der Schule sowie die individuellen Voraussetzungen der Schüler.
Warum ist die Reflexion einer Unterrichtsstunde wichtig?
Die Reflexion ermöglicht es, den Verlauf kritisch anhand wissenschaftlicher Literatur zu prüfen und eigene Stärken und Schwächen in der Lehrpraxis zu identifizieren.
Wie wird eine Unterrichtsstunde curricular eingeordnet?
Dabei wird geprüft, welche Anforderungen des Fachlehrplans erfüllt werden und welche Kompetenzen die Schüler durch das Thema erwerben sollen.
- Citar trabajo
- Denise Krüger (Autor), 2010, Praktikumsbericht zum zweiten Schulpraktikum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162048