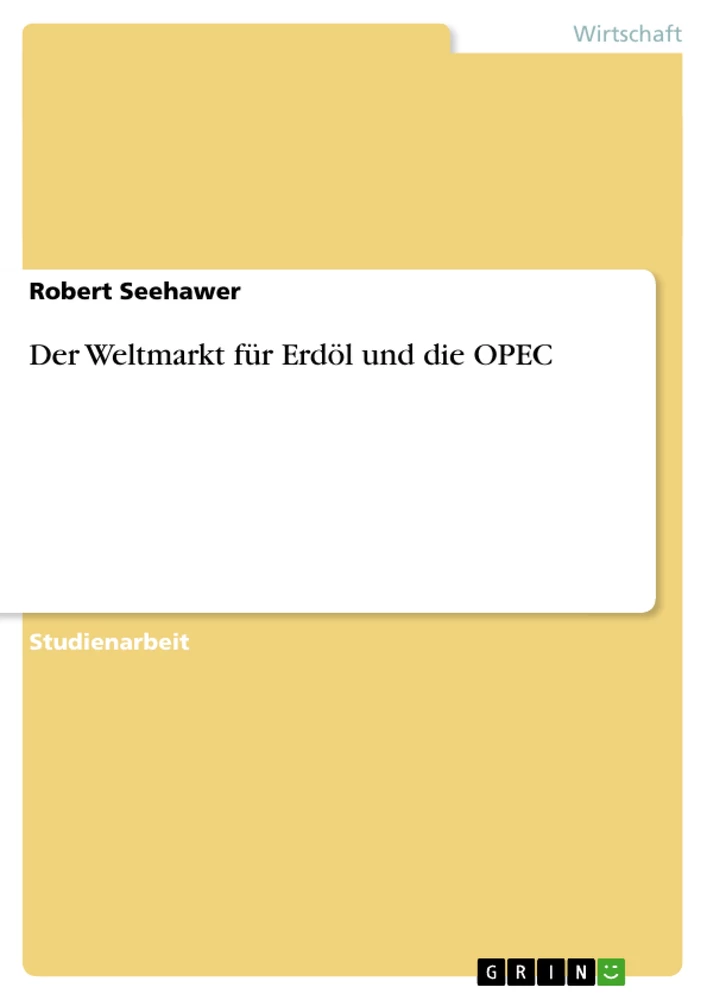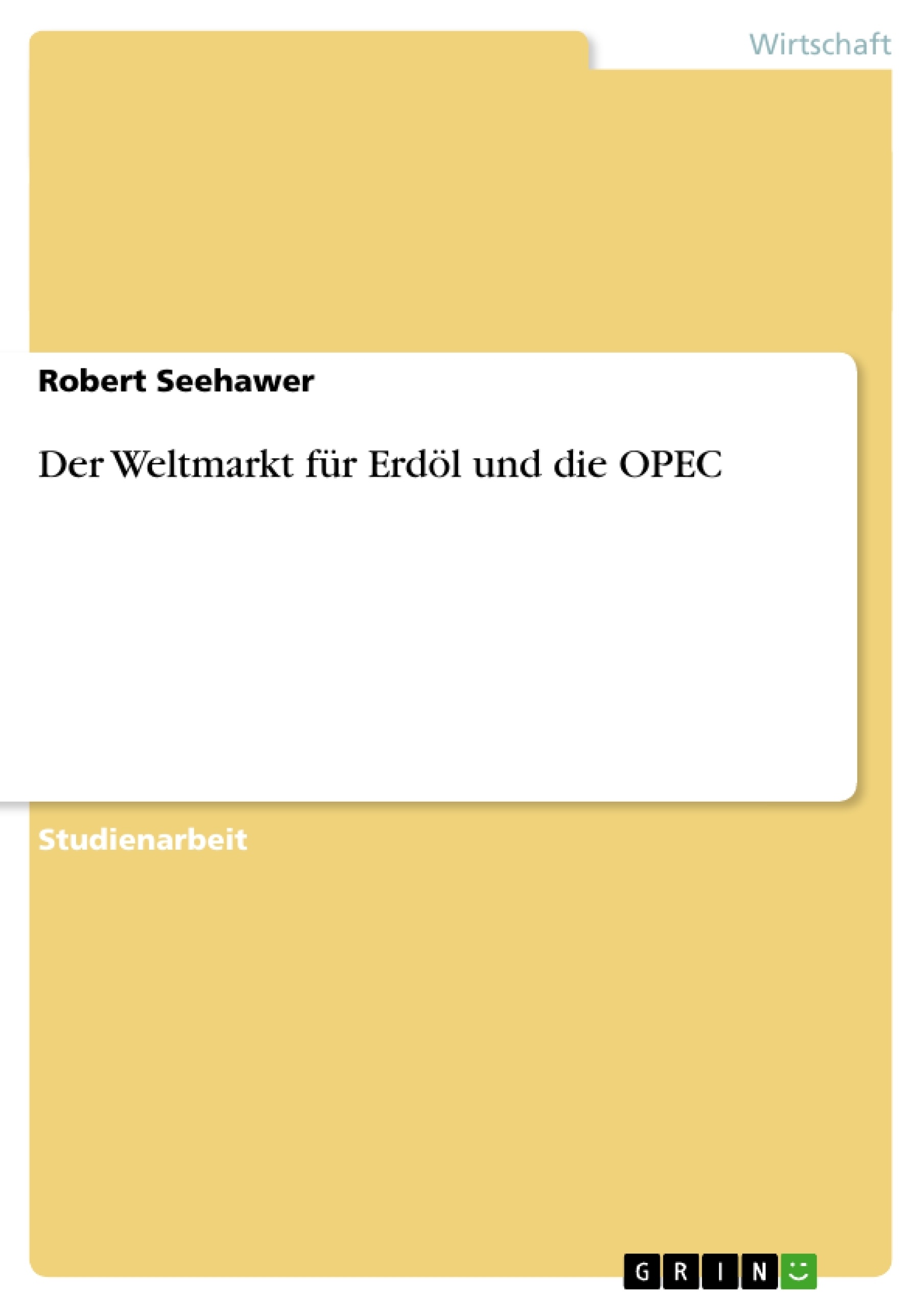Der Wettbewerbsentzug durch die Bildung von Kartellvereinigungen ist nicht erst seit
dem letzten Jahrhundert aktuell. „Menschen desselben Gewerbes“, schrieb der
schottische Ökonom Adam Smith 1776, „kommen selten zusammen, ohne dass die
Konversation in einer Verschwörung gegen die Öffentlichkeit oder mit einem faulen
Trick, die Preise zu erhöhen, endet.“ Dass hingegen die Umsetzung nicht so einfach zu
bewerkstelligen ist, darf nicht verkannt werden.
In der Ökonomie herrscht die langläufige Meinung, Kartellvereinigungen sind dazu
bestimmt, sich selbst aufzulösen. Dem ungeachtet ist die Kartellvereinigung der OPEC
seit mehr als 45 Jahren bestehend. Die enorme Wichtigkeit des Erdöls für die
weltwirtschaftliche Versorgung mit Energie macht die Organisation der petroleumexportierenden
Staaten zu einer der bedeutendsten Vereinigungen weltweit.
Preisschwankungen auf dem Weltmarkt für Erdöl erfährt der Großteil der Konsumenten
binnen wenigen Tagen. Wieso allerdings eine so starke Volatilität des Erdölpreises
existiert, obwohl die OPEC sich offiziell um die Glättung der Preisentwicklung bemüht,
erfährt er nicht.
Diese Arbeit soll Aufschluss über die Gefahren und Probleme der internen
Kartellstabilität der OPEC geben. Dazu wird untersucht, warum das Kartell, entgegen
der Vielzahl von ökonomischen Theorien und praktischen Beispielen, immer noch
existiert und an seiner Bedeutung nicht verloren hat. Im ersten Kapitel der Arbeit wird
der Begriff des Kartells abgegrenzt und auf den bedeutenden Sachverhalt der
Heterogenität der OPEC-Mitglieder verwiesen. Die große Variationsbreite der
Eigenschaften der Kartellstaaten soll im zweiten Kapitel zusammen mit den Gefahren
für die Kartellstabilität dargestellt werden. Hierbei wird unterteilt in innere und äußere
Umstände, welche die Disziplin der einzelnen Mitglieder beeinflusst. Danach soll im
dritten Kapitel der Begriff und die Umsetzungsproblematik der Kartellstabilität mit der
Hilfe von zwei theoretischen Ansätzen erklärt werden. Der erste Ansatz von Prager aus
dem Jahr 1993 versucht den Anreiz zum Hintergehen der Kartellvereinbarungen aus
einer mikroökonomischen Sichtweise zu erklären. Im zweiten Ansatz von 1997
modellieren Griffin und Xiong mit Hilfe der Spieltheorie eine empirische Analyse
speziell über die OPEC. Diese Erkenntnisse sind so umfassend, so dass sie hier nur kurz
umrissen werden können. Nichtsdestotrotz stellen die gewonnenen Resultate am
tiefgreifendesten dar, warum die OPEC immer noch existent ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1: Das Kartell der OPEC
- 1.1 Definition Kartell
- 1.2 Heterogenität der OPEC-Mitglieder
- Kapitel 2: Gefahren für die Kartellstabilität
- 2.1 Gefahren von Außen
- 2.2 Gefahren von Innen
- Kapitel 3: Theoretische Modellierungen zur Kartellstabilität
- 3.1 Der Ansatz von Prager
- 3.1.1 Statische Betrachtung
- 3.1.2 Die Swing-Produzenten-Strategie von Saudi Arabien
- 3.2 Der Ansatz von Griffin und Xiong
- 3.2.1 Die Verteilung der Produktionsquoten
- 3.2.2 Dynamische Betrachtung
- 3.2.3 Die Tit-For-Tat-Strategie von Saudi Arabien
- 3.2.4 Fazit des Ansatzes von Griffin und Xiong
- 3.1 Der Ansatz von Prager
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kartellstabilität der OPEC und beleuchtet die Gründe für deren langfristiges Bestehen trotz ökonomischer Theorien, die ein schnelles Auseinanderbrechen prognostizieren. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der internen Kartellstabilität und deren Einflussfaktoren.
- Definition und Charakteristika des OPEC-Kartells
- Heterogenität der OPEC-Mitglieder und deren Einfluss auf die Kartellstabilität
- Interne und externe Gefahren für die Kartellstabilität
- Theoretische Modellierungen zur Erklärung der Kartellstabilität (Ansätze von Prager und Griffin/Xiong)
- Analyse der Strategien zur Aufrechterhaltung der Kartellstabilität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kartellbildung und der OPEC ein. Sie hebt die Bedeutung des Erdölmarktes für die Weltwirtschaft hervor und stellt die Frage nach der anhaltenden Stabilität des OPEC-Kartells in den Mittelpunkt der Arbeit. Die Einleitung benennt die zentralen Fragestellungen und den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Definition des Kartells, die Heterogenität der Mitglieder, interne und externe Gefahren sowie theoretische Modellierungen konzentriert. Die existenzielle Bedeutung von Erdöl und die damit verbundenen Preisschwankungen werden als Motivation für die Untersuchung der OPEC-Stabilität herausgestellt.
Kapitel 1: Das Kartell der OPEC: Dieses Kapitel definiert zunächst den Begriff "Kartell" im wirtschaftlichen Kontext und beschreibt die spezifische Struktur des OPEC-Kartells, bestehend aus staatseigenen Ölförderunternehmen, die von Regierungsmitgliedern vertreten werden. Es wird der Fokus auf die angestrebte Verbesserung der Gewinnsituation durch abgesprochene Wettbewerbsbeschränkungen gelegt, wobei die rechtliche Selbstständigkeit der Mitglieder betont wird. Der Abschnitt 1.2 beleuchtet die Heterogenität der OPEC-Mitglieder, die unterschiedliche ökonomische Interessen und Strategien aufweist. Die Entstehung und Entwicklung der OPEC als Preis- und später als Produktionskartell wird kurz skizziert. Die Bedeutung der Koordinierung der gemeinsamen Preispolitik mit den individuellen Interessen der Mitgliedsstaaten wird unterstrichen.
Kapitel 2: Gefahren für die Kartellstabilität: Kapitel 2 untersucht die Faktoren, die die Stabilität des OPEC-Kartells gefährden können. Es differenziert zwischen externen und internen Gefahren. Externe Gefahren könnten z.B. aus dem Wettbewerb mit Nicht-OPEC-Staaten oder aus globalen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen resultieren. Interne Gefahren beziehen sich auf die unterschiedlichen Interessen und Produktionskapazitäten der einzelnen Mitgliedsstaaten und das damit verbundene Risiko des Vertragsbruchs. Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Fähigkeit der OPEC, ihren Preis- oder Produktionszielen zu erreichen. Die Disziplin der einzelnen Mitglieder und die Bewältigung von Interessenskonflikten werden als entscheidende Faktoren für die Kartellstabilität herausgestellt.
Schlüsselwörter
OPEC, Erdölmarkt, Kartellstabilität, Preispolitik, Produktionsquoten, Heterogenität, Spieltheorie, Mikroökonomie, Gewinnmaximierung, Zeitpräferenzrate, Absorptionsfähigkeit, Swing-Produzenten, Tit-For-Tat-Strategie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: OPEC Kartellstabilität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Kartellstabilität der OPEC und analysiert die Gründe für ihr langfristiges Bestehen, trotz ökonomischer Theorien, die ein schnelles Auseinanderbrechen prognostizieren. Ein Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen der internen Kartellstabilität und deren Einflussfaktoren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Charakteristika des OPEC-Kartells, Heterogenität der OPEC-Mitglieder und deren Einfluss auf die Kartellstabilität, interne und externe Gefahren für die Kartellstabilität, theoretische Modellierungen zur Erklärung der Kartellstabilität (Ansätze von Prager und Griffin/Xiong) und die Analyse der Strategien zur Aufrechterhaltung der Kartellstabilität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Kapitel und ein Fazit. Kapitel 1 definiert das OPEC-Kartell und beschreibt die Heterogenität seiner Mitglieder. Kapitel 2 analysiert interne und externe Gefahren für die Kartellstabilität. Kapitel 3 befasst sich mit theoretischen Modellierungen zur Erklärung der Kartellstabilität, insbesondere den Ansätzen von Prager und Griffin/Xiong. Die Einleitung und das Fazit umrahmen die zentralen Kapitel und fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit analysiert die Ansätze von Prager und Griffin/Xiong zur Modellierung der Kartellstabilität. Prager's Ansatz beinhaltet eine statische Betrachtung und die Analyse der Swing-Produzenten-Strategie Saudi Arabiens. Der Ansatz von Griffin und Xiong umfasst eine dynamische Betrachtung, die Verteilung der Produktionsquoten und die Tit-For-Tat-Strategie Saudi Arabiens.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: OPEC, Erdölmarkt, Kartellstabilität, Preispolitik, Produktionsquoten, Heterogenität, Spieltheorie, Mikroökonomie, Gewinnmaximierung, Zeitpräferenzrate, Absorptionsfähigkeit, Swing-Produzenten, Tit-For-Tat-Strategie.
Welche Gefahren für die Kartellstabilität werden untersucht?
Die Arbeit unterscheidet zwischen externen Gefahren (z.B. Wettbewerb mit Nicht-OPEC-Staaten, globale politische und wirtschaftliche Entwicklungen) und internen Gefahren (unterschiedliche Interessen und Produktionskapazitäten der Mitgliedsstaaten, Vertragsbruch). Die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Fähigkeit der OPEC, ihre Preis- oder Produktionsziele zu erreichen, werden analysiert.
Was ist die zentrale Fragestellung der Arbeit?
Die zentrale Fragestellung ist, warum das OPEC-Kartell trotz ökonomischer Theorien, die ein schnelles Auseinanderbrechen vorhersagen, langfristig stabil ist.
Welche Rolle spielt Saudi Arabien?
Die Rolle Saudi Arabiens wird im Kontext der Strategien zur Aufrechterhaltung der Kartellstabilität beleuchtet. Die Arbeit analysiert insbesondere die "Swing-Produzenten-Strategie" und die "Tit-For-Tat-Strategie" Saudi Arabiens im Rahmen der theoretischen Modellierungen von Prager und Griffin/Xiong.
- Quote paper
- Robert Seehawer (Author), 2003, Der Weltmarkt für Erdöl und die OPEC, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16206