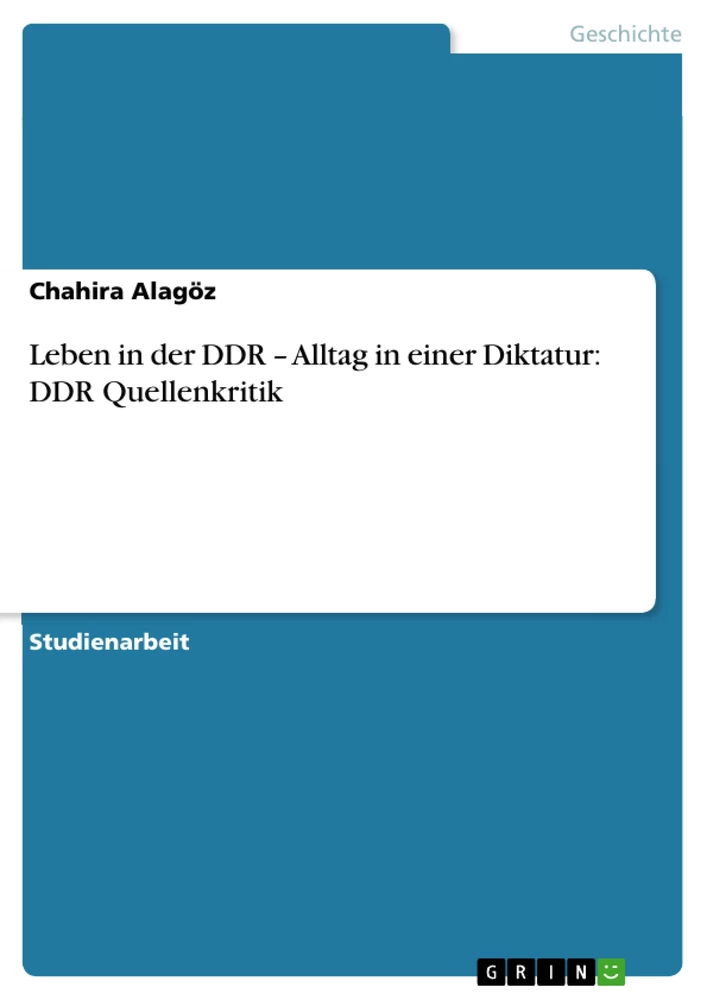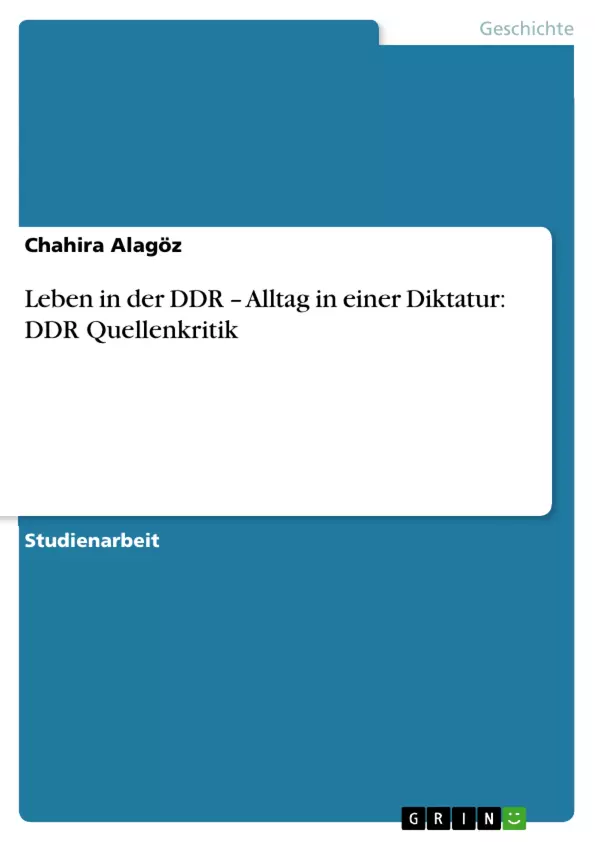1. Einleitung
Wenn man sich mit dem Thema Jugend und der Jugendpolitik der Deutschen Demokratischen Republik auseinandersetzt, so lässt es sich nicht vermeiden, sich auch mit dem Verbot der Beatmusik zu beschäftigen. Konflikte gab es mit den Jugendlichen, die gegen den Strom schwimmen und somit nicht in das vordiktierte Konzept der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) hineinpassten.
Im Rahmen dieser Quellenkritik, die sich mit dem Auszug aus dem Bericht von Erich Honecker aus dem Politbüro an das 11. Plenum des ZK der SED vom Dezember 1965 beschäftigt, gilt es einerseits herauszufinden, wie die Reaktionen der DDR- Führung auf die Verbreitung der Beatmusik amerikanischen Vorbilds war und andererseits die tatsächlichen Auswirkungen der Beatklänge auf Heranwachsende der DRR zu untersuchen.
In der vorliegenden Arbeit erscheint es mir wichtig, die Entwicklung von Subkulturen und der Jugendpolitik in den ideologischen und politischen Kontext einzuordnen. Es macht Sinn, die Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik aus der Sicht ihrer Jugendgenerationen zu erörtern, da in der DDR die Jugend eine zentrale Rolle gespielt hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungs- und Literaturüberblick
- 1.2 Fragestellung
- 2. Quellenkritik
- 2.1 Inhalt
- 2.2 Quellenkundlicher Apparat
- 2.2.1 Autor und Werk
- 2.2.2 Personenkommentar
- 2.2.3 Sach- und Ortskommentar
- 2.3 Quellenkritik
- 2.3.1 Äußere Kritik
- 2.3.2 Innere Kritik
- 3. Historischer Kontext
- 4. Quelleninterpretation
- 5. Zusammenfassung / Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reaktion der DDR-Führung auf die Verbreitung von Beatmusik und deren Auswirkungen auf Jugendliche. Sie analysiert den Bericht von Erich Honecker an das 11. Plenum des ZK der SED von Dezember 1965 und ordnet die Entwicklung von Jugendsubkulturen in den ideologischen und politischen Kontext der DDR ein. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Jugend in der DDR und die Gründe für die staatliche Unterdrückung von abweichendem Verhalten.
- Reaktion der DDR-Führung auf Beatmusik
- Auswirkungen der Beatmusik auf Jugendliche in der DDR
- Jugendsubkulturen und Jugendpolitik in der DDR
- Rolle der Jugend in der DDR-Gesellschaft
- Staatliche Kontrolle und Unterdrückung abweichenden Verhaltens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik Jugend und Jugendpolitik in der DDR ein und fokussiert auf das Verbot von Beatmusik als Konfliktfeld zwischen Jugend und SED-Ideologie. Sie benennt die Forschungsfrage nach den Reaktionen der DDR-Führung auf Beatmusik und deren Auswirkungen auf Jugendliche. Der Forschungs- und Literaturüberblick zeigt die vorhandene wissenschaftliche Literatur zu DDR-Geschichte und -Jugend auf, mit Fokus auf Alltag, Gesellschaft und Jugendpolitik der DDR.
2. Quellenkritik: Dieses Kapitel analysiert den Bericht von Erich Honecker aus dem Dezember 1965. Es untersucht Honeckers Kritik an der Berichterstattung über Beatmusik im Zentralrat der FDJ und seiner Sicht auf die potenziellen negativen Auswirkungen der Musik auf Jugendliche. Honeckers differenzierte Haltung – Toleranz gegenüber gepflegter Beatmusik, aber Ablehnung westlich beeinflusster Musik – wird hervorgehoben. Die Quellenkritik befasst sich mit der äußeren und inneren Kritik des Dokuments, um dessen Glaubwürdigkeit und Aussagekraft zu bewerten. Die Identifikation des eigentlichen Autors des Berichtes wird untersucht.
3. Historischer Kontext: (Eine Zusammenfassung für dieses Kapitel kann hier eingefügt werden, sollte der Text entsprechende Informationen enthalten.)
4. Quelleninterpretation: (Eine Zusammenfassung für dieses Kapitel kann hier eingefügt werden, sollte der Text entsprechende Informationen enthalten.)
Schlüsselwörter
DDR, Jugend, Beatmusik, Jugendpolitik, SED, Erich Honecker, Quellenkritik, Subkultur, staatliche Kontrolle, ideologischer Kontext, politischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Reaktion der DDR-Führung auf Beatmusik"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Reaktion der DDR-Führung, insbesondere Erich Honeckers, auf die Verbreitung von Beatmusik und deren Auswirkungen auf Jugendliche in der DDR. Sie analysiert einen Bericht Honeckers von 1965 und setzt die Entwicklung von Jugendsubkulturen in den ideologischen und politischen Kontext der DDR.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Hauptquelle ist ein Bericht von Erich Honecker an das 11. Plenum des ZK der SED von Dezember 1965. Die Arbeit beinhaltet eine ausführliche Quellenkritik, die sowohl die äußere als auch die innere Kritik des Dokuments umfasst, inklusive der Untersuchung des Autors und der Glaubwürdigkeit des Berichtes.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Reaktion der DDR-Führung auf Beatmusik, die Auswirkungen der Musik auf Jugendliche, Jugendsubkulturen und Jugendpolitik in der DDR, die Rolle der Jugend in der DDR-Gesellschaft und die staatliche Kontrolle und Unterdrückung abweichenden Verhaltens. Ein besonderer Fokus liegt auf Honeckers differenzierter Haltung: Toleranz gegenüber "gepflegter" Beatmusik, aber Ablehnung westlich beeinflusster Musik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung mit Forschungsüberblick und Fragestellung, ein Kapitel zur Quellenkritik (inkl. äußerer und innerer Kritik sowie Autor- und Sachkommentar), ein Kapitel zum historischen Kontext, ein Kapitel zur Quelleninterpretation und abschließend eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen? (Vorläufige Antwort)
Die konkreten Schlussfolgerungen sind aus der gegebenen Zusammenfassung nicht vollständig ersichtlich. Die Arbeit untersucht aber die Reaktionen der DDR-Führung auf Beatmusik, die ideologischen und politischen Hintergründe und die Auswirkungen auf Jugendliche in der DDR.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
DDR, Jugend, Beatmusik, Jugendpolitik, SED, Erich Honecker, Quellenkritik, Subkultur, staatliche Kontrolle, ideologischer Kontext, politischer Kontext.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit ist für die akademische Nutzung bestimmt und dient der Analyse von Themen im Kontext der DDR-Geschichte und -Jugendpolitik.
- Quote paper
- Chahira Alagöz (Author), 2010, Leben in der DDR – Alltag in einer Diktatur: DDR Quellenkritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162092