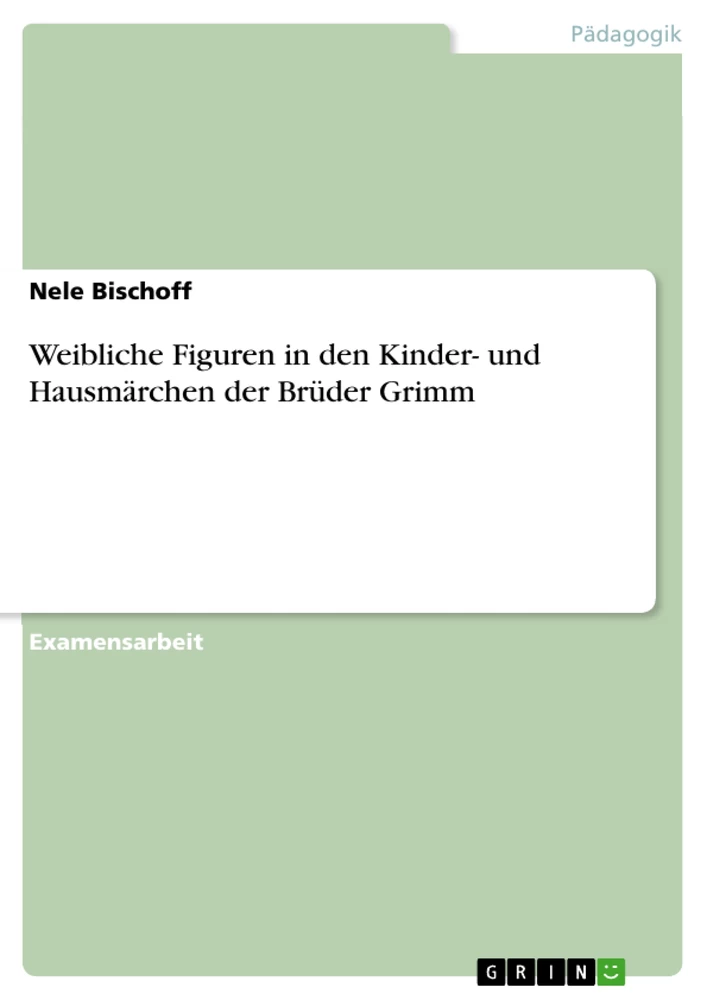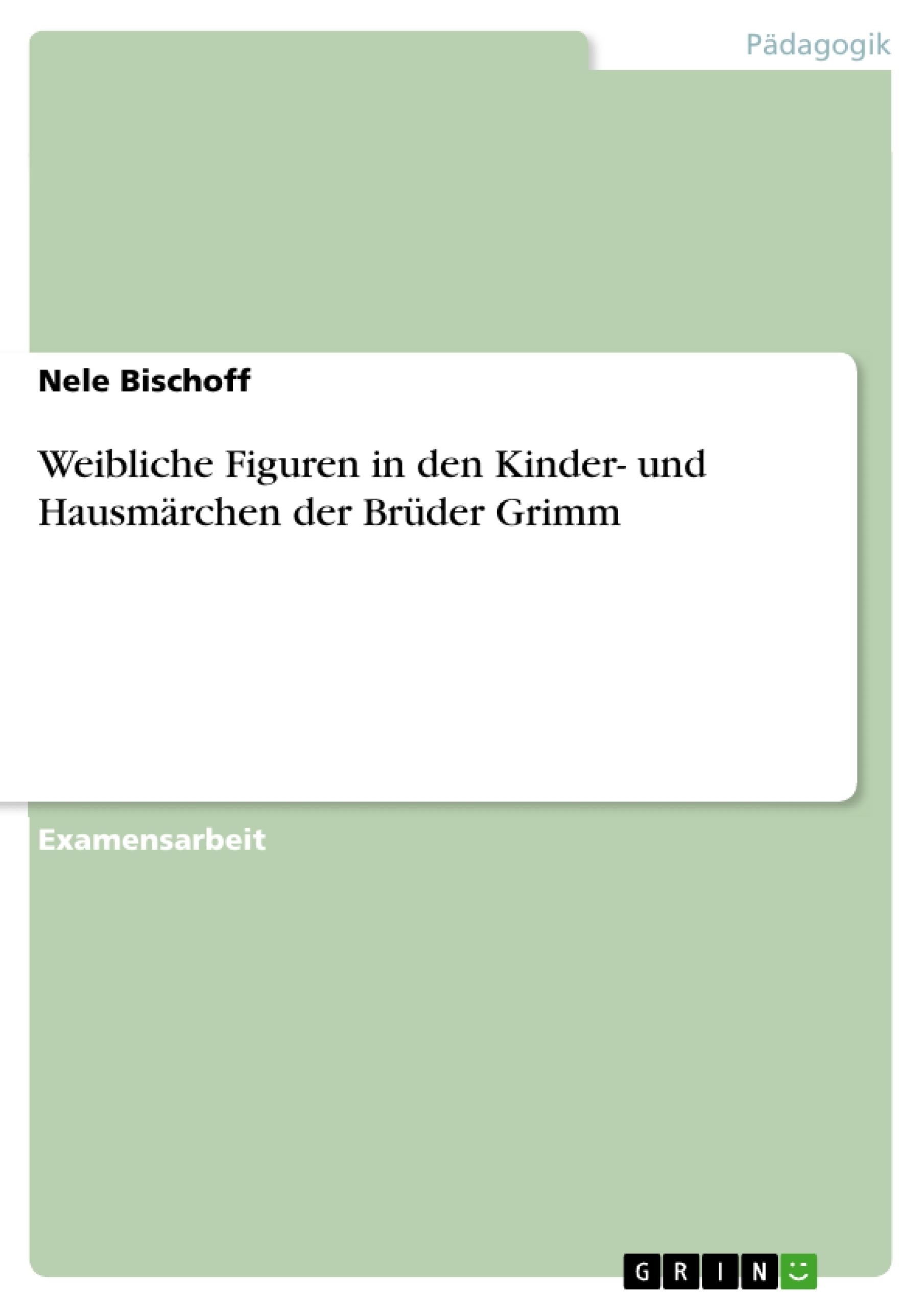„Ein Märchen hat seine Wahrheit und muss sie haben, sonst wäre es kein Märchen.“ (Johann Wolfgang von Goethe)
Durch dieses Zitat wird deutlich, dass Märchen möglicherweise mehr sind als bloße „Lügenmäre“. Goethe geht hier sogar so weit zu behaupten, dass ein Märchen ohne Wahrheitsgehalt nicht als solches zu bezeichnen wäre.
Liebe, Brautwerbung, Ehe und Partnerschaft, Selbstfindung und Moral sind ein Hauptbestandteil unseres realen Lebens sowie des der Märchenfiguren. Auch Themen wie geschlechterspezifische Rollenverteilung, Adoleszenz und Sexualität spielen in beiden Welten eine wichtige Rolle.
Diese Arbeit wird sich insbesondere den weiblichen Rollenträgern im Märchen zuwenden. Es soll nach Motiven gesucht werden, die zu der Entstehung und Darstellungsweise der einzelnen Figuren geführt haben könnten. Dazu werden einzelne Märchen in Hinblick auf ihre weiblichen Protagonisten und deren soziohistorischen Hintergrund untersucht.
Die Figur der Hexe, Königin, Prinzessin, Bauerstochter, Spinnerin oder Stiefmutter ist keine Erfindung des Märchens, aber lässt sich hier eine Verbindung der Frauenfiguren in den Volksmärchen zu der Situation der Frau im 19. Jahrhunderts entdecken? Und finden sich realistische Elemente, die über das soziale Leben der Märchenträger Aufschluss geben können?
Der Anfang dieser Arbeit soll ein theoretisches Hintergrundwissen und einen inhaltlichen Rahmen bieten und befasst sich daher näher mit der Gattung des „Volksmärchens“ allgemein. Eine Abgrenzung zum Kunstmärchen wird erfolgen, sowie zu anderen, dem Märchen verwandte Gattungen, insbesondere der Sage und der Legende. Merkmale und Symbole, die besonders für das Thema dieser Arbeit relevant sind, sollen ebenfalls näher erläutert werden.
Die Entstehungsgeschichte und die Quellen der KHM werden dargestellt und auch ein kurzer Überblick über das Leben der beiden Brüder wird erfolgen. Zwischen den Urfassungen und aktuellen Ausgaben lassen sich Veränderungen nachweisen. Warum und wozu diese Veränderungen vorgenommen wurden, soll näher untersucht werden.
Psychologische, germanistische, soziologische und historische Faktoren werden in dieser Arbeit eine Rolle spielen.
In der Schlussbetrachtung sollte ein Resümee gezogen werden können, an dessen Ergebnissen auch aufgezeigt werden kann, in wieweit Goethes Aussage, dass „Märchen“ und „Wahrheit“ Parallelen aufweisen, für das Thema dieser Arbeit zutreffend ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Volksmärchen
- Merkmale des Volksmärchens
- Symbole
- Abgrenzung zu verwandten Gattungen
- Die Entstehungsgeschichte und die Quellen der KHM
- Weibliche Figuren in den KHM als Spiegel gesellschaftlicher Ordnungen und sozialer Bedingungen des 19. Jahrhunderts
- Die Hexe als historische Figur
- Die Hexe als fiktive Figur in den Kinder und Hausmärchen
- Die Mutter/Stiefmutter als historische Figur
- Die Mutter/Stiefmutter als fiktive Figur in den Kinder- und Hausmärchen
- Der passive und der aktive Typ in den Kinder- und Hausmärchen
- Der „passive Typ“ Dornröschen: Interpretation des KHM 50 und Analyse der weiblichen Figuren
- Gretel als „aktive Märchenheldin“: Interpretation des KHM 15 und Analyse der weiblichen Figuren
- Die Ehe und Familie im Märchen
- Geschwisterbeziehungen im Märchen
- Der Alltag im Märchen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die weiblichen Figuren in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm (KHM) im Kontext des 19. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Darstellung weiblicher Rollen und deren soziohistorischen Hintergrund zu analysieren und nach Motiven für die Entstehung und Darstellungsweise dieser Figuren zu suchen. Dabei werden spezifische Märchen anhand ihrer weiblichen Protagonisten näher untersucht.
- Analyse der weiblichen Figuren in den KHM und ihrer Darstellung im 19. Jahrhundert
- Untersuchung der historischen und fiktiven Figuren der „Hexe“ und „Stiefmutter“
- Behandlung der Motive „Ehe“ und „Familie“ in den Märchen
- Vergleich des „passiven“ und „aktiven“ weiblichen Rollenbildes anhand von Dornröschen und Gretel
- Einordnung der Märchen im Kontext der Romantik und der Weltanschauung der Brüder Grimm
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung zitiert Goethe und die Brüder Grimm, um die Debatte um den Wahrheitsgehalt von Märchen zu beleuchten. Sie führt in die KHM ein, erläutert deren Entstehungsgeschichte und Popularität, und definiert den Fokus der Arbeit: die Analyse weiblicher Figuren in den Märchen im Hinblick auf ihren soziohistorischen Hintergrund im 19. Jahrhundert. Die Einleitung legt den Grundstein für die spätere Untersuchung der Rollen der Hexe und Stiefmutter sowie des passiven und aktiven weiblichen Rollenbildes. Die Arbeit wird sich mit der Frage beschäftigen, ob sich in den Märchen realistische Elemente finden lassen, die Aufschluss über das soziale Leben der Zeit geben.
Das Volksmärchen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Analyse der Märchen. Es definiert das Volksmärchen, grenzt es von verwandten Gattungen ab und beschreibt Merkmale und Symbole, die relevant für die Untersuchung der weiblichen Figuren sind. Die Diskussion über die Definition des Märchens, zwischen "Lügenmärchen" und Träger von Wahrheit, bereitet den Boden für die spätere Interpretation der weiblichen Figuren und ihrer Rollen in der Gesellschaft.
Die Entstehungsgeschichte und die Quellen der KHM: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Kinder- und Hausmärchen, die Quellen der Grimmschen Sammlung und den Einfluss der Romantik. Es wird der Einfluss des zeithistorischen Vorstellungshorizonts der Brüder Grimm auf die Moral und Wertvorstellungen in den Märchen untersucht, indem die Veränderungen zwischen den Urfassungen und den aktuellen Ausgaben der KHM analysiert werden. Das Kapitel liefert den historischen Kontext, der essentiell ist um die weiblichen Figuren und ihre Rollen zu verstehen.
Weibliche Figuren in den KHM als Spiegel gesellschaftlicher Ordnungen und sozialer Bedingungen des 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es untersucht die Rollen von Frauen in den Märchen, insbesondere die der Hexe und Stiefmutter, sowohl in ihrer historischen als auch fiktiven Ausprägung. Es analysiert die Darstellung dieser Figuren als Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse und sozialen Bedingungen im 19. Jahrhundert und deren Widerspiegelung in den KHM. Der Bezug zur historischen Realität wird hergestellt, um die fiktive Darstellung zu kontextualisieren.
Der passive und der aktive Typ in den Kinder- und Hausmärchen: Dieses Kapitel vergleicht die „passive“ Figur Dornröschen mit der „aktiven“ Figur Gretel, um das Spektrum weiblicher Rollen in den Märchen zu beleuchten und zu zeigen, wie oft die stereotypen Geschlechterrollen durchbrochen werden. Die Analyse von Dornröschen und Gretel dient der Untersuchung der Adoleszenz und den damit verbundenen psychischen und physischen Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen zu "Weibliche Figuren in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die weiblichen Figuren in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm (KHM) im Kontext des 19. Jahrhunderts. Sie untersucht die Darstellung weiblicher Rollen, deren soziohistorischen Hintergrund und die Motive für ihre Entstehung und Darstellungsweise. Spezifische Märchen und ihre weiblichen Protagonisten werden näher untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Analyse der weiblichen Figuren in den KHM und ihrer Darstellung im 19. Jahrhundert; Untersuchung der historischen und fiktiven Figuren der „Hexe“ und „Stiefmutter“; Behandlung der Motive „Ehe“ und „Familie“ in den Märchen; Vergleich des „passiven“ und „aktiven“ weiblichen Rollenbildes anhand von Dornröschen und Gretel; Einordnung der Märchen im Kontext der Romantik und der Weltanschauung der Brüder Grimm.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung: Einführung in die KHM, deren Entstehungsgeschichte und den Fokus der Arbeit (Analyse weiblicher Figuren im soziohistorischen Kontext). Das Volksmärchen: Definition und Merkmale des Volksmärchens, Abgrenzung zu anderen Gattungen. Die Entstehungsgeschichte und die Quellen der KHM: Entstehung der KHM, Quellen und Einfluss der Romantik. Weibliche Figuren in den KHM als Spiegel gesellschaftlicher Ordnungen und sozialer Bedingungen des 19. Jahrhunderts: Analyse der Rollen von Frauen, insbesondere der Hexe und Stiefmutter, in historischer und fiktiver Ausprägung. Der passive und der aktive Typ in den Kinder- und Hausmärchen: Vergleich von Dornröschen (passiv) und Gretel (aktiv) als Beispiel für weibliche Rollenbilder. Zusätzlich gibt es Kapitel zu Ehe und Familie, Geschwisterbeziehungen und dem Alltag im Märchen, sowie eine Zusammenfassung.
Wie werden die weiblichen Figuren analysiert?
Die weiblichen Figuren werden analysiert, indem ihre Darstellung im Kontext der gesellschaftlichen Verhältnisse und sozialen Bedingungen des 19. Jahrhunderts untersucht wird. Der Bezug zur historischen Realität wird hergestellt, um die fiktive Darstellung zu kontextualisieren. Es werden sowohl stereotype als auch nicht-stereotype Geschlechterrollen betrachtet.
Welche Märchen werden exemplarisch untersucht?
Die Märchen "Dornröschen" (KHM 50) und "Hänsel und Gretel" (KHM 15) werden exemplarisch untersucht, um den "passiven" und "aktiven" weiblichen Typus zu veranschaulichen.
Welche Rolle spielt der historische Kontext?
Der historische Kontext des 19. Jahrhunderts ist essentiell für das Verständnis der weiblichen Figuren und ihrer Rollen in den Märchen. Die Arbeit untersucht den Einfluss des zeithistorischen Vorstellungshorizonts der Brüder Grimm auf die Moral und Wertvorstellungen in den Märchen und analysiert Veränderungen zwischen den Urfassungen und den aktuellen Ausgaben der KHM.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Analyse der Darstellung weiblicher Rollen in den KHM und deren soziohistorischen Hintergrund. Es soll nach Motiven für die Entstehung und Darstellungsweise dieser Figuren gesucht werden.
Wie wird das Volksmärchen definiert?
Das Kapitel "Das Volksmärchen" legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es definiert das Volksmärchen, grenzt es von verwandten Gattungen ab und beschreibt Merkmale und Symbole, die für die Untersuchung der weiblichen Figuren relevant sind. Die Debatte um den Wahrheitsgehalt von Märchen wird ebenfalls angesprochen.
- Quote paper
- Nele Bischoff (Author), 2010, Weibliche Figuren in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162094