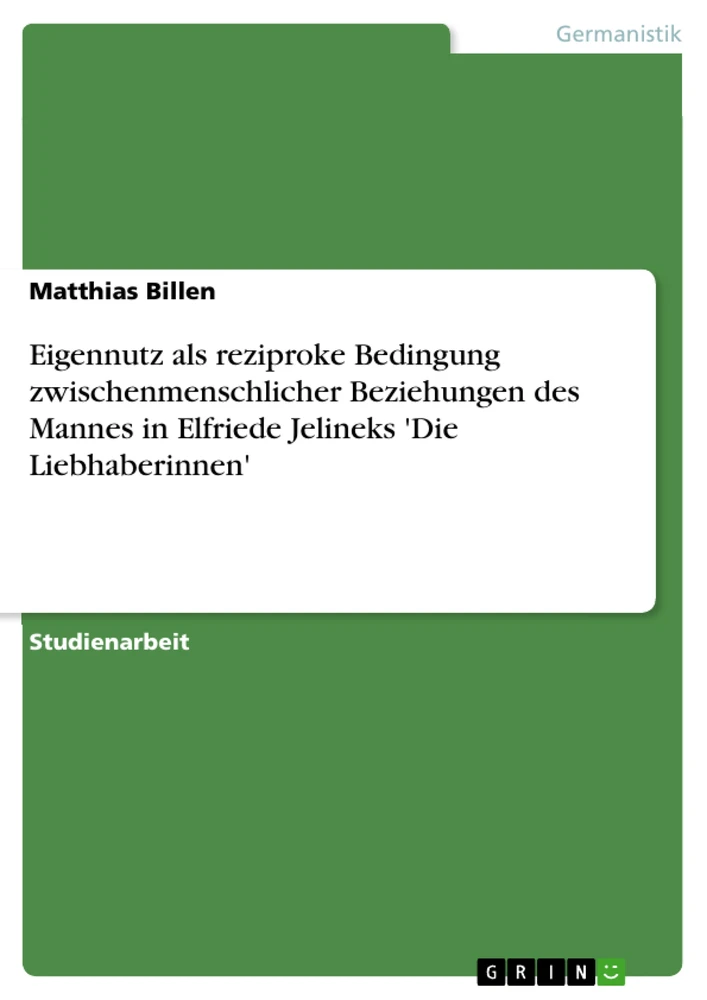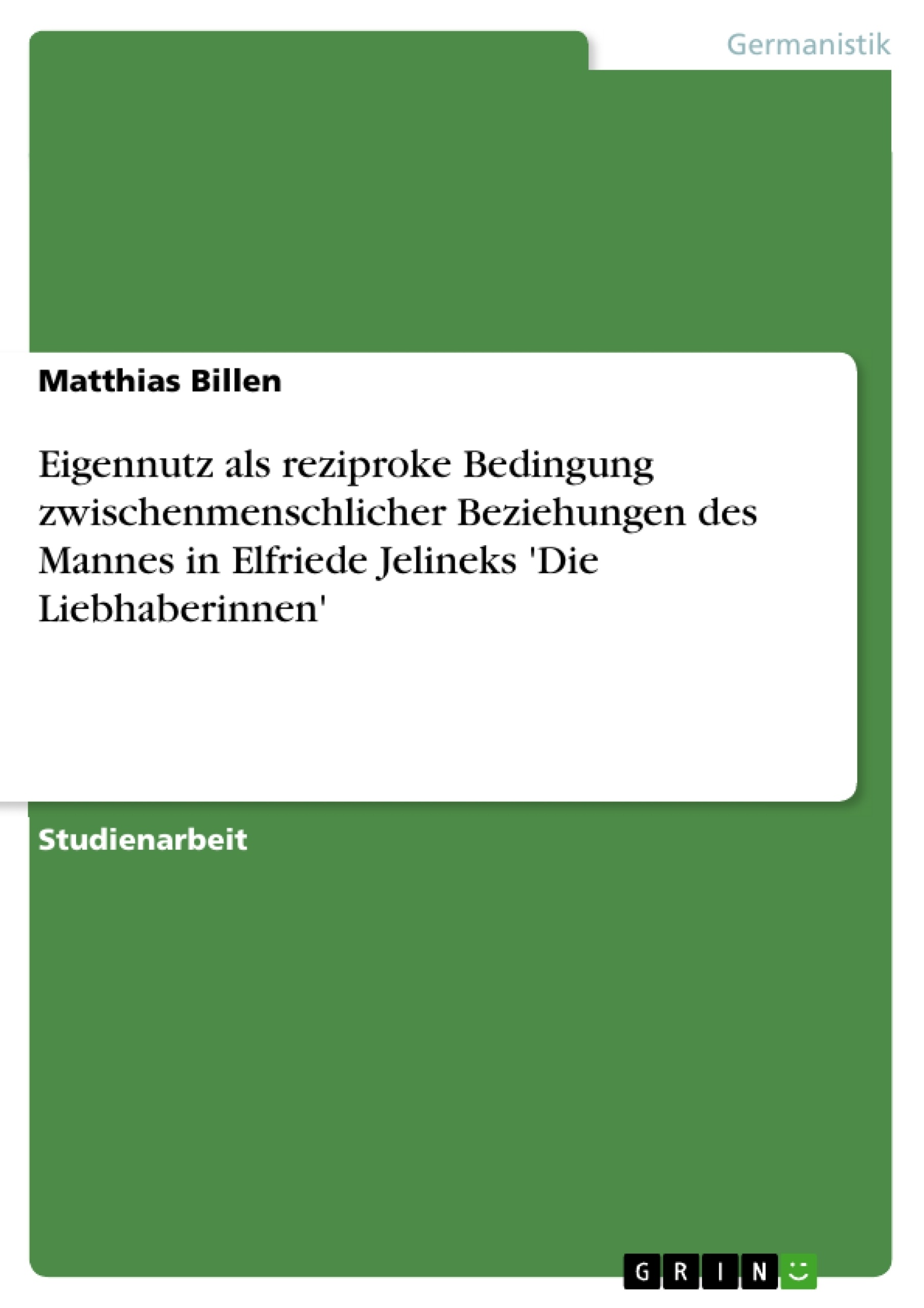Gesellschaftliche Vorstellungen von Liebe, Ehe und Familienglück tragen häufig romantisierende Züge: Die Suche nach dem Gentleman, der Traumfrau oder der glücklichen Partnerschaft zwischen Mann und Frau und einer Familie, welche letztlich die endgültige seelische Befriedigung liefern soll, stellt einen zentralen Kern gesellschaftlicher Sehnsuchtsvorstellungen dar. Häufig bleiben diese jedoch lediglich Wunschvorstellungen, die nie erreicht werden können und die enttäuschende Realität verschleiern.
Sinnbild für diese falschen Vorstellungen von Liebe und Glück stellt der Roman „Die Liebhaberinnen“ von Elfriede Jelinek dar. Der Titel weckt Erwartungen, welche jedoch nicht erfüllt werden: Der Leser würde eine Liebesgeschichte mehrerer Frauen erwarten, erotisch untermalt und von positiven Emotionen erfüllt. Er wird jedoch in eine Welt hi-neinversetzt, welche die Realität mit ungeschminkten Wahrheiten darstellt und jeden Glauben an die Vorstellung von wahrer, glücklicher Liebe und zärtlicher gegenseitiger Zuneigung im Ansatz zerstört. Es wird der Kampf zweier Frauen geschildert, die durch die Ehe mit einem Mann, welchen sie in ihrer individuellen Situation als die beste Wahl zum Erreichen eines höheren sozialen Status betrachten, ihre Ziele verwirklichen wollen.
...
Im Folgenden soll versucht werden, diese Instrumentalisierung der Mitmenschen, insbe-sondere des anderen Geschlechts, aus Sicht des Mannes darzustellen, um zu beweisen, dass die Autorin keine einseitigen Schuldzuweisungen tätigt: Wie wird der Mann ausgenutzt und wie nutzt er selbst aus, welche Rolle spielen hierbei insbesondere die Ehefrauen und seine Familie?
Hierzu sollen die beiden wichtigsten männlichen Persönlichkeiten im Roman, Heinz und Erich, charakterisiert werden. Es soll dargestellt werden, inwiefern sie ihre geschlechtlichen Bedürfnisse und ihre Aggressionen am vermeintlich schwächeren Geschlecht abrea-gieren, sie zudem als Arbeitskraft einsetzen. Im Gegenzug soll ihre Stellung gegenüber der Frau sowie ihren Familienmitgliedern herausgearbeitet werden und inwiefern sie ihnen als Befruchter, Ernährer oder Familienvater dienen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Die Personen im Roman
- 1.1 Charakterisierung der männlichen „Protagonisten“
- 1.1.1 Heinz
- 1.1.2 Erich
- 1.2 Darstellung der weiblichen Figuren
- 1.2.1 Brigitte
- 1.2.2 Paula
- 1.1 Charakterisierung der männlichen „Protagonisten“
- 2. Instrumentalisierung und Ausbeutung als gesellschaftliche Normalität
- 2.1 Instrumentalisierung durch den Mann
- 2.1.1 Triebbefriedigung
- 2.1.2 Arbeitskraft
- 2.1.3 Aggressionsventil
- 2.2 Ausbeutung des männlichen Geschlechts
- 2.2.1 Befruchter
- 2.2.2 Ernährer und Arbeiter
- 2.2.3 Höherer sozialer Status und Prestigefaktor
- 2.1 Instrumentalisierung durch den Mann
- 1. Die Personen im Roman
- III. Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Elfriede Jelineks Roman „Die Liebhaberinnen“ und untersucht die Darstellung von Beziehungen zwischen Männern und Frauen, insbesondere die Aspekte der Instrumentalisierung und Ausbeutung. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Autorin diese Dynamiken darstellt und ob sie einseitige Schuldzuweisungen vornimmt.
- Darstellung der männlichen und weiblichen Figuren und deren Charakteristika
- Analyse der Instrumentalisierung des jeweils anderen Geschlechts
- Die Rolle ökonomischer Überlegungen in zwischenmenschlichen Beziehungen
- Die Suche nach sozialem Aufstieg und die Rolle der Ehe
- Entlarvung romantischer Vorstellungen von Liebe und Glück
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Romans „Die Liebhaberinnen“ von Elfriede Jelinek dar. Sie kontrastiert die gesellschaftlichen Wunschvorstellungen von Liebe, Ehe und Familienglück mit der Realität, die im Roman ungeschminkt dargestellt wird. Der Roman entlarvt die Illusionen romantischer Liebe und zeigt den Kampf zweier Frauen um einen höheren sozialen Status durch die Heirat mit Männern, die auf unterschiedliche Weise dargestellt werden. Die Einleitung kündigt die Analyse der Instrumentalisierung und Ausbeutung in den zwischenmenschlichen Beziehungen an, wobei der Fokus auf der Perspektive der Männer liegt, um einseitige Schuldzuweisungen zu vermeiden.
II. Hauptteil, Kapitel 1. Die Personen im Roman: Dieses Kapitel charakterisiert die wichtigsten männlichen Figuren des Romans, Heinz und Erich. Es untersucht deren Motivationen, Handlungen und Beziehungen zu den Frauen. Heinz wird als zielstrebiger, aber auch egoistischer und rücksichtsloser Mann dargestellt, der Brigitte ausnutzt, um seine wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Erich, der Forstarbeiter, wird als äußerlich attraktiv aber charakterlich schwach und gefühlskalt geschildert, der von Paula instrumentalisiert wird. Die Charakterisierungen legen die Grundlage für die anschließende Analyse der Instrumentalisierung und Ausbeutung in den Beziehungen.
Schlüsselwörter
Elfriede Jelinek, Die Liebhaberinnen, Instrumentalisierung, Ausbeutung, Geschlechterrollen, soziale Mobilität, Liebe, Ehe, ökonomische Beziehungen, Romananalyse, Charakterisierung, Heinz, Erich, Brigitte, Paula.
Häufig gestellte Fragen zu Elfriede Jelineks "Die Liebhaberinnen"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Vorschau auf eine akademische Arbeit, die sich mit Elfriede Jelineks Roman "Die Liebhaberinnen" auseinandersetzt. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Darstellung von Beziehungen zwischen Männern und Frauen, insbesondere der Aspekte der Instrumentalisierung und Ausbeutung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung von Beziehungen zwischen Männern und Frauen in "Die Liebhaberinnen". Besondere Aufmerksamkeit wird der Instrumentalisierung und Ausbeutung beider Geschlechter gewidmet. Weitere Themen sind die Charakterisierung der männlichen und weiblichen Figuren, die Rolle ökonomischer Überlegungen in Beziehungen, der soziale Aufstieg durch Heirat und die Entlarvung romantischer Liebesvorstellungen.
Welche Figuren werden im Roman analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Hauptfiguren Heinz und Erich (männlich) sowie Brigitte und Paula (weiblich). Ihre Charaktere werden detailliert beschrieben und ihre Beziehungen zueinander im Kontext von Instrumentalisierung und Ausbeutung untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schlussteil. Der Hauptteil analysiert die Figuren und untersucht die Instrumentalisierung und Ausbeutung in den Beziehungen. Die Einleitung stellt den Kontext des Romans und die Forschungsfrage dar, während der Schlussteil die Ergebnisse zusammenfasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Elfriede Jelinek, Die Liebhaberinnen, Instrumentalisierung, Ausbeutung, Geschlechterrollen, soziale Mobilität, Liebe, Ehe, ökonomische Beziehungen, Romananalyse, Charakterisierung, Heinz, Erich, Brigitte, Paula.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Darstellung von Beziehungen in "Die Liebhaberinnen" zu analysieren, die Aspekte der Instrumentalisierung und Ausbeutung zu untersuchen und zu hinterfragen, ob die Autorin einseitige Schuldzuweisungen vornimmt. Der Fokus liegt auf einer ausgewogenen Betrachtung der Perspektiven beider Geschlechter.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Zusammenfassung der Einleitung beschreibt den Kontext des Romans und die Forschungsfrage. Die Zusammenfassung des Hauptteils (Kapitel 1) beschreibt die Charakterisierung der Hauptfiguren und legt den Grundstein für die Analyse der Instrumentalisierung und Ausbeutung. Eine Zusammenfassung des Schlussteils fehlt in der Vorschau.
- Quote paper
- Matthias Billen (Author), 2006, Eigennutz als reziproke Bedingung zwischenmenschlicher Beziehungen des Mannes in Elfriede Jelineks 'Die Liebhaberinnen', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162171