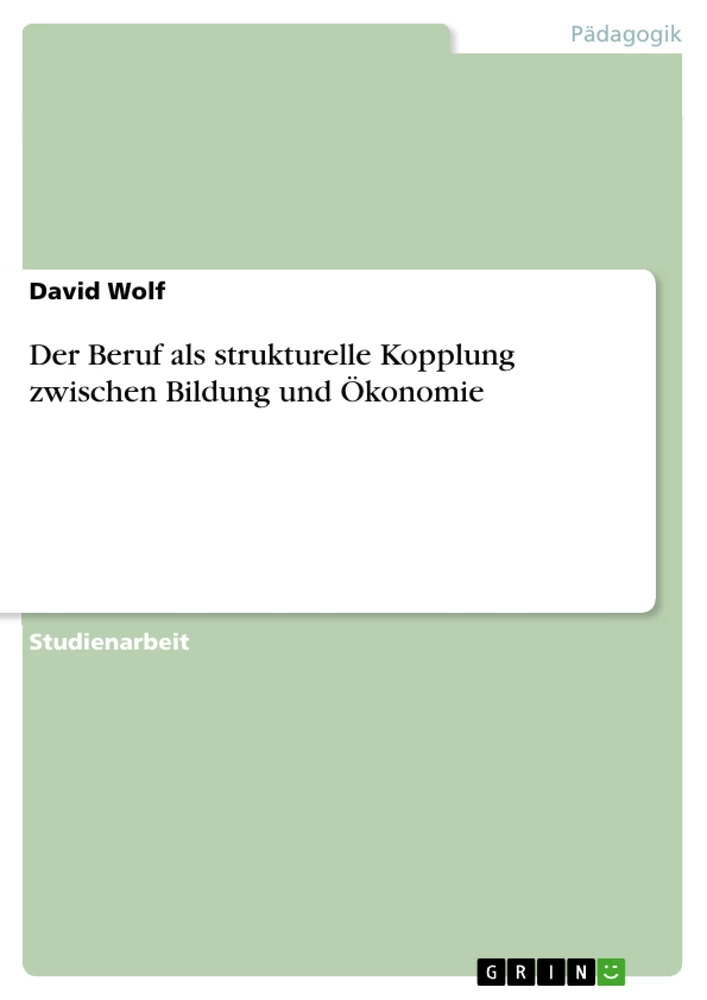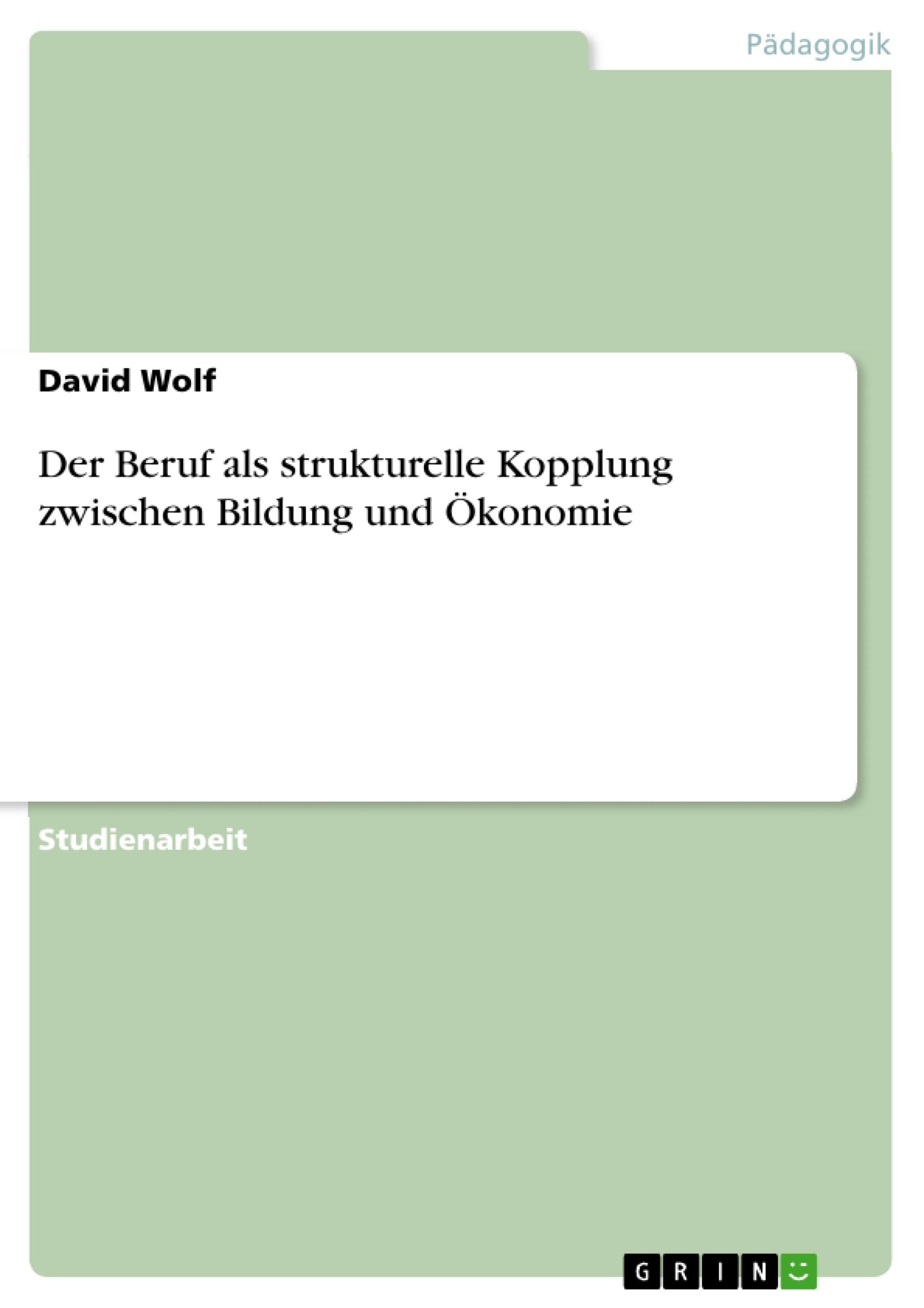Das Thema für diese Arbeit wurde gewählt, da die Notwendigkeit eines Diskurses in der Allgemeinen Erziehungswissenschaft gesehen wird. Die vorliegende Arbeit soll sich daher mit der Frage nach der Bedeutung des Berufs in der heutigen Zeit beschäftigen. Dazu wird in erster Linie der historische Weg zum modernen Beruf mit aktuellen systemtheoretischen, berufssoziologischen Betrachtungsweisen aufgezeigt. Im weiteren Verlauf wird die Kopplung zwischen Wirtschaft und Pädagogik im Verständnis von THOMAS KURTZ vorgestellt sowie abschließend pädagogische Anknüpfpunkte mittels eines skizzierten Beispiels diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einführendes Beispiel und Fragestellung
- Der Weg zum modernen Beruf
- Systemtheoretische Konzeption des modernen Begriffes,Beruf
- Der moderne Stellenwert des Berufs aus Sicht der Gesellschaft
- Berufsbezogene Besonderheiten in der modernen Gesellschaft
- Der Beruf als strukturelle Kopplung von Ökonomie und Erziehung
- Diskussion um erzieherische Anknüpfungspunkte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des Berufs in der heutigen Zeit zu beleuchten und die strukturelle Kopplung von Bildung und Ökonomie im Kontext des modernen Berufs zu analysieren.
- Der historische Wandel des Berufsbegriffs
- Die systemtheoretische Perspektive auf den modernen Beruf
- Die Rolle des Berufs in der modernen Gesellschaft
- Die strukturelle Kopplung von Wirtschaft und Pädagogik im Hinblick auf den Beruf
- Pädagogische Anknüpfungspunkte im Zusammenhang mit dem modernen Beruf
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführendes Beispiel und Fragestellung
Dieses Kapitel stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor, die sich mit der Bedeutung des Berufs in der heutigen Zeit beschäftigt. Es wird ein Beispiel angeführt, das die Relevanz der Thematik verdeutlicht, und die Notwendigkeit eines Diskurses in der Allgemeinen Erziehungswissenschaft hervorgehoben.
2. Der Weg zum modernen Beruf
Dieses Kapitel zeichnet den historischen Weg des Berufsbegriffs nach, von der Antike bis zur modernen Gesellschaft. Es zeigt, wie der Beruf im Laufe der Zeit an Bedeutung gewonnen hat und welche Veränderungen im Verständnis von Arbeit stattgefunden haben.
3. Systemtheoretische Konzeption des modernen Begriffes,Beruf
Dieses Kapitel untersucht den Beruf aus einer systemtheoretischen Perspektive und beleuchtet den Stellenwert des Berufs in modernen Gesellschaften. Es werden die unterschiedlichen Bedeutungen des Berufs in verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereichen betrachtet und die Interpenetration bzw. strukturelle Kopplung von Wirtschaft und Pädagogik im Kontext des Berufs diskutiert.
4. Der Beruf als strukturelle Kopplung von Ökonomie und Erziehung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Wirtschaft und Pädagogik im Hinblick auf den Beruf. Es werden die Herausforderungen und Chancen aufgezeigt, die sich durch die strukturelle Kopplung dieser beiden Systeme ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Beruf, Bildung, Ökonomie, Gesellschaft, Systemtheorie, strukturelle Kopplung, Pädagogik, und der Rolle des Berufs in der modernen Gesellschaft.
- Quote paper
- David Wolf (Author), 2010, Der Beruf als strukturelle Kopplung zwischen Bildung und Ökonomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162254