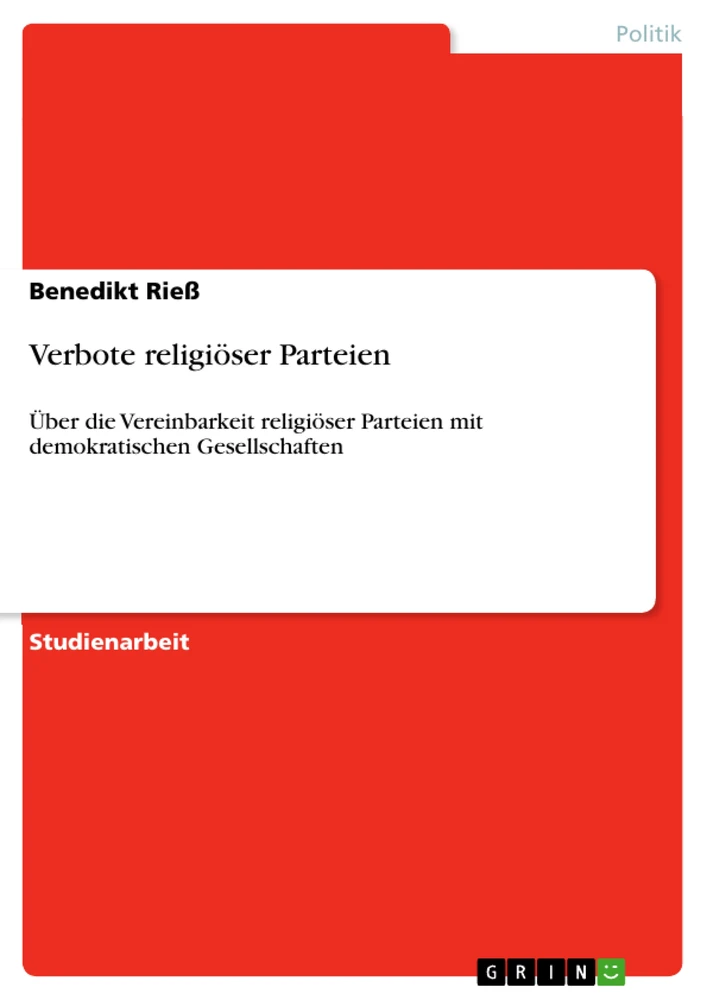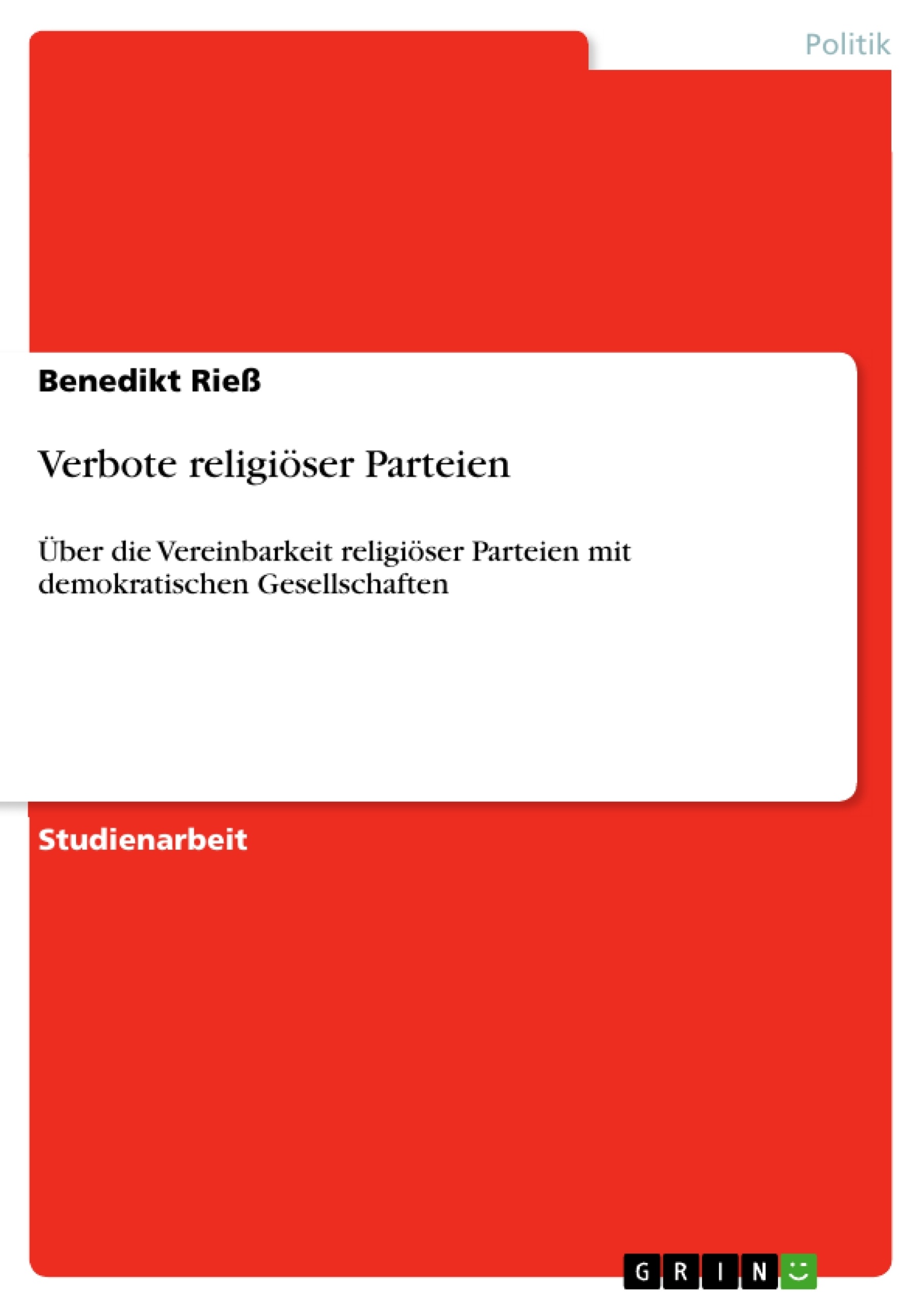Religiosität kann als eine askriptive Identität, analog zu Sprache, regionaler Herkunft, Rasse etc., gesehen werden. Askriptive Identitäten teilen die Eigenschaft, „sozial attribuiert und damit das Resultat von Selbst- sowie auch Fremdzuschreibung zu sein. Gleichzeitig sind sie zumeist durch die Geburt erlangt und nur schwer durch individuelle Entscheidung veränderbar.“ Religiöse Parteien thematisieren diese askriptive Identität; ob aus Überzeugung oder zur Abgrenzung zu anderen Parteien ist relativ irrelevant. Die Thematisierung der Religiosität birgt mitunter Gefahren für eine Demokratie, wie das Beispiel der Wohlfahrtspartei zeigt, die durch die Wiedereinführung der Scharia in der Türkei das Rechtsstaats- und das Laizismusprinzip hätte zersetzen können. Die vorliegende Arbeit will folglich untersuchen, ob religiöse Parteien mit einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft vereinbar sind. Im Folgenden wird nun zuerst die Problematik aufgezeigt, die durch eine Politisierung askriptiver Identität entstehen kann. Daraufhin wird erläutert, was partikularistische Parteien, zu denen religiöse Parteien zu zählen sind, ausmacht und auf welche Art und Weise diese verboten werden können. Anschließend werden denkbare, theoretisch mögliche Folgen eines Verbotes einer partikularistischen Partei dargelegt, woraufhin diese Überlegungen an empirischen Untersuchungen über partikularistische Parteienverbote im subsaharischen Afrika während der Redemokratisierung Anfang der 1990er gemessen werden. Abschließend wird versucht, anhand der Theorie der wehrhaften Demokratie eine Antwort auf die Frage zu finden, ob religiöse Parteien in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft zulässig sind oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung zum Thema...
- 2. Ethnische Identitäten und deren Politisierung.
- 3. Partikularistische Parteien.
- 4. Verbotsarten partikularistischer Parteien..
- 5. Denkbare Folgen partikularistischer Parteiverbote.......
- 6. Empirische Folgen partikularistischer Parteiverbote.
- 7. Wehrhafte Demokratie und religiöse Parteien......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob religiöse Parteien mit einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft vereinbar sind. Sie analysiert die Problematik der Politisierung askriptiver Identitäten, insbesondere in Bezug auf religiöse Parteien, und untersucht die möglichen Folgen von Verboten partikularistischer Parteien, zu denen auch religiöse Parteien zählen.
- Die Politisierung askriptiver Identitäten
- Die Charakteristika partikularistischer Parteien
- Die Folgen von Verboten partikularistischer Parteien
- Empirische Untersuchungen zu Parteiverboten
- Die Rolle der wehrhaften Demokratie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung zum Thema
Die Arbeit beginnt mit der Darstellung des aktuellen Verbots von Blasphemie in Irland und stellt die Frage nach der Einschränkung der Meinungsfreiheit zum Schutz des öffentlichen Friedens. Sie stellt die Problematik des demokratischen Dilemmas dar, die Frage, ob der demokratische Staat antidemokratische Kräfte bekämpfen darf, und führt zur Theorie der wehrhaften Demokratie. Am Beispiel der türkischen Wohlfahrtspartei wird aufgezeigt, wie religiöse Parteien eine Gefahr für die demokratische Ordnung darstellen können.
2. Ethnische Identitäten und deren Politisierung
Dieses Kapitel beleuchtet die Problematik der Politisierung ethnischer Identitäten, besonders in Bezug auf das subsaharische Afrika. Es wird auf die „künstlichen“ Landesgrenzen der Kolonialzeit und deren Folgen für die ethnische und kulturelle Vielfalt der Länder hingewiesen.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Themenfeldern religiöse Parteien, partikularistische Parteien, askriptive Identität, Demokratie, Wehrhafte Demokratie, Verbote, Laizismus und politische Partizipation. Sie analysiert die Folgen der Politisierung religiöser Zugehörigkeit und die Vereinbarkeit religiöser Parteien mit einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung.
Häufig gestellte Fragen
Sind religiöse Parteien mit einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft vereinbar?
Die Arbeit untersucht diese Frage kritisch und analysiert, ob die Thematisierung religiöser Identität eine Gefahr für den Rechtsstaat und das Laizismusprinzip darstellen kann.
Was ist eine askriptive Identität?
Askriptive Identitäten sind Merkmale wie Religion, Herkunft oder Rasse, die meist durch Geburt erlangt und schwer durch individuelle Entscheidungen veränderbar sind.
Was versteht man unter einer „wehrhaften Demokratie“?
Dieses Konzept beschreibt die Fähigkeit eines demokratischen Staates, sich gegen antidemokratische Kräfte zur Wehr zu setzen, die die freiheitliche Grundordnung untergraben wollen.
Welche Folgen kann das Verbot einer religiösen Partei haben?
Die Arbeit diskutiert theoretische und empirische Folgen, wie etwa Radikalisierung oder den Rückzug in den Untergrund, basierend auf Beispielen aus der Türkei und dem subsaharischen Afrika.
Warum wurde die türkische Wohlfahrtspartei als Beispiel angeführt?
Die Wohlfahrtspartei wird als Beispiel für eine religiöse Partei genannt, die durch Bestrebungen zur Wiedereinführung der Scharia die laizistische Grundordnung der Türkei gefährdete.
- Quote paper
- Benedikt Rieß (Author), 2009, Verbote religiöser Parteien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162259