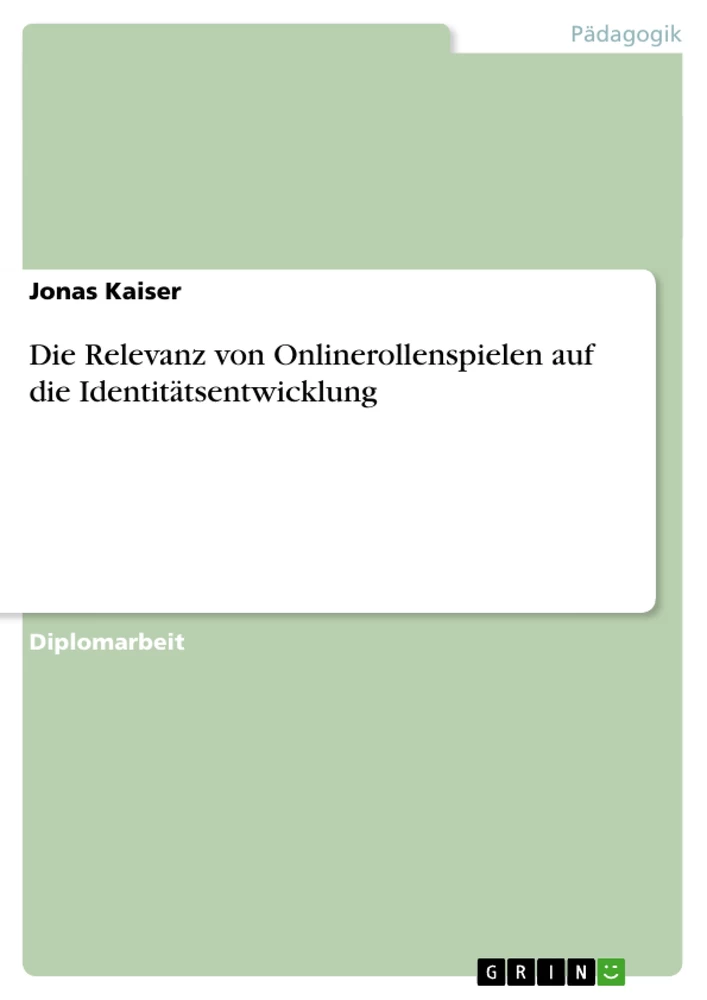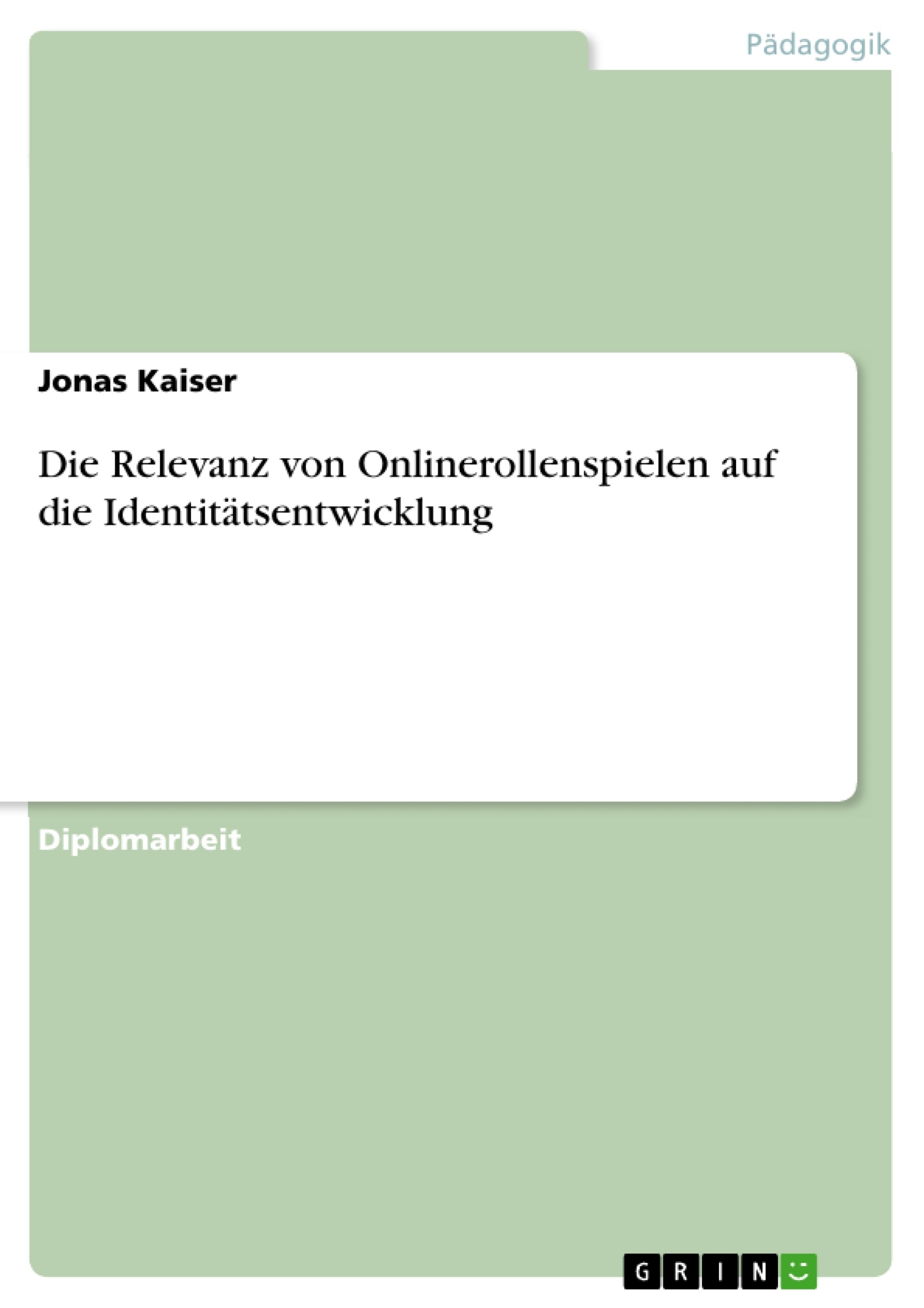Die Arbeit ist wie folgt strukturiert:
Im ersten Teil wird das Genre der virtuellen Rollenspiele vorgestellt und ein geschichtlicher Abriss ihrer Entwicklung skizziert, um deutlich zu machen, wie schnell sich das Rollenspiel in den letzten Jahren gewandelt und weiterentwickelt hat und wie groß der Zulauf zu diesen Spielen ist. Dabei wird auf Multible User Dungeons (MUDs) eingegangen, das Spiel Second Life beschrieben und ein tieferer Blick in das Spiel „World of Warcraft“ (WoW) gewagt, um die Strukturen der Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs) offen zu legen. Anhand dieses Spieles wird deutlich, wie schnell der Spieler gefesselt ist und wie diese Spiele zur Sucht führen können.
Anschließend wird dem Leser die Struktur und der Sinn von Gilden und anderen Netzgemeinschaften verdeutlicht. Gilden sind Spielervereinigungen innerhalb der Onlinespiele, die den Sog der Spiele noch verstärken, da sie bei den Beteiligten das Gefühl hervorrufen, sozial ausreichend integriert zu sein.
Im zweiten Teil wird, nach einer allgemeinen Einführung in die Identitätstheorien und ihre Entstehung sowie einer allgemeiner gefassten begrifflichen Klärung, dezidierter auf die interaktionistische Identitätstheorie eingegangen. Dabei wird gezeigt, dass Identitätsbildung in der Interaktion mit Anderen entsteht. Da MMORPGs so ausgelegt sind, dass Interaktion ein notwendiger Bestandteil der Spielbewältigung ist, ist diese Theorie sinnvoll für die Bearbeitung der Online-Spiele. Es wird daher in der Theorie vor allem auf die Faktoren eingegangen, die die Identitätsbildung und –veränderung im Austausch mit Anderen beeinflussen.
Im dritten Teil werden die Inhalte der vorangegangenen Teile gebündelt und es wird überprüft, ob identitätsbildende Faktoren innerhalb dieser Spielstrukturen existieren. Dabei werden die Faktoren herausgearbeitet, die den Sog des Spieles „World of Warcraft“ ausmachen. Abschließend wird die pathologische Seite dieses Soges – die Onlinesucht – skizziert.
Der vierte und letzte Teil wird die Ergebnisse zusammenfassen und offene Fragen formulieren.
Ein Anliegen dieser Arbeit ist es, einen Bereich darzustellen, der für viele Erzieher und Eltern nicht zu (be)greifen ist. Auch die Frage, ob innerhalb dieser Spiele Identität vor dem Hintergrund der menschlichen Bedürfnisse nach Anerkennung, Erfolg und Vergemeinschaftung entstehen kann, soll im Wesentlichen beantwortet werden, berücksichtigt jedoch nicht die konkreten Auswirkungen auf die Identität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Virtuelle Rollenspiele
- Das Pen & Paper-Rollenspiel
- Mit Multi-User-Dungeons (MUDs) fing alles an
- Life Sims - am Beispiel von Second Life
- Die Massively Multiplayer Online Role-Playing Games
- Geschichtlicher Abriss der MMORPG- Entwicklung
- Bonedwarf- ein tieferer Blick in die Welt von World of Warcraft
- Bevor es los ging
- Ingame
- Never ending story
- Gilden- die MMORPG- Familie
- Wer spielt in einer Gilde?
- Die Gildenstruktur
- Spielinterne Relevanz von Gilden
- Gemeinschaft innerhalb der Gilde
- Zeitbudget als Problem
- Identitätsbildung und Interaktion
- Identität - was ist unter diesem Begriff zu verstehen?
- Identitätswandel in der Postmodernen
- Interaktion und Identität
- Die Situation der Interaktion: der Rahmen
- Aufgaben des Individuums in der Interaktion
- Bedingung für Interaktion: eine gemeinsame Symbolik
- Interaktion in der Gruppe
- Interaktionsstrategien des Individuums
- Zusammenfassung
- Die virtuelle Welt als Bühne der Identitätsbildung
- Interaktion als identitätsstiftendes Merkmal
- Der Avatar als Gegenüber?
- Wie wird kommuniziert?
- Der Rahmen die Bühne der sinngerichteten Handlung
- Bedürfnisse
- Die Schattenseite der MMORPGS - die Abhängigkeit
- Schluss und offene Fragen
- Entwicklung und Geschichte virtueller Rollenspiele
- Die Bedeutung von Interaktion und Identität
- Identitätsbildung in virtuellen Welten
- Die Rolle von Gilden und Netzgemeinschaften
- Die potenziellen Gefahren und Suchtpotenziale von Onlinerollenspielen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Onlinerollenspielen auf die Identitätsbildung von Spielern. Sie will dem Leser einen aktuellen Überblick über virtuelle Spielräume und deren Auswirkungen auf junge Menschen verschaffen. Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und gleichzeitig bestehende Vorbehalte zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung der virtuellen Rollenspiele von den Anfängen des Pen & Paper-Rollenspiels bis hin zu den Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs). Im Fokus steht dabei die Entwicklung des Spiels "World of Warcraft" und die Erläuterung der Strukturen und Mechaniken dieses Spielgenres.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Frage der Identitätsbildung und der Rolle der Interaktion in diesem Prozess. Es werden verschiedene Identitätstheorien vorgestellt und die Interaktionistische Identitätstheorie wird im Detail erläutert. Dabei wird gezeigt, wie Interaktion mit anderen die Identitätsbildung und -veränderung beeinflussen kann.
Das dritte Kapitel untersucht, wie die in den vorherigen Kapiteln dargestellten Strukturen und Theorien auf die virtuelle Spielwelt anwendbar sind. Es wird herausgearbeitet, welche Faktoren den Sog von Onlinerollenspielen wie "World of Warcraft" ausmachen und wie diese Spiele die Identitätsbildung der Spieler beeinflussen können. Abschließend wird die potentielle Gefahr der Onlinesucht angesprochen.
Schlüsselwörter
Virtuelle Rollenspiele, MMORPG, Identität, Interaktion, Identitätsbildung, Gilden, Netzgemeinschaften, "World of Warcraft", Onlinesucht
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Onlinerollenspiele die Identitätsentwicklung?
Die Arbeit untersucht, wie Interaktion in virtuellen Welten und das Schlüpfen in verschiedene Avatare die Selbstwahrnehmung und soziale Identität prägen können.
Welche Bedeutung haben Gilden in MMORPGs?
Gilden fungieren als soziale Netzgemeinschaften, die Zugehörigkeit vermitteln, aber durch soziale Verpflichtungen auch den "Sog" des Spiels verstärken können.
Warum wird "World of Warcraft" (WoW) als Beispiel herangezogen?
WoW gilt als Prototyp für Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, an dem sich Spielmechaniken, Belohnungssysteme und Suchtpotenziale gut verdeutlichen lassen.
Was ist die interaktionistische Identitätstheorie?
Diese Theorie besagt, dass Identität primär durch den Austausch mit anderen entsteht – ein Prozess, der in MMORPGs durch ständige Kooperation essenziell ist.
Gibt es eine Schattenseite dieser virtuellen Welten?
Ja, die Arbeit thematisiert die Onlinesucht als pathologische Folge des Spielsogs und die Schwierigkeit, virtuelle Erfolge von der realen Lebenswelt zu trennen.
Können menschliche Bedürfnisse in Spielen befriedigt werden?
Die Arbeit prüft, ob Bedürfnisse nach Anerkennung, Erfolg und Vergemeinschaftung virtuell erfüllt werden können und welche Auswirkungen das hat.
- Quote paper
- Jonas Kaiser (Author), 2009, Die Relevanz von Onlinerollenspielen auf die Identitätsentwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162262