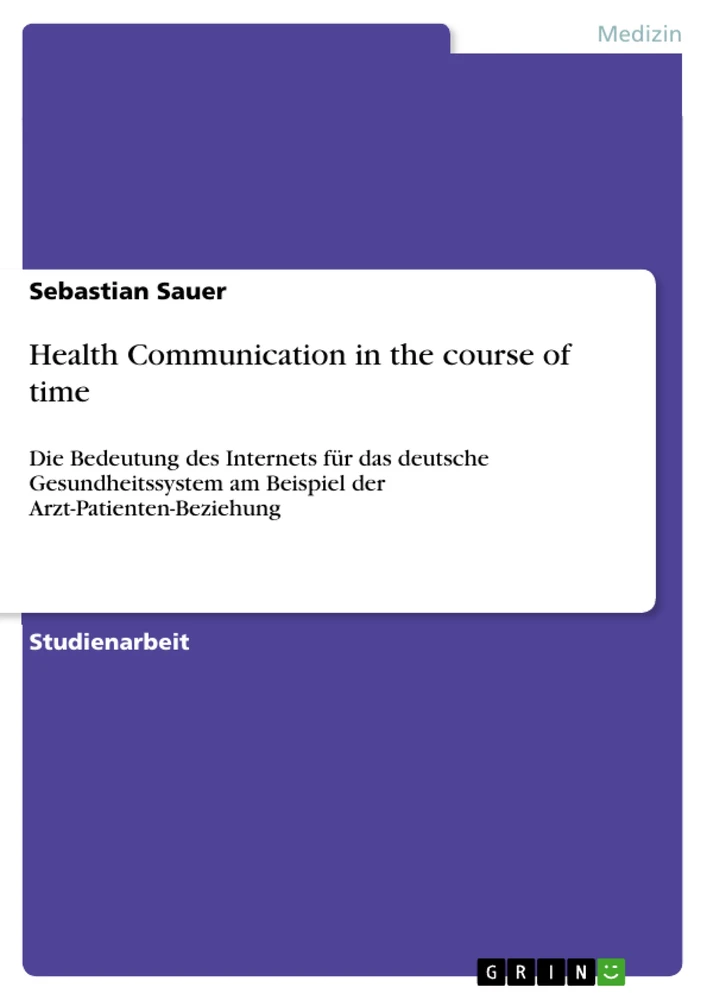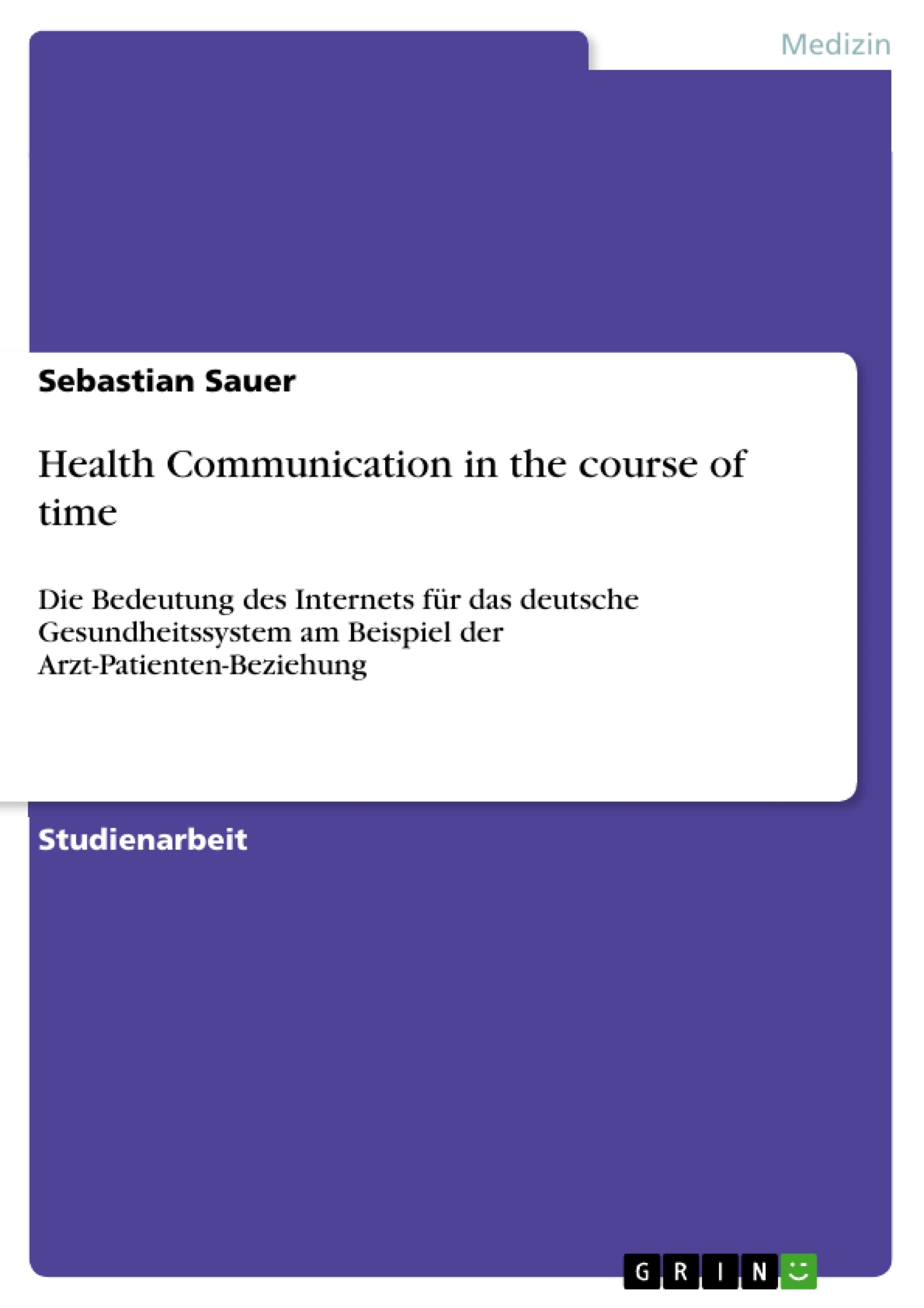Dem Faktor Patient, oder auch Nutzer des Gesundheitssystems, wird in der gesundheitlichen Versorgung eine immer wichtigere Rolle zugeschrieben. In Bezug auf eine immer älter werdende Bevölkerung (vgl. Eisenmenger et al. 2006), einer erhöhten Prävalenz von chronisch degenerativen Erkrankungen (vgl. Tautz 2002) und der Verbreitung von Gesundheitsinformationen über das Internet (vgl. Schmidt-Kaehler 2005) verändert sich infolgedessen auch immer mehr die Kommunikation innerhalb der Arzt-Patienten-Beziehung. Folglich ist dieses Thema aus Public-Health-Perspektive, besonders im Zusammenhang mit möglichen primärpräventiven Ansätzen, von enormer Bedeutung.
Inwieweit sich der Prozess der zunehmenden Informationsflut von Gesundheitsinformationen auf die Gesellschaft und insbesondere auf die Arzt-Patienten-Beziehung in Deutschland auswirkt, soll in dieser Arbeit evaluiert werden.
Hierzu wird im zweiten Kapitel eine kurze Einführung über die definitorische Grundlage von E-Health gegeben um ein fundamentales Verständnis der hier beschriebenen Thematik darzulegen. Im Anschluss (Kapitel 3) wird die Korrelation zwischen dem sich wandelndem Gesundheits- und Krankheiskonzept und der Kommunikation in der Arzt-Patienten-Beziehung erläutert und an einem Schaubild (Abbildung 2) dargestellt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Gesundheitskommunikation im Internet. Zu diesem Punkt werden die sozioökonomische Störfaktoren, die Vorteile versus Nachteile und die Qualitätsstandards ,der internetgestützten Gesundheitskommunikation, sowie der Stellenwert des Internets in der Gesellschaft diskutiert, um im Anschluss einen Experten-Ausblick auf das hier evaluierte Themenfeld zu geben (Kapitel 5). Abschließend (Kapitel 6) wird aus Public-Health-Perspektive ein Fazit abgegeben und ein möglicher Forschungsansatz, der die gegenwärtigen Dynamiken in Bezug auf die Arzt-Patienten-Beziehung, aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist E-Health?
- Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient vor dem Hintergrund sich wandelnder Gesundheits- und Krankheitskonzepte in der Gesellschaft
- Health Communication und das Internet
- Sozioökonomische Störfaktoren bei der Internetnutzung
- Stellenwert der Gesundheitskommunikation in der Gesellschaft
- Vor- versus Nachteile der Gesundheitskommunikation im Internet
- Wie können hochwertige Qualitätsstandards gewährleistet werden?
- Aussichten aufgrund der Delphi-Methode
- Zusammenfassung und Konsequenzen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung des Internets für das deutsche Gesundheitssystem, speziell im Kontext der Arzt-Patienten-Beziehung. Sie untersucht, wie die zunehmende Verfügbarkeit von Gesundheitsinformationen online die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten beeinflusst und welche Herausforderungen und Chancen sich daraus ergeben.
- Der Einfluss von E-Health auf das Gesundheitssystem
- Die sich wandelnde Rolle des Patienten in der Arzt-Patienten-Beziehung
- Sozioökonomische Aspekte der Internetnutzung und ihre Relevanz für die Gesundheitskommunikation
- Die Bedeutung von Qualitätsstandards für Gesundheitsinformationen im Internet
- Die Chancen und Risiken der internetgestützten Gesundheitskommunikation für die Prävention und Gesundheitsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 gibt eine Definition von E-Health und zeigt die Bedeutung des Internets für die Gesundheitsversorgung auf. Kapitel 3 beschreibt die Entwicklung der Arzt-Patienten-Beziehung vor dem Hintergrund sich verändernder Gesundheits- und Krankheitskonzepte. Kapitel 4 widmet sich der Gesundheitskommunikation im Internet, analysiert sozioökonomische Störfaktoren, diskutiert Vor- und Nachteile sowie Qualitätsstandards und zeigt den Stellenwert des Internets in der Gesellschaft auf. Kapitel 5 beleuchtet die Experten-Aussichten zur Entwicklung der Arzt-Patienten-Beziehung im Kontext des Internets.
Schlüsselwörter
E-Health, Gesundheitskommunikation, Arzt-Patienten-Beziehung, Internetnutzung, Sozioökonomische Faktoren, Qualitätsstandards, Prävention, Gesundheitsförderung, Empowerment, Patienten-Autonomie, Delphi-Methode.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert E-Health die Arzt-Patienten-Beziehung?
Durch die Informationsflut im Internet wandelt sich der Patient vom passiven Empfänger zum informierten Nutzer, was die Kommunikation auf Augenhöhe (Empowerment) fördert.
Welche Vorteile bietet die Gesundheitskommunikation im Internet?
Vorteile sind der schnelle Zugang zu medizinischem Wissen, die Unterstützung bei chronischen Krankheiten und Möglichkeiten zur Primärprävention.
Was sind sozioökonomische Störfaktoren bei E-Health?
Unterschiede im Zugang zum Internet und in der Medienkompetenz (Digital Divide) können dazu führen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligt werden.
Wie kann die Qualität von Online-Gesundheitsinformationen gesichert werden?
Die Arbeit diskutiert die Notwendigkeit von Qualitätsstandards und Zertifizierungen, um verlässliche von irreführenden Informationen zu unterscheiden.
Was ist die Delphi-Methode im Kontext dieser Arbeit?
Sie wird genutzt, um Expertenmeinungen über zukünftige Entwicklungen in der Gesundheitskommunikation und der Arzt-Patienten-Interaktion einzuholen.
- Quote paper
- B.A. PH Sebastian Sauer (Author), 2007, Health Communication in the course of time, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162285