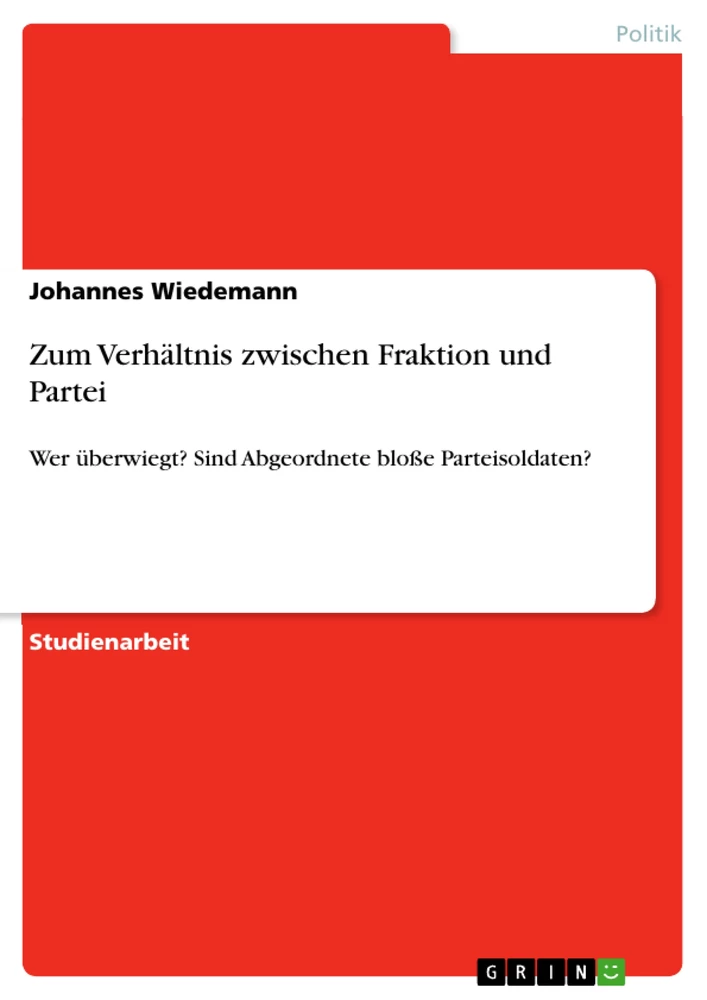Nach der Hessenwahl 2008 konnte man in der Presse- und Medienöffentlichkeit besichtigen, wie Dagmar Metzger, Abgeordnete der SPD-Fraktion im hessischen Landtag, partei- und fraktionsintern unter Druck geriet, weil sie sich weigerte, ihre Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti gemeinsam mit den Stimmen der Fraktion der Partei DIE LINKE zu wählen. Sie glaubte, es mit ihrem Gewissen als gebürtige West-Berlinerin nicht vereinbaren zu können, mit einer SED-Nachfolgepartei zu koalieren. Aber obwohl der Vorwurf an die SPD, das Wahlversprechen der Nicht-Zusammenarbeit mit DIE LINKE brechen zu wollen, medial am präsentesten war und damit Legitimation erhielt, berief sich Dagmar Metzger stets auf ihre individuelle Gewissensdisposition. Gleichzeitig wurde die
Politikerin in den Leitmedien als vorbildliche Volksvertreterin gefeiert, deren Beispiel in allen Parlamenten Schule machen sollte, um die Abgeordnetenfreiheit wieder herzustellen.Wird der deutsche Abgeordnete also von seiner Partei und Fraktion unangemessen in seiner Tätigkeit beeinflusst? Gibt es überhaupt reale Beschneidungen des Handlungsspielraums? Die Fragestellung soll zudem dem Phänomen nachzuspüren, auf dessen Grundlage die Sichtweisen Nahrung finden, dass a) Mandatsträger und ihre Tätigkeit nicht dem Bild entsprechen, welches wir uns vermeintlich gemäß der Verfassung von ihnen zu machen hätten, und b)Abgeordnete in Deutschland nur Anhängsel der Parteien wären, die regelmäßig ihre verfassungsgemäßen Kompetenzen überschreitender Vereinigungen sind. Am Anfang wird hierbei die kulturhistorische Darstellung der Entstehung einer Repräsentationskonzeption ausfallen, die nach wie vor die Wahrnehmung in Medien und Öffentlichkeit in Bezug auf deutsche Abgeordneten bestimmt: Die klassischliberale Repräsentationstheorie. Einer Skizze der bundesrepublikanischen Verfassungsgeschichte schließt sich die Beschreibung des Berufbildes Abgeordneter in formeller und informeller Hinsicht an. Dazu wurden persönliche Gespräche mit fünf norddeutschen Abgeordneten des Bundestages geführt, die jeweils einer der Fraktionen im Parlament angehören. Anschließend erfolgt eine Kritik an der Kritik von konservativ-liberaler Seite an der Parteiendemokratie BRD. Mit den Schlussfolgerungen zur Fragestellung werden die
betrachteten Aspekte gewichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abgeordnete in Vormärz und Paulskirchen-Verfassung
- Der Abgeordnete als Vertreter der klassisch-liberalen Bürgergesellschaft im Vormärz
- Parlamentarische Großorganisation Paulskirche: Notwendigkeit der Fraktionsbildung
- Folgen des Widerspruchs von parlamentarischer Praxis und klassisch-liberaler Theorie
- Konzeption von Abgeordneten und Fraktion im Grundgesetz durch den Parlamentarischen Rat
- Die Weimarer Reichsverfassung: Negativbeispiel des Parlamentarismus für das Grundgesetz
- Leitbild des Parlamentarischen Rates für den Parlamentarismus im Grundgesetzes
- Berufsbild(er) Abgeordnete/r: Vielfalt der Aufgaben und Funktionen in Partei und Fraktion
- Die formelle und informelle Position der Abgeordneten des Deutschen Bundestages
- Wahlkreiskönig, Parteisoldat oder Parlamentsstar? Selbstverortung norddeutscher Bundestagsabgeordneter
- Selbstverständnis der Volksvertreter
- Verhältnis des einzelnen Abgeordneten zur Partei
- Stellung des einzelnen Abgeordneten in der Fraktion
- Kritik an Geschlossenheit von Fraktion und Partei: Analyse einer Fehlinterpretation
- Ursprünge und Beispiele klassisch-liberalen Kritik an der Parteiendemokratie
- Das Missverständnis der klassisch-liberalen Repräsentationstheorie in Bezug auf die Verfassungsrealität in der Bundesrepublik Deutschland
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Fraktion und Partei im deutschen Bundestag. Sie untersucht, inwiefern Abgeordnete in ihrer Arbeit durch die Partei und die Fraktion beeinflusst werden und welches Gewicht diese Faktoren haben. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung der Abgeordnetenrolle, insbesondere im Kontext der klassisch-liberalen Repräsentationstheorie, und beleuchtet die aktuelle Situation anhand von Interviews mit norddeutschen Bundestagsabgeordneten.
- Das Verhältnis zwischen Abgeordneten, Fraktion und Partei in der Bundesrepublik Deutschland
- Die Entwicklung der Abgeordnetenrolle im historischen Kontext
- Die Rolle der klassisch-liberalen Repräsentationstheorie in der politischen Praxis
- Die Bedeutung der Fraktion als Organisationseinheit im Parlament
- Der Handlungsspielraum von Abgeordneten im Spannungsfeld von Partei, Fraktion und Wählerwillen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit behandelt die Frage, ob und wie Abgeordnete in Deutschland durch ihre Partei und Fraktion in ihrer Arbeit beeinflusst werden und welche Faktoren dabei das größere Gewicht haben.
- Abgeordnete in Vormärz und Paulskirchen-Verfassung: Die Arbeit analysiert die Entstehung des Abgeordnetenmandats im Kontext der klassisch-liberalen Repräsentationstheorie und die Entwicklung der Fraktionen im ersten gesamtdeutschen Parlament (Paulskirche).
- Konzeption von Abgeordneten und Fraktion im Grundgesetz durch den Parlamentarischen Rat: Die Arbeit beschreibt die verfassungsrechtliche Grundlage des Abgeordnetenmandats in der Bundesrepublik Deutschland und die Rolle des Parlamentarischen Rates bei der Gestaltung des Grundgesetzes.
- Berufsbild(er) Abgeordnete/r: Vielfalt der Aufgaben und Funktionen in Partei und Fraktion: Die Arbeit untersucht die verschiedenen Aufgaben und Funktionen von Abgeordneten im Deutschen Bundestag und analysiert die Selbstwahrnehmung von Abgeordneten in Bezug auf Partei und Fraktion.
- Kritik an Geschlossenheit von Fraktion und Partei: Analyse einer Fehlinterpretation: Die Arbeit setzt sich mit klassisch-liberaler Kritik an der Parteiendemokratie auseinander und beleuchtet die vermeintliche Diskrepanz zwischen der klassisch-liberalen Repräsentationstheorie und der politischen Realität in der Bundesrepublik Deutschland.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Abgeordneten, Fraktion und Partei im Deutschen Bundestag. Zentral sind dabei Themen wie die klassische Repräsentationstheorie, die Bedeutung der Fraktionen im Parlament, die Selbstwahrnehmung von Abgeordneten und die Kritik an der Parteiendemokratie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernproblem im Verhältnis zwischen Fraktion und Partei?
Die Arbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen der verfassungsrechtlich garantierten Freiheit des Abgeordneten (freies Mandat) und dem faktischen Druck durch Partei- und Fraktionsdisziplin.
Welcher prominente Fall dient als Einleitung für die Thematik?
Der Fall von Dagmar Metzger (SPD Hessen 2008), die sich aus Gewissensgründen weigerte, Andrea Ypsilanti mit Stimmen der Linkspartei zu wählen und dadurch massiv unter Druck geriet.
Welche Rolle spielt die klassisch-liberale Repräsentationstheorie?
Sie bildet das Idealbild des Abgeordneten, das oft im Widerspruch zur realen Parteiendemokratie der Bundesrepublik Deutschland steht, in der Abgeordnete oft als "Anhängsel" der Parteien wahrgenommen werden.
Wie veränderte sich die Rolle der Fraktionen historisch?
Von der Paulskirchen-Verfassung über die Weimarer Reichsverfassung bis zum Grundgesetz wurde die Fraktionsbildung als organisatorische Notwendigkeit im Parlament zunehmend professionalisiert.
Welche empirische Grundlage nutzt die Arbeit?
Es wurden persönliche Gespräche mit fünf norddeutschen Bundestagsabgeordneten geführt, um deren Selbstverständnis zwischen Wahlkreis, Partei und Fraktion zu analysieren.
Was wird an der Kritik zur Parteiendemokratie bemängelt?
Die Arbeit analysiert, ob die klassisch-liberale Kritik an der Geschlossenheit von Fraktionen auf einem Missverständnis der Verfassungsrealität beruht.
- Arbeit zitieren
- Johannes Wiedemann (Autor:in), 2008, Zum Verhältnis zwischen Fraktion und Partei, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162292