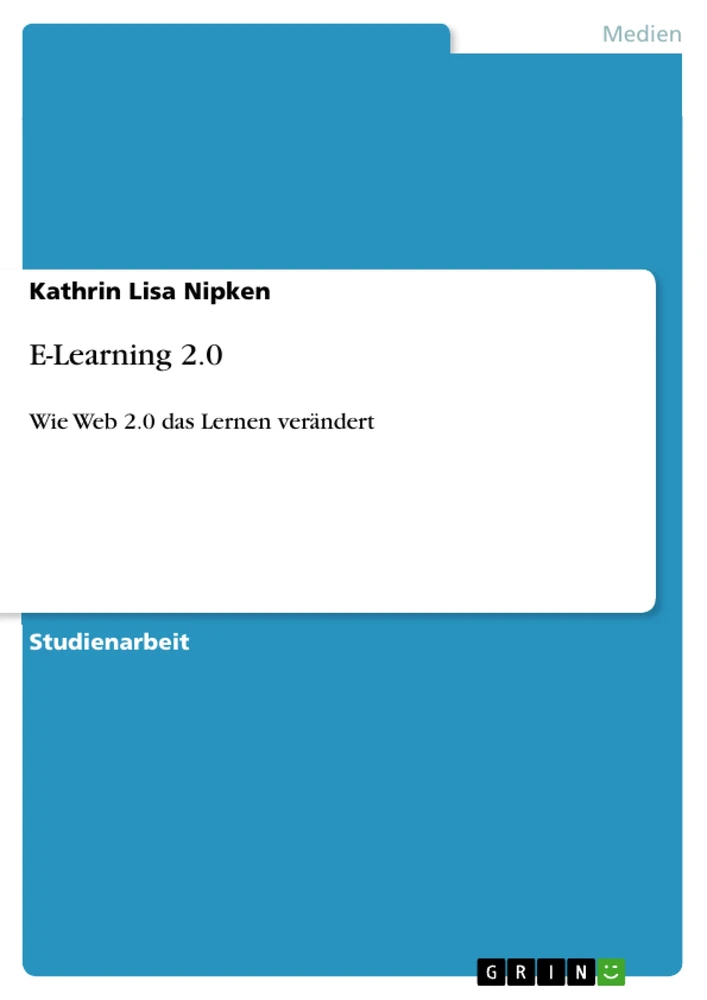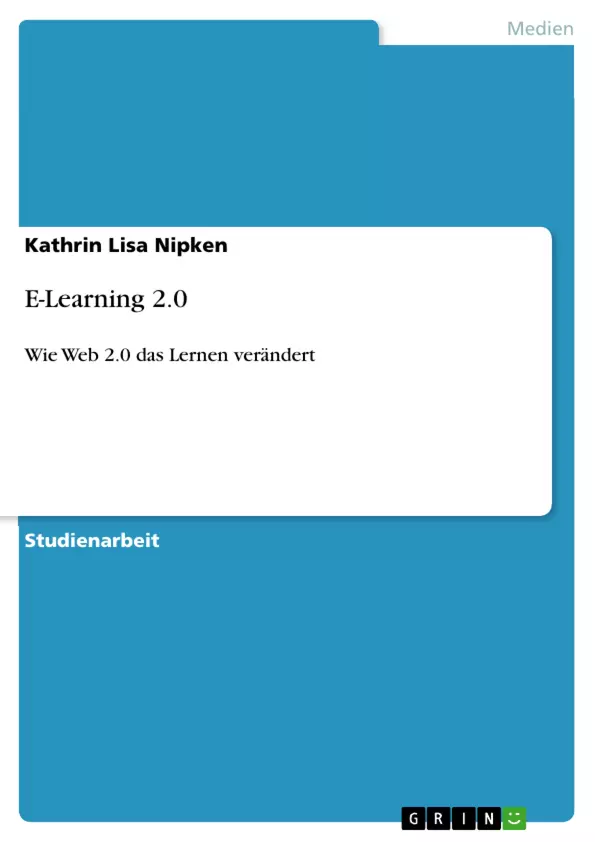Mit Nutzerzahlen von weltweit mehreren hundert Millionen täglich hat das Web 2.0 das Internet endgültig zum „Medium der Massen“ werden lassen. Und es beginnt, die Welt außerhalb des Netzes nachhaltig zu beeinflussen, ja zu verändern. Die technologischen Entwicklungen haben zu einem gesellschaftlichen Wandel geführt und das allgemeine
Lernverhalten verändert. In heutiger Zeit rückt das Lernen ins Zentrum des menschlichen Lebens und beschränkt sich nicht mehr auf wenige Jahre in der Schule oder Ausbildung, sondern wird zu einem lebenslangen Prozess. Ein Teil dieses Wandels lässt sich mit Hilfe des Buzzwortes „Web 2.0“ erklären. Die damit verbundenen Veränderungen der Internet-Nutzungsgewohnheiten und die Anwendung dieser auf den Bildungsbereich machten E-Learning zu E-Learning 2.0. Intention dieser Arbeit ist es diese Entwicklung, wie Web 2.0 das Lernen in der heutigen Gesellschaft verändert hat, anhand dem Beispiel des Personal Learning Environment darzustellen und zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Medientheoretischer Rahmen
- Medienbegriff
- Medienkompetenz
- Lerntheoretischer Rahmen
- Konnektivismus - Abgrenzung zu bisherigen Ansätzen
- Grundprinzipen des Konnektivismus
- Web 2.0
- Was ist Web 2.0?
- Veränderung durch Web 2.0
- E-Learning 2.0
- Begriffserklärung
- Einsatz von Web 2.0-Anwendungen im Lernprozess
- Online Communicating
- Social Networking
- Social Collaborating
- Social Publishing
- Hybrids
- Verändertes Lernen durch Web 2.0
- Personal Learning Environment (PLE)
- Gestaltung eines eigenen PLE
- Inhaltliche Kriterien
- Umsetzung
- Medienkompetenz 2.0?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Veränderung des Lernens durch Web 2.0 am Beispiel des Personal Learning Environment. Dabei werden die theoretischen Rahmenbedingungen des Medienbegriffs, der Medienkompetenz sowie des Konnektivismus erläutert. Die Arbeit analysiert den Wandel der Internet-Nutzungsgewohnheiten und die damit verbundenen Einsatzmöglichkeiten von E-Learning 2.0-Anwendungen im Lernprozess.
- Der Einfluss von Web 2.0 auf das Lernen
- Die Entwicklung des Personal Learning Environment (PLE)
- Die Bedeutung von Medienkompetenz in der digitalen Welt
- Der Vergleich von traditionellen und webbasierten Lerntheorien
- Die Integration von Web 2.0-Anwendungen im Bildungsbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Wandel des Lernens im Kontext von Web 2.0 beschreibt und die Zielsetzung der Arbeit darlegt.
Im ersten Teil werden die medientheoretischen Grundlagen erläutert, indem der Medienbegriff im Allgemeinen und die Medienkompetenz als Schlüsselkompetenz der digitalen Gesellschaft behandelt werden.
Der zweite Teil widmet sich dem lerntheoretischen Rahmen und stellt den Konnektivismus als aktuellen Ansatz für das „Lernen im digitalen Zeitalter“ vor.
Kapitel vier beleuchtet das Phänomen Web 2.0 und die damit verbundenen Veränderungen der Internet-Nutzungsgewohnheiten.
Kapitel fünf befasst sich mit dem E-Learning 2.0 und den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Web 2.0-Anwendungen im Lernprozess.
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit den Veränderungen des Lernverhaltens durch Web 2.0 und fokussiert dabei auf das Konzept des Personal Learning Environment.
Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und in einem Fazit bewertet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich den zentralen Themenfeldern der digitalen Bildung, des E-Learning 2.0, des Personal Learning Environment, der Medienkompetenz und des Konnektivismus. Weitere zentrale Begriffe sind Web 2.0, Online-Kommunikation, Social Media, Social Networking, Social Collaboration und Hybrid-Lernumgebungen.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet E-Learning 2.0 vom klassischen E-Learning?
E-Learning 2.0 nutzt Web 2.0-Anwendungen für soziale Interaktion, Kollaboration und vernetztes Lernen, anstatt nur digital aufbereitetes Wissen konsumierbar zu machen.
Was ist ein Personal Learning Environment (PLE)?
Ein PLE ist eine individuell zusammengestellte Lernumgebung aus verschiedenen digitalen Tools und Quellen, die lebenslanges und selbstgesteuertes Lernen unterstützt.
Welche Rolle spielt der Konnektivismus beim Lernen im digitalen Zeitalter?
Der Konnektivismus besagt, dass Lernen ein Prozess des Vernetzens von Informationsknoten ist und Wissen in Netzwerken (Menschen + Technologie) verteilt liegt.
Was versteht man unter Medienkompetenz 2.0?
Es umfasst die Fähigkeit, aktiv an sozialen Netzwerken teilzunehmen, Inhalte kollaborativ zu erstellen und Informationen im Web 2.0 kritisch zu bewerten.
Wie verändern Social Media Anwendungen den Lernprozess?
Sie ermöglichen Social Networking, Social Publishing und Social Collaboration, wodurch Lernen zu einem gemeinschaftlichen und kontinuierlichen Austausch wird.
- Quote paper
- Kathrin Lisa Nipken (Author), 2010, E-Learning 2.0, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162327