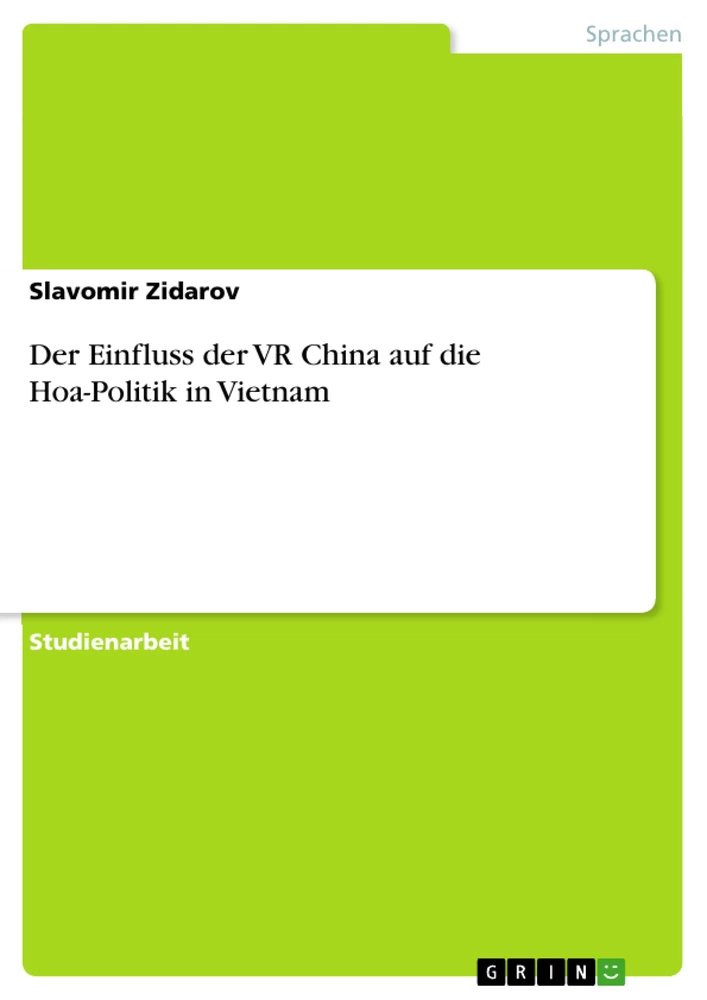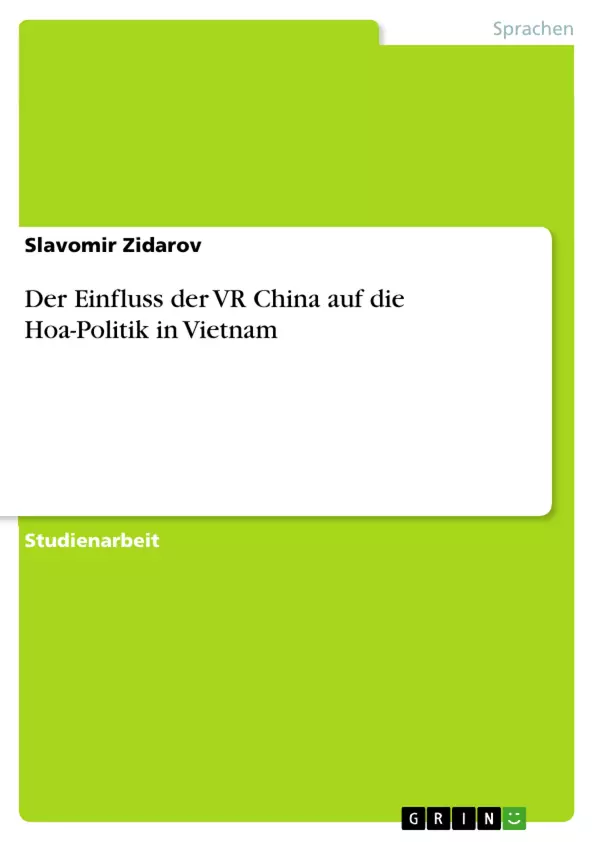Eine der wichtigsten Entwicklungen im südostasiatischen Raum in den letzten dreißig Jahren ist ohne Zweifel die Initiierung der Reform- und Öffnungspolitik in der VR China und die damit verbundene Aufwertung ihrer Stellung im regionalen Kontext. Eine direkte Folge der erfolgreichen Implementierung diverser wirtschaftspolitischer Maßnahmen im Rahmen dieser Entwicklungsstrategie war der beeindruckende ökonomische Aufschwung, den die VRCh seitdem erfahren hat. Gleichzeitig hat dieser aber eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Rolle, die die aufkommende Regionalmacht einnehmen und der Art und Weise in der sie ihren neugewonnenen Einfluss einsetzen wird, zur Folge gehabt. Eine Erscheinungsform dieser Unsicherheit manifestiert sich im Konzept von Greater China. Der geographische Deckungsbereich dieses Begriffs, dem eine gewisse expansionistische Note nicht gänzlich abgesprochen werden kann, lässt sich je nach Kontextualisierung – politische, wirtschaftliche oder kulturelle – unterschiedlich definieren. Wenn der kulturelle Aspekt zugrunde gelegt wird, so erstreckt sich Greater China über weite Gebiete in Südostasien und beinhaltet die Komponente der Überseechinesen als wesentlicher Bestandteil des Konzepts.
Die Beziehungen zwischen der dominanten Mehrheitsethnie im jeweiligen Land seit der in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts begonnenen Unabhängigkeitswelle in der Region,und der chinesischen Minderheit werden durch die historischen Erfahrungen beider Seiten und durch die Wahrnehmung, bzw. Interpretation dieser Erfahrungen bestimmt und führen nicht selten zu teilweise sehr problematischen Auseinandersetzungen zwischen ihnen. Als Beispiele hierfür können hier die Pogrome gegen ethnische Chinesen in Indonesien und den Philippinen angeführt werden. Während solche Ausbrüche in den meisten Fällen auf ethnisch begründete Feindseligkeit oder ökonomische Verteilungskonflikte zurückzuführen sind, bildet die Sozialistische Republik Vietnam (SRV) eine klare Ausnahme im südostasiatischen Raum. Im Gegensatz zu den bereits genannten Beispielen, spielen hier geostrategische – eine gemeinsame Grenze – und geopolitische Faktoren, die sich mit dem eminenten Einfluss der VR China zusammenfassen lassen, eine übergeordnete Rolle bei der Politikfindung bezüglich der ethnischen Chinesen in Vietnam (Hoa Kieu). Ein wesentliches Merkmal dieses Prozesses bilden die Schwankungen zwischen einer überwiegend auf die Assimilation der ethnischen Minderheit in die gesellschaftliche...
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I. 1 Fragestellung
- I. 2 Aufbau der Arbeit
- II. Assimilation vs. Accommodation - theoretische Vorüberlegungen
- II. 1 Assimilation
- II. 2 Anpassung
- III. Untersuchungsphasen
- IV. Die VR China als Bestimmungsfaktor für die Hoa – Politik in Vietnam
- IV. 1 Kolonialzeit (1867-1954)
- IV. 2 Staatsteilung (1954 – 1975)
- IV. 2. 1 Die Republik Vietnam
- IV. 2. 2 Die Demokratische Republik Vietnam
- IV. 3 Wiedervereinigung (1975 – heute)
- IV. 3. 1 Exodus
- IV. 3. 2 Nach Doi Moi
- V. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen der „Pendelpolitik“ der vietnamesischen Regierung gegenüber den ethnischen Chinesen in Vietnam (Hoa Kieu) und analysiert die Faktoren, die zu dieser Politik geführt haben. Dabei werden interne und externe Faktoren betrachtet, wobei der Fokus auf dem Einfluss der VR China liegt. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die VR China die Hoa-Politik beeinflusst hat und welche Formen dieser Einflussnahme es gab. Darüber hinaus wird untersucht, ob Änderungen in der Hoa-Politik direkt auf Handlungen der chinesischen Regierung oder Ereignisse in der VR China zurückzuführen sind.
- Die Rolle der VR China in der Hoa-Politik
- Die Unterschiede zwischen Assimilation und Anpassung als integrationspolitische Strategien
- Die historischen Phasen der Beziehungen zwischen Vietnam und China
- Die innen- und außenpolitischen Faktoren, die die Hoa-Politik beeinflussen
- Die geostrategischen und geopolitischen Dimensionen der Beziehungen zwischen Vietnam und China
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit vor. Kapitel II diskutiert die theoretischen Grundlagen der Assimilation und Anpassung als integrationspolitische Strategien. Kapitel III definiert den Untersuchungszeitraum und gliedert ihn in einzelne Phasen. Kapitel IV analysiert die Zusammenhänge zwischen der VR China und der Hoa-Politik der vietnamesischen Regierung in den einzelnen Phasen. Kapitel V bietet eine Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Hoa-Politik, VR China, Assimilation, Anpassung, Vietnam, Greater China, Überseechinesen, geostrategische Faktoren, geopolitische Faktoren, interne und externe Einflüsse.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die „Hoa“ in Vietnam?
Die „Hoa“ (oder Hoa Kieu) sind die ethnische chinesische Minderheit, die in Vietnam lebt.
Wie beeinflusst die VR China die vietnamesische Politik gegenüber den Hoa?
Geopolitische Spannungen oder Annäherungen zwischen Vietnam und China führen oft zu Schwankungen (Pendelpolitik) zwischen Assimilationsdruck und Anpassung der Minderheit.
Was versteht man unter dem Konzept „Greater China“?
Es beschreibt den wirtschaftlichen und kulturellen Einflussbereich Chinas, der auch die Überseechinesen in Südostasien als wesentlichen Bestandteil einschließt.
Was geschah während des Exodus der Hoa nach 1975?
Nach der Wiedervereinigung Vietnams und Spannungen mit China flohen Hunderttausende ethnische Chinesen aus Vietnam, oft als sogenannte „Boat People“.
Wie hat sich die Situation nach der „Doi Moi“-Reform verändert?
Mit der wirtschaftlichen Öffnung Vietnams (Doi Moi) verbesserte sich die Lage der Hoa wieder, da sie eine wichtige Rolle als wirtschaftliche Brücke zu China und anderen Regionen spielen.
- Citation du texte
- Slavomir Zidarov (Auteur), 2009, Der Einfluss der VR China auf die Hoa-Politik in Vietnam, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162356