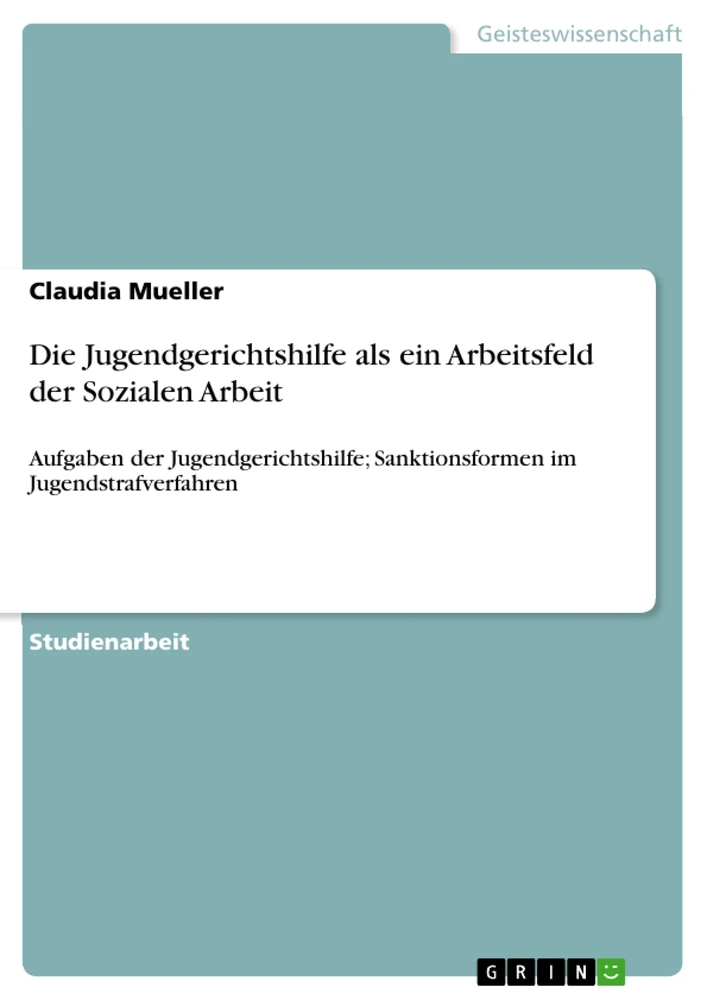Es gibt keine Institution in der Sozialen Arbeit, die mit derart widersprüchlichen Aufgaben und Erwartungen konfrontiert wird, wie die Jugendgerichtshilfe (JGH). Sie soll im Jugendstrafverfahren als Gerichtshilfe gegen straffällige Jugendliche und Heranwachsende ermitteln, berichten und überwachen. Durch verschiedene Angebote soll sie zugleich als Jugendhilfe zu einer Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Straffälligen beitragen.
In der hier vorliegenden Arbeit werden neben den Aufgaben der Jugendgerichtshilfe als Hauptaugenmerk die verschiedenen Sanktionsformen, die im Jugendstrafverfahren zur Anwendung kommen, aufgezeigt – wovon einige am Ende der Arbeit anhand eines Fallbeispiels nochmals dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Aufgaben der Jugendgerichtshilfe
- 1.1 Ermittlungshilfe
- 1.2 Berichtshilfe
- 1.3 Sanktionsüberwachung
- 1.4 Betreuung
- 2 Sanktionsformen
- 2.1 Erziehungsmaßregeln
- 2.1.1 Weisungen
- 2.1.1.1 Täter – Opfer – Ausgleich
- 2.1.1.2 Sozialer Trainingskurs
- 2.1.2 Hilfen zur Erziehung
- 2.2 Zuchtmittel
- 2.2.1 Verwarnung
- 2.2.2 Auflagen
- 2.2.3 Jugendarrest
- 3 Die Jugendgerichtshilfe im Fall Familie Meyer
- 4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Arbeitsfeld der Jugendgerichtshilfe (JGH). Die Arbeit beleuchtet die vielschichtigen Aufgaben der JGH, fokussiert auf die verschiedenen Sanktionsformen im Jugendstrafverfahren und illustriert diese anhand eines Fallbeispiels. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Rolle und der Herausforderungen der JGH zu vermitteln.
- Aufgaben der Jugendgerichtshilfe im Jugendstrafverfahren
- Verschiedene Sanktionsformen (Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel)
- Zusammenspiel von Gerichtshilfe und Jugendhilfe
- Fallbeispiel zur Veranschaulichung der Praxis
- Herausforderungen und Spannungsfelder im Arbeitsfeld der JGH
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die widersprüchlichen Aufgaben und Erwartungen an die Jugendgerichtshilfe (JGH): Sie soll sowohl als Gerichtshilfe im Jugendstrafverfahren ermitteln, berichten und überwachen, als auch als Jugendhilfe die Entwicklung straffälliger Jugendlicher fördern. Die Arbeit konzentriert sich auf die Aufgaben der JGH und die verschiedenen Sanktionsformen im Jugendstrafverfahren, die am Ende anhand eines Fallbeispiels verdeutlicht werden.
1 Aufgaben der Jugendgerichtshilfe: Dieses Kapitel beschreibt die zentralen Aufgaben der JGH gemäß § 38 JGG. Die JGH unterstützt Gericht und Ermittlungsbehörden und hilft gleichzeitig dem Beschuldigten. Die Aufgaben umfassen die Ermittlungshilfe (Erforschung der Täterpersönlichkeit zur Wahl der richtigen Sanktion), die Berichtshilfe (Erstellung eines Berichts für das Gericht), die Sanktionsüberwachung (Kontrolle der Einhaltung richterlicher Weisungen und Auflagen) und die Betreuung des Jugendlichen (Beratung, Begleitung und Unterstützung).
2 Sanktionsformen: Dieses Kapitel erläutert die verschiedenen Sanktionsformen im Jugendstrafverfahren, insbesondere Erziehungsmaßregeln (Weisungen, wie z.B. Täter-Opfer-Ausgleich und soziale Trainingskurse; Hilfen zur Erziehung) und Zuchtmittel (Verwarnung, Auflagen, Jugendarrest). Es wird detailliert auf die jeweiligen Maßnahmen eingegangen und deren erzieherischer Zweck sowie ihre Anwendung in der Praxis beschrieben. Der Jugendarrest wird als umstrittene Maßnahme dargestellt, deren Anwendung aufgrund der Entwicklung innovativerer Sanktionsformen zurückgegangen ist.
3 Die Jugendgerichtshilfe im Fall Familie Meyer: Dieses Kapitel präsentiert ein fiktives Fallbeispiel (Familie Meyer), welches die verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen der JGH veranschaulicht. Es zeigt den Verlauf der Fälle des Jugendlichen Kent Meyer, beginnend mit einer Verwarnung und eskalierend bis hin zum Ungehorsamsarrest. Der Fall verdeutlicht die Komplexität der Situation und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes, der sowohl die Bedürfnisse des Jugendlichen als auch die Anforderungen der Justiz berücksichtigt. Die Jugendgerichtshilfe unterstützt die Familie Meyer schließlich bei der Inanspruchnahme eines Erziehungsbeistands.
Schlüsselwörter
Jugendgerichtshilfe, Jugendstrafrecht, Sanktionen, Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel, Täter-Opfer-Ausgleich, Sozialer Trainingskurs, Hilfen zur Erziehung, Jugendarrest, Betreuung, Gerichtshilfe, Jugendhilfe, Fallbeispiel, Kooperation, Ungehorsamsarrest, Wiedereingliederung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Jugendgerichtshilfe
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Jugendgerichtshilfe (JGH). Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf den Aufgaben der JGH im Jugendstrafverfahren, den verschiedenen Sanktionsformen (Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel) und der Veranschaulichung dieser anhand eines Fallbeispiels.
Welche Aufgaben hat die Jugendgerichtshilfe (JGH)?
Die JGH hat vielfältige Aufgaben gemäß § 38 JGG. Sie unterstützt sowohl das Gericht und die Ermittlungsbehörden als auch den Beschuldigten. Zu ihren Aufgaben gehören die Ermittlungshilfe (Täterpersönlichkeit erforschen), die Berichtshilfe (Berichte für das Gericht erstellen), die Sanktionsüberwachung (Kontrolle der Einhaltung richterlicher Anordnungen) und die Betreuung des Jugendlichen (Beratung, Begleitung und Unterstützung).
Welche Sanktionsformen werden im Jugendstrafverfahren unterschieden?
Die Seminararbeit unterscheidet zwischen Erziehungsmaßregeln (z.B. Weisungen wie Täter-Opfer-Ausgleich oder soziale Trainingskurse, Hilfen zur Erziehung) und Zuchtmitteln (Verwarnung, Auflagen, Jugendarrest). Es wird detailliert auf die einzelnen Maßnahmen, deren erzieherischen Zweck und ihre praktische Anwendung eingegangen. Der Jugendarrest wird als umstrittene Maßnahme dargestellt, deren Anwendung aufgrund der Entwicklung innovativerer Sanktionsformen zurückgegangen ist.
Wie wird das Thema anhand eines Fallbeispiels veranschaulicht?
Die Arbeit verwendet ein fiktives Fallbeispiel (Familie Meyer) um die Aufgaben und Herausforderungen der JGH zu veranschaulichen. Der Fall zeigt den Verlauf der Fälle des Jugendlichen Kent Meyer, beginnend mit einer Verwarnung und eskalierend bis hin zum Ungehorsamsarrest. Es wird die Komplexität der Situation und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes, der sowohl die Bedürfnisse des Jugendlichen als auch die Anforderungen der Justiz berücksichtigt, verdeutlicht. Die JGH unterstützt die Familie Meyer letztendlich bei der Inanspruchnahme eines Erziehungsbeistands.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Jugendgerichtshilfe, Jugendstrafrecht, Sanktionen, Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel, Täter-Opfer-Ausgleich, Sozialer Trainingskurs, Hilfen zur Erziehung, Jugendarrest, Betreuung, Gerichtshilfe, Jugendhilfe, Fallbeispiel, Kooperation, Ungehorsamsarrest, Wiedereingliederung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Rolle und Herausforderungen der Jugendgerichtshilfe zu vermitteln. Sie beleuchtet die vielschichtigen Aufgaben der JGH, fokussiert auf die verschiedenen Sanktionsformen im Jugendstrafverfahren und illustriert diese anhand eines Fallbeispiels.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zu den Aufgaben der Jugendgerichtshilfe, einem Kapitel zu den Sanktionsformen, einem Kapitel mit dem Fallbeispiel Familie Meyer und einer Zusammenfassung.
- Quote paper
- Claudia Mueller (Author), 2010, Die Jugendgerichtshilfe als ein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162403