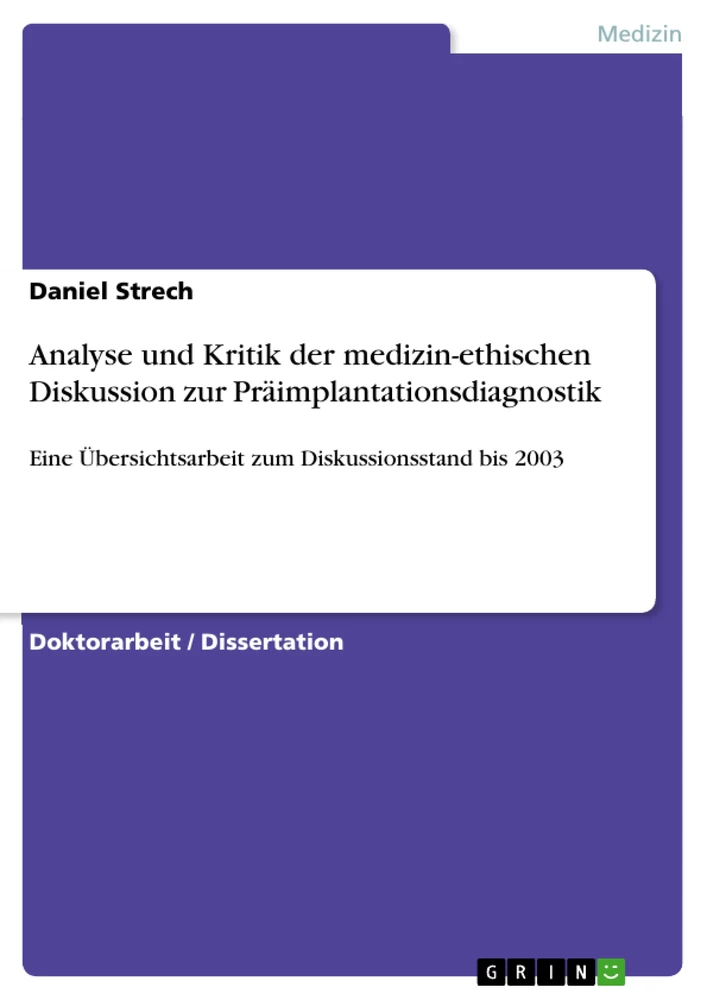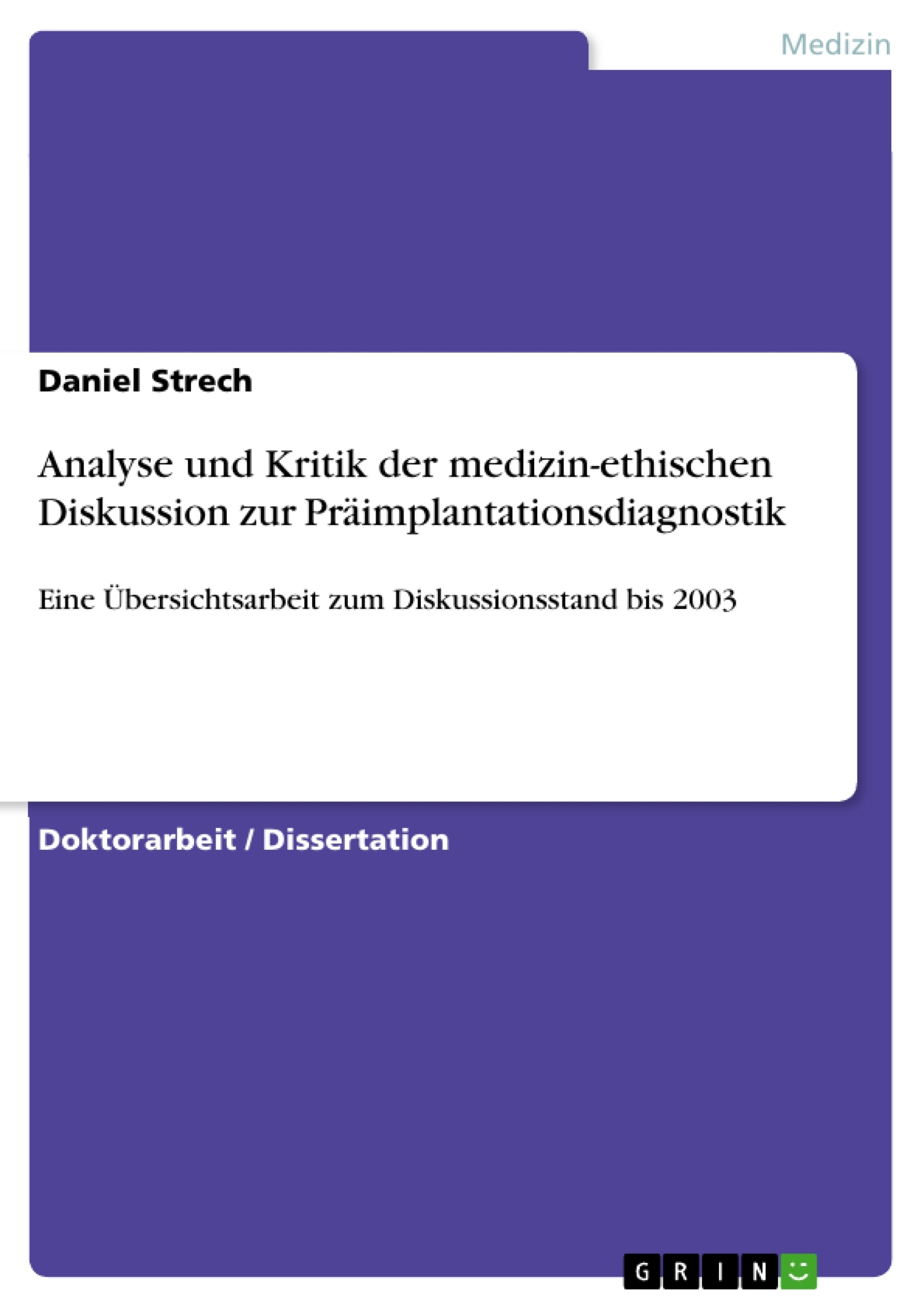Die medizinethische Diskussion zur Präimplantationsdiagnostik ist maßgeblich bestimmt durch zwei sich gegenüberstehende Argumentationstypen. Die Befürworter bedienen sich vornehmlich eines pragmatisch-nutzenorientierten Argumentationstyps. Hierbei werden die Interessen und Bedenken möglicher Patienten aus einer subjektiven und situativen Perspektive heraus nach Pro- und Kontraargumenten gegeneinander abgewogen. Auf der anderen Seite folgen die Kritiker der Präimplantationsdiagnostik einem gesellschaftspolitisch-folgenorientierten Argumentationstyp. Sie weisen neben dem möglichen Schaden für die Patienten auf das Negativpotential dieser Technik hin. Dabei werden in den abwägenden Bewertungsprozess neben den technikspezifischen Aspekten weitere heterogene Diskussionsfelder integriert.
Die vorliegende Arbeit gibt zunächst einen Überblick über die naturwissenschaftlichen, klinischen und rechtlichen Aspekte zur Präimplantationsdiagnostik. Anschließend wird der beschriebene Diskurs in seinen spezifischen Argumentationssträngen analysiert. Die ebenfalls beteiligten Diskussionsfelder zum humangenetischen Krankheitsbegriff, zur Patientenautonomie, zum Embryonenstatus und zur Eugenik-Debatte werden in Beziehung gesetzt zur Thematik der Präimplantationsdiagnostik.
Ich stelle fest, dass die unterschiedlichen Ansätze der beiden wichtigsten Argumentationstypen eine grundlegende Asymmetrie bedingen. Aufgrund der hochgradigen Komplexität des Bewertungsprozesses ist der gesellschaftspolitische Argumentationstyp anders als der pragmatische mit einem latenten Vermittlungsproblem belastet. Trotz inhaltlicher Relevanz der gesellschaftspolitischen Argumente könnte sich dieses strukturelle Ungleichgewicht zugunsten der pragmatischen Argumente in der politischen Entscheidungsfindung niederschlagen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil 1: Naturwissenschaftliche und medizinische Aspekte der Präimplantationsdiagnostik
- 1.1 Verfahrenstechnik
- 1.1.1 Präimplantationsdiagnostik (PGD)
- 1.1.2 Präkonzeptionsdiagnostik
- 1.2 Fehlerquellen
- 1.3 Erfolgsraten
- 1.4 Totipotenz in der Embryonalperiode
- 1.5 Gesundheitliche Belastungen
- 1.5.1 Risiken für das Kind
- 1.5.2 Risiken für die Frau
- 1.6 Finanzielle Aspekte
- 1.7 Indikationen und Anwendungsmöglichkeiten
- 1.7.1 Strukturelle Chromosomenaberrationen
- 1.7.2 Numerische Chromosomenaberrationen oder Aneuploidien
- 1.7.3 Spät manifestierende Krankheiten
- 1.7.4 Begleitbefunde
- 1.7.5 Multifaktorielle Krankheiten und DNA-Chips
- 1.7.6 Geschlechtsgebundene Erbgänge
- 1.8 Wer wendet die PGD gegenwärtig an?
- Teil 2: Rechtliche Aspekte der Präimplantationsdiagnostik
- Teil 3: Überblick über die medizinethische Diskussion zur Präimplantationsdiagnostik
- 3.1 Stellungnahmen und Argumente
- 3.1.1 Der pragmatische Argumentationstyp
- 3.1.2 Der gesellschaftspolitische Argumentationstyp
- 3.1.2.1 Gründe für die Zwangsläufigkeit
- 3.1.2.2 Begünstigende Faktoren
- 3.1.2.3 Negativ-Urteile
- 3.1.3 Der kategorische Argumentationstyp
- 3.2 Die Sonderrolle des Embryonenstatus
- Teil 4: Begriffsanalysen und Diskussionsfelder
- 4.1 Der Krankheitsbegriff in der Humangenetik
- 4.2 Autonomie als Begriff und Paradigma
- 4.3 Künstlich vs. Natürlich, die Technikbilder
- 4.4 Person und Menschenwürde im Kontext des Embryonenstatus
- 4.4.1 Die Leitideen in der Statusdiskussion
- 4.4.2 Ethische Aspekte des Personwerdens
- 4.4.3 Moralische Relevanz von Interessen und Bedürfnissen
- 4.4.4 Der normative Gehalt des Menschenwürdebegriffs
- 4.5 Struktur und Inhalt der Schiefen-Ebene Argumente
- 4.5.1 Der mögliche Schaden für Personen mit einer Behinderung
- 4.5.2 Der mögliche psychosoziale Druck auf die zukünftigen Eltern
- 4.5.3 Der mögliche Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung und auf die Integrität des Menschenbildes
- 4.6 Das Eugenik-Argument
- 4.7 Selektion in der genetischen Frühdiagnostik
- Teil 5: Bewertung der Argumentationstypen
- 5.1 Die gegenseitige Ergänzung von pragmatischen und gesellschaftspolitischen Argumentationstypen
- 5.2 Der Status kategorischer Argumentationstypen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die medizinethische Diskussion zur Präimplantationsdiagnostik. Ziel ist es, die verschiedenen Argumentationstypen zu analysieren und zu bewerten. Dabei werden sowohl die naturwissenschaftlichen und medizinischen Grundlagen der Technik als auch die rechtlichen und ethischen Aspekte beleuchtet.
- Analyse der verschiedenen Argumentationstypen in der Debatte um die Präimplantationsdiagnostik (pragmatisch, gesellschaftspolitisch, kategorisch)
- Untersuchung der ethischen Aspekte des Embryonenstatus
- Bewertung der Argumente bezüglich möglicher Schäden für Menschen mit Behinderungen und der Eugenik-Debatte
- Diskussion der Rolle von Autonomie und Menschenwürde im Kontext der Präimplantationsdiagnostik
- Analyse des Einflusses der Präimplantationsdiagnostik auf das Menschenbild und die Eltern-Kind-Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die naturwissenschaftlichen und medizinischen Aspekte der Präimplantationsdiagnostik. Es werden die Verfahrenstechnik, Fehlerquellen, Erfolgsraten und Risiken für das Kind und die Frau beschrieben. Das zweite Kapitel beleuchtet die rechtlichen Aspekte der Präimplantationsdiagnostik. Das dritte Kapitel bietet einen Überblick über die medizinethische Diskussion zur Präimplantationsdiagnostik und analysiert die verschiedenen Argumentationstypen. Das vierte Kapitel befasst sich mit Begriffsanalysen und Diskussionsfeldern, wie dem Krankheitsbegriff, Autonomie und Menschenwürde im Kontext des Embryonenstatus. Das fünfte Kapitel bewertet die verschiedenen Argumentationstypen und ihre Relevanz für die politische Entscheidungsfindung.
Schlüsselwörter
Präimplantationsdiagnostik, Medizinethik, Argumentationstypen, Embryonenstatus, Autonomie, Menschenwürde, Eugenik, Behinderung, Technikbilder, Krankheitsbegriff, Selektion, Frühdiagnostik, Gesellschaftliche Folgen, ethische Bewertung.
Häufig gestellte Fragen
Welche zwei Hauptargumentationstypen bestimmen die PID-Debatte?
Die Befürworter nutzen meist einen pragmatisch-nutzenorientierten Typ, während Kritiker einem gesellschaftspolitisch-folgenorientierten Argumentationstyp folgen.
Welche Rolle spielt der Embryonenstatus in der Diskussion?
Der Embryonenstatus ist zentral für die Fragen nach Menschenwürde, Personsein und dem Schutzrecht des ungeborenen Lebens.
Was ist das "Eugenik-Argument" im Kontext der PGD?
Kritiker befürchten, dass die Selektion von Embryonen zu einer neuen Form der Eugenik und einem negativen Einfluss auf das Bild von Menschen mit Behinderungen führt.
Welche medizinischen Risiken bestehen bei der Präimplantationsdiagnostik?
Die Arbeit beleuchtet gesundheitliche Belastungen und Risiken sowohl für das Kind als auch für die Frau während des Verfahrens.
Warum gibt es eine Asymmetrie in der politischen Entscheidungsfindung?
Der gesellschaftspolitische Typ hat ein Vermittlungsproblem aufgrund seiner Komplexität, was dazu führen kann, dass pragmatische Argumente in der Politik dominieren.
- Quote paper
- Daniel Strech (Author), 2003, Analyse und Kritik der medizin-ethischen Diskussion zur Präimplantationsdiagnostik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162410