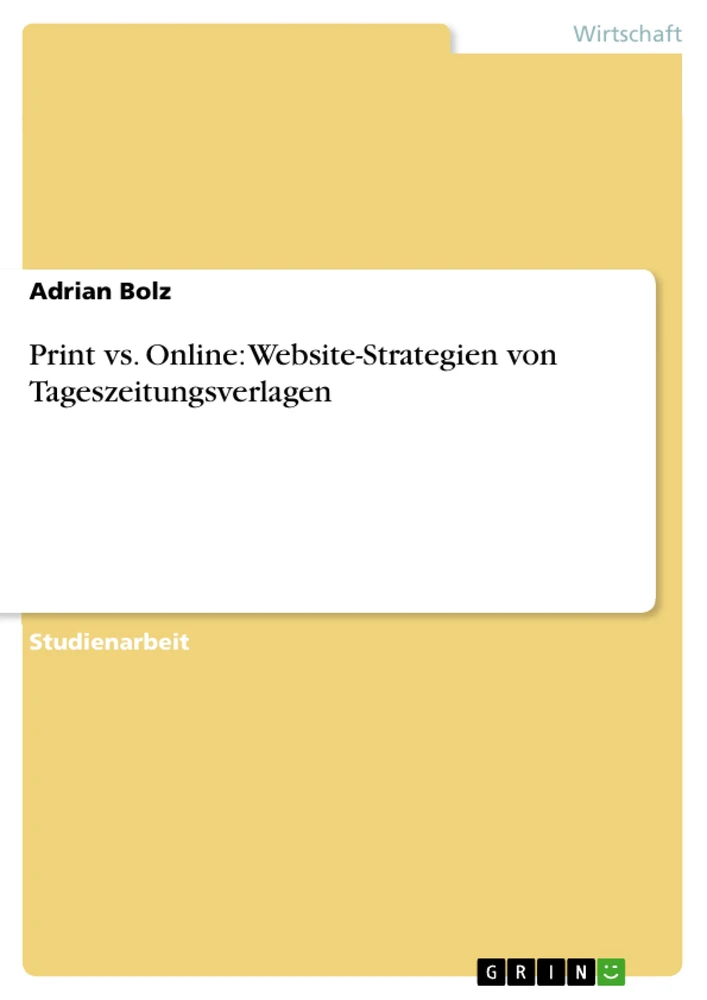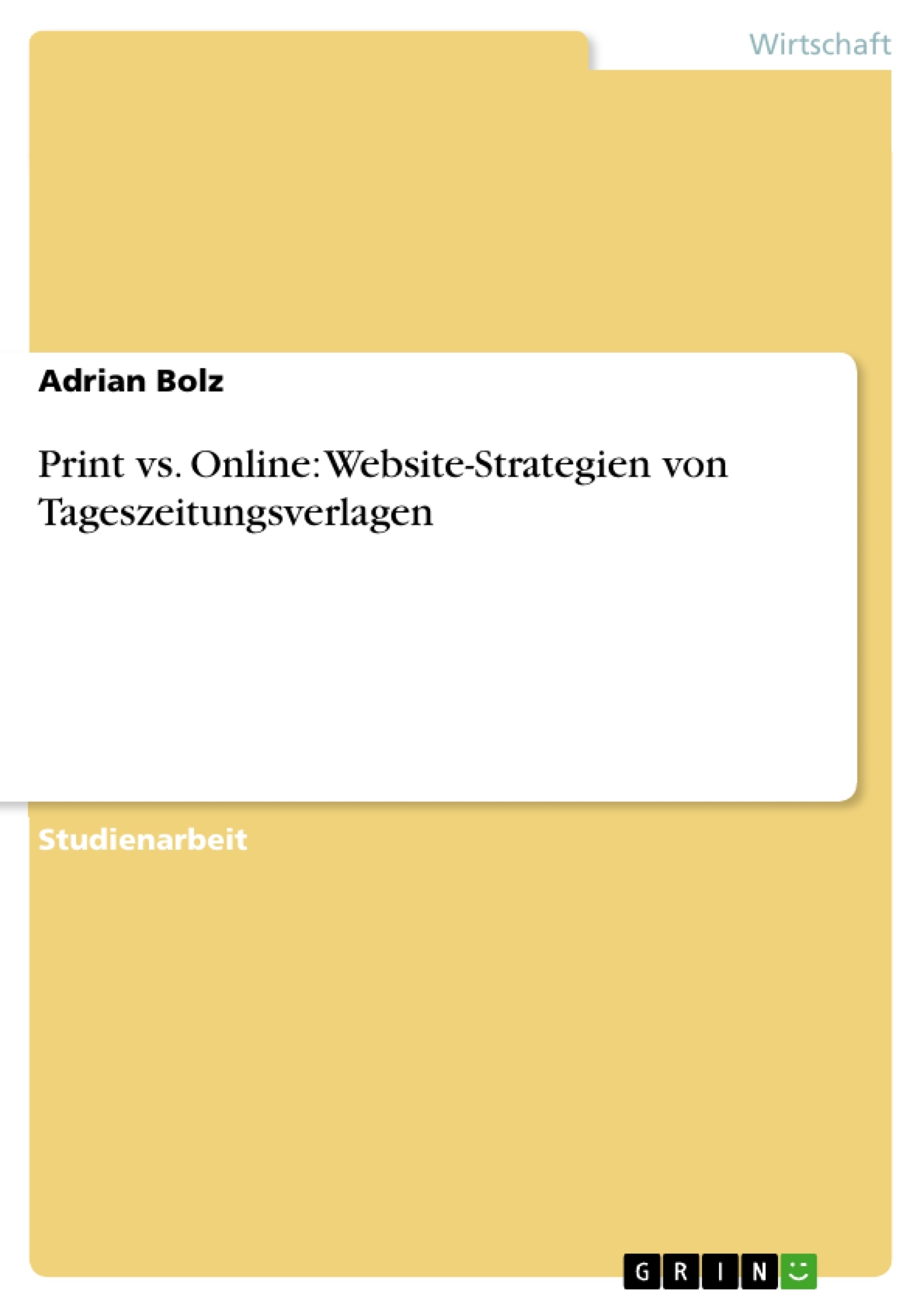Die Internetseiten der deutschen Tageszeitungen haben sich seit ihrer Einführung ab 1995 als feste Größe unter den Informationsportalen im Internet etablieren können. Allein die Refinanzierung gestaltet sich nach wie vor schwierig. Dabei befinden sich die Tageszeitungsverlage trotz großer Popularität ihrer Online-Präsenzen in einem Dilemma: Bieten sie ihre Inhalte im Internet kostenlos an, steigern sie die Reichweite ihrer Seiten und mit ihnen die Werbeeinnahmen, die aber nach wie vor gering sind. Bieten sie ihre Inhalte als Special-Interest-Angebote kostenpflichtig an, stoßen sie auf überwiegend zahlungsunwillige Leser, die nur zögernd bereit sind, für redaktionelle Inhalte im Web zu bezahlen. Gleichzeitig senken Bezahlbarrieren die Reichweite ihrer Seiten. Die vorliegende Arbeit bemüht sich um eine allgemeine Betrachtung des Engagements der Tageszeitungsverlage im Internet. Besonders berücksichtigt werden sollen in der Beschreibung hierbei stets auch diejenigen Optionen, die von der Forschung und Verlegern als vielversprechend betrachtet werden. Die Ausführungen sollen dem Leser einen Überblick über die vergangenen, aktuellen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich der verlagseigenen journalistischen Internetseiten bieten. Ausgehend von einer Zusammenfassung, die die im Print-Bereich vorherrschenden Widrigkeiten behandelt, die nach neuen Mitteln und Wegen für die Verlage verlangen, werden die Entwicklungsgeschichte des Internetengagements der Tageszeitungen und abschließend einige für die Webseiten der Verlage wichtige und auch zukunftsträchtige Strategien aufgeführt. Die Strategien, die sich auf den Content der Seiten beziehen und Strategien, die Erlösmodelle behandeln, werden dabei jeweils in eigenen Kapiteln betrachtet.
Ganz neue Entwicklungen, vor allem im Bereich des ePublishings, können trotz ihrer Relevanz für die Zukunft der Verlage in dieser Arbeit nur angeschnitten werden. Die Auswirkungen, die iPad und Co auf das Verlagswesen zeitigen werden sind derzeit noch wenig absehbar und bedingt durch die erst zu Jahresbeginn erfolgte Markteinführung auch von der Forschung noch nicht ausreichend betrachtet worden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bestandsaufnahme Print vs. Online
- Der Negativtrend sinkender Auflagenhöhe bei Tageszeitungen und seine Ursachen
- Motivationsgrundlagen des Internetengagements der Tageszeitungsverlage
- Entwicklungsphasen von Zeitungen im Internet nach Mögerle
- Strategien der Verlage auf Contentebene der News-Sites
- Differenzierungsstrategien gegenüber den Wettbewerbern
- Wettbewerbsstrategien in den Anzeigen- und Rubrikenmärkten
- User-Generated-Content und Social-Networking
- Aktuelle Erlösmodelle der News-Sites
- Paid-Content und Content-Syndication
- E-Commerce
- Geschäftsmodell Mobile
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Engagement deutscher Tageszeitungsverlage im Internet, insbesondere die Herausforderungen und Strategien im Bereich der Website-Entwicklung und der Monetarisierung von Online-Inhalten. Dabei wird der Fokus auf die Bestandsaufnahme der aktuellen Situation gelegt, sowie auf die Analyse von Erfolgsfaktoren und zukunftsträchtigen Strategien.
- Analyse des Negativtrends sinkender Auflagenzahlen bei Tageszeitungen und seiner Ursachen
- Motivationsgrundlagen des Internetengagements der Tageszeitungsverlage
- Entwicklungsgeschichte von Zeitungen im Internet und die Herausforderungen der Digitalisierung
- Differenzierungsstrategien der Verlage im Online-Wettbewerb
- Erlösmodelle und Geschäftsstrategien für News-Sites
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit erläutert den Ausgangspunkt des Internetengagements deutscher Tageszeitungen und stellt die zentralen Herausforderungen und die Ziele der Untersuchung dar.
- Bestandsaufnahme Print vs. Online: Dieses Kapitel beleuchtet den Negativtrend sinkender Auflagenzahlen im Printbereich und analysiert die Ursachen. Es werden die Motivationsgrundlagen der Verlage für ihr Engagement im Internet sowie die Entwicklungsphasen von Zeitungen im Internet nach Mögerle vorgestellt.
- Strategien der Verlage auf Contentebene der News-Sites: Dieser Abschnitt betrachtet die Differenzierungsstrategien der Verlage im Wettbewerb mit anderen Online-Angeboten und beleuchtet die Wettbewerbsstrategien in den Anzeigen- und Rubrikenmärkten. Der Einfluss von User-Generated-Content und Social-Networking wird diskutiert.
- Aktuelle Erlösmodelle der News-Sites: Dieses Kapitel widmet sich den aktuellen Erlösmodellen der Verlage für ihre News-Sites, einschließlich Paid-Content-Angeboten, Content-Syndication, E-Commerce und dem Geschäftsmodell Mobile.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert die Entwicklung und Herausforderungen von Tageszeitungen im digitalen Zeitalter. Zentrale Themen sind der sinkende Stellenwert des Printmediums, der zunehmende Einfluss des Internets, die Herausforderungen der digitalen Transformation und die Suche nach nachhaltigen Erlösmodellen für Online-Angebote. Die Analyse konzentriert sich auf Themen wie Online-Strategien, User-Generated-Content, Paid-Content-Modelle, Social-Networking und E-Commerce.
Häufig gestellte Fragen
Warum stehen Tageszeitungen unter wirtschaftlichem Druck?
Die Verlage leiden unter sinkenden Auflagenzahlen im Printbereich und der Herausforderung, Online-Inhalte profitabel zu monetarisieren, da viele Leser nicht zahlungswillig sind.
Welche Erlösmodelle gibt es für Zeitungs-Websites?
Zu den gängigen Modellen gehören Paid-Content (bezahlte Inhalte), Content-Syndication, E-Commerce und mobile Geschäftsmodelle.
Was ist das Dilemma der kostenlosen Inhalte?
Kostenlose Inhalte steigern zwar die Reichweite und Werbeeinnahmen, entwerten aber gleichzeitig das journalistische Produkt und erschweren die Einführung von Bezahlmodellen.
Welche Rolle spielt User-Generated-Content?
Verlage nutzen User-Generated-Content und Social-Networking als Strategie auf Contentebene, um die Nutzerbindung zu erhöhen und sich vom Wettbewerb abzuheben.
Seit wann sind deutsche Tageszeitungen im Internet aktiv?
Die ersten Internetauftritte deutscher Tageszeitungen wurden ab dem Jahr 1995 eingeführt und haben sich seitdem als feste Informationsportale etabliert.
- Quote paper
- Adrian Bolz (Author), 2010, Print vs. Online: Website-Strategien von Tageszeitungsverlagen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162535