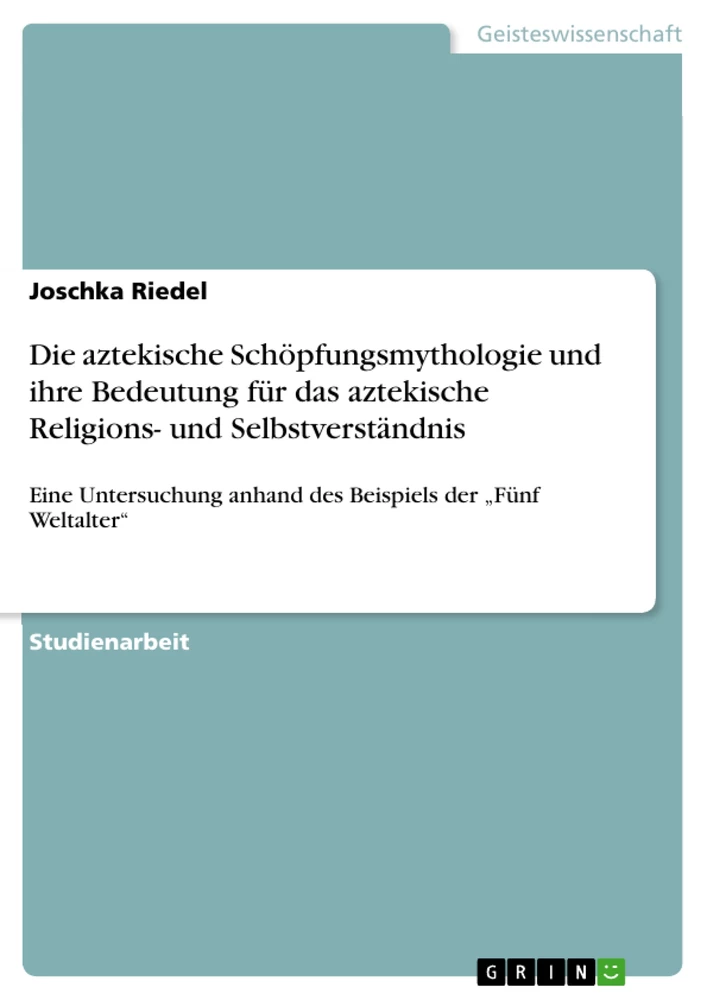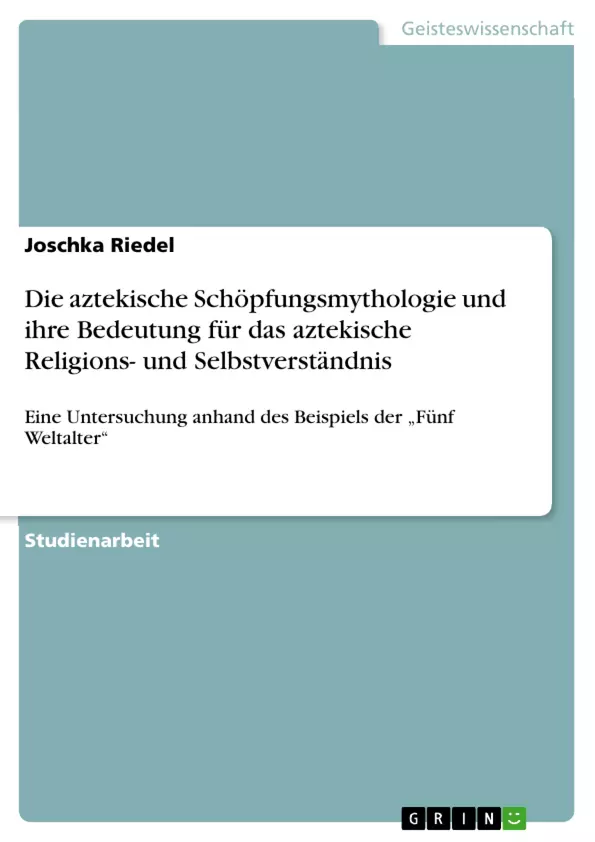Das Volk der Azteken, dessen Bezeichnung sich von ihrer mythischen Urheimat Aztlan herleitet, konnte in einem raschen Aufstieg im 14. Jahrhundert die Vormachtstellung über weite Gebiete Mesoamerikas erobern, die es auch bis zu seiner Eroberung im frühen 16. Jahrhundert durch die spanischen Konquistadoren unter Hernán Cortés behauptete. Die erstaunten Europäer fanden neben einer aus Wanderkriegern und sesshaften Ackerbauern geformten Gesellschaft eine theokratische Staatsform vor, deren elementarer Bestandteil das sakrale Menschenopfer zu sein schien. Umso weniger verwundert es, dass die europäischen Christen anfangs nicht in der Lage waren, die brutal erscheinende Wirklichkeit der aztekischen Gedankenwelt nachzuvollziehen, und sie daher tiefste Abscheu empfanden. Das Ziel dieser Arbeit soll darin liegen, in der aztekischen Schöpfungsmythologie einen Schlüssel zu finden, um die auf den ersten Blick tatsächlich dramatische und menschenverachtende Religiosität der Azteken zu ergründen und sich ihres Selbst- und Weltbildes gewahr zu werden.
Im Folgenden sollen zunächst die wesentlichen historiografischen Quellen kurz skizziert und ihre Bewertung in der Forschung wiedergegeben werden, bevor versucht wird, das aztekische Geschichtsverständnis zu erfassen und in einem ersten Schritt etwaige Verknüpfungen zwischen sakraler und profaner Ebene herauszuarbeiten. Im Anschluss sollen grundlegende Merkmale aztekischer Religiosität, im Einzelnen das aztekische Pantheon, die Wirksamkeit der Gottheiten und die drei verschiedenen Totenreiche näher erläutert werden, um eine geeignete Ausgangslage für die abschließende Analyse zu schaffen, die sich mit dem Mythos der fünf Weltalter und seiner Bedeutung für die aztekische Religions- und Geschichtsauffassung befasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aztekische Historiografie und aztekischer Geschichtsbegriff
- Quellen und Quellenhermeneutik
- Aztekisches Geschichtsverständnis und Tradierung
- Allgemeine Charakteristika der aztekischen Religion
- Grundlegende Voraussetzungen für das Verständnis aztekischer Religiosität
- Das aztekische Pantheon
- Das Wirken der Götter
- Die drei Totenreiche
- Die aztekische Schöpfungsmythologie und ihre Bedeutung
- Der Mythos der „Fünf Weltalter“
- Die Bedeutung der Schöpfungsmythologie für das aztekische Selbst- und Weltverständnis
- Ergebnis der Untersuchung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die aztekische Schöpfungsmythologie, insbesondere den Mythos der „Fünf Sonnen“, und untersucht deren Bedeutung für das aztekische Selbst- und Weltverständnis. Die Arbeit beleuchtet die aztekische Historiografie, Quellenhermeneutik und das Geschichtsverständnis sowie wichtige Elemente der aztekischen Religion wie das Pantheon, das Wirken der Götter und die drei Totenreiche.
- Aztekische Historiografie und Quellenkritik
- Aztekisches Geschichtsverständnis und Tradierung
- Die Schöpfungsmythologie der „Fünf Sonnen“
- Die Bedeutung der Mythologie für das aztekische Selbst- und Weltverständnis
- Die Verbindung zwischen sakraler und profaner Ebene in der aztekischen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die Zielsetzung und den Aufbau. Kapitel 2 widmet sich der aztekischen Historiografie und beleuchtet die Quellenlage sowie die Herausforderungen der Quelleninterpretation. In Kapitel 3 werden die grundlegenden Charakteristika der aztekischen Religion erläutert, einschließlich des Pantheons, der Götterwirkung und der drei Totenreiche. Kapitel 4 analysiert den Mythos der „Fünf Weltalter“ und seine Bedeutung für das aztekische Selbst- und Weltverständnis. Das Ergebnis der Untersuchung wird in Kapitel 5 zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Aztekische Schöpfungsmythologie, Fünf Sonnen, Weltaltermythos, aztekische Religion, aztekisches Selbstverständnis, aztekisches Weltbild, Historiografie, Quellenhermeneutik, Pantheon, Götterwirkung, Totenreiche, Mesoamerika.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der aztekischen Schöpfungsmythologie?
Der Mythos der „Fünf Sonnen“ (Weltalter) beschreibt die Entstehung und Vernichtung aufeinanderfolgender Welten und die zentrale Rolle der Götter dabei.
Warum praktizierten die Azteken Menschenopfer?
Aus ihrem Weltbild heraus waren Opfer notwendig, um die Götter zu nähren und den Fortbestand der aktuellen, fünften Welt zu sichern.
Wie sahen die Totenreiche der Azteken aus?
Es gab drei verschiedene Totenreiche, deren Erreichen nicht vom moralischen Lebenswandel, sondern von der Art des Todes abhing.
Welche Quellen informieren uns über die Azteken?
Wichtige Quellen sind Codices und Berichte spanischer Konquistadoren, die jedoch kritisch im Kontext ihrer Zeit interpretiert werden müssen.
Was bedeutet der Name „Azteken“?
Der Name leitet sich von „Aztlan“ ab, der mythischen Urheimat des Volkes, von der aus sie ihre Wanderung begannen.
- Quote paper
- Joschka Riedel (Author), 2010, Die aztekische Schöpfungsmythologie und ihre Bedeutung für das aztekische Religions- und Selbstverständnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162588