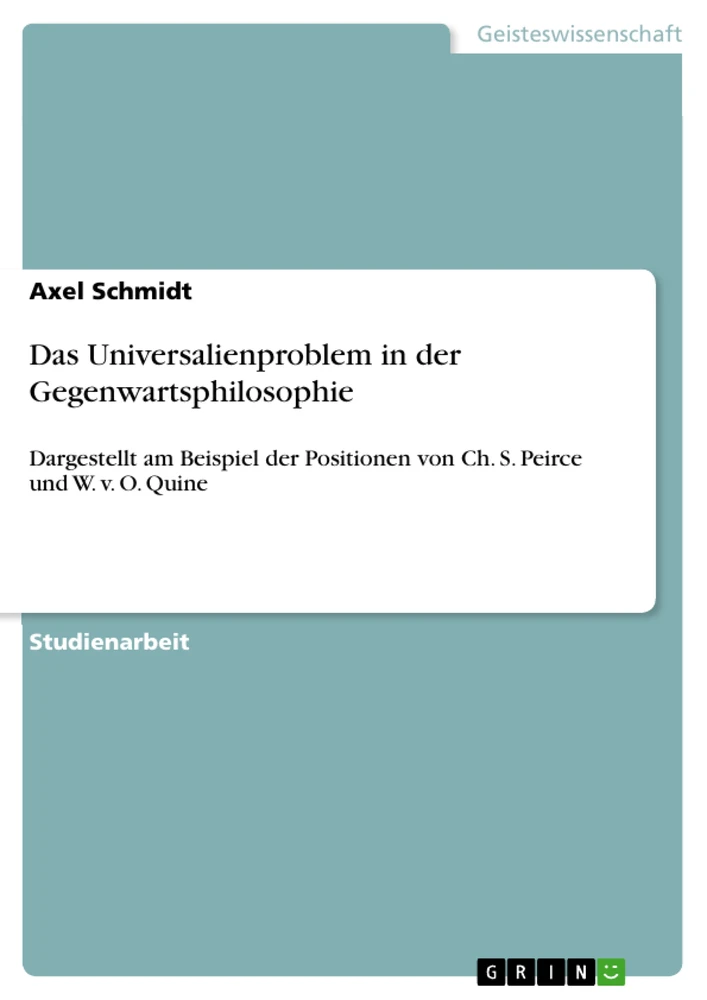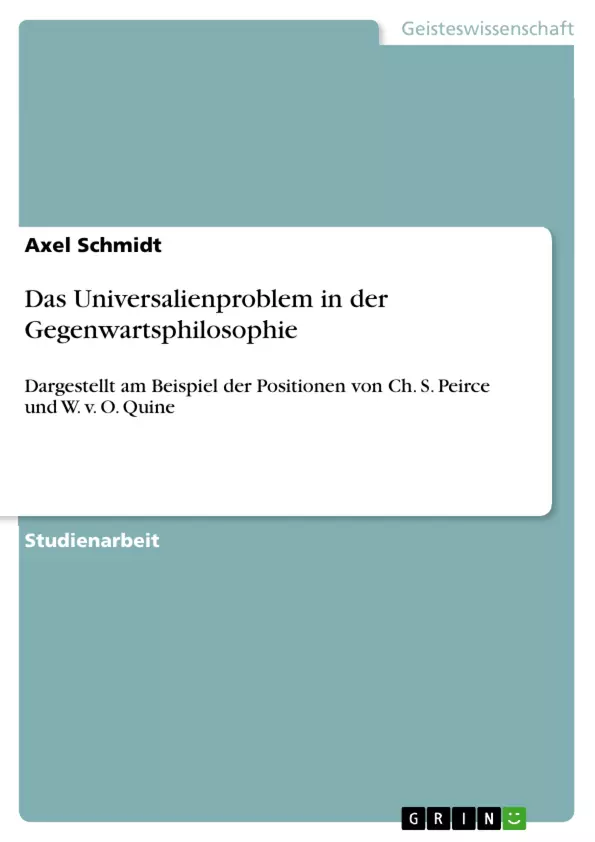Worin liegt die Berechtigung, von Vielem ein Eines und Einziges auszusagen? Wenn zum Beispiel gesagt wird, Peter sei ein Mensch und Paul sei ein Mensch, dann sind Peter und Paul einerseits gleich, da sie beide Menschen sind, und andererseits verschieden, da sie zwei (verschiedene) Individuen sind.
Wie verhalten sich nun Gleichheit und Verschiedenheit, Einheit (des Prädikats) und Vielheit (der Subjekte)? Wenn weder die Gleichheit noch die Verschiedenheit Schein sind, fragt sich, worin das Fundament für die Gleichheit verschiedener Dinge besteht und in welcher Weise es existiert.
Diese Frage ist identisch mit der Frage nach der Berechtigung und dem logisch-ontologischen Stellenwert der Allgemeinbegriffe. Drei Lösungstypen bieten sich an und sind (teilweise auch als Mischformen) in der Geschichte der Philosophie vertreten worden:
a) Der sog. Begriffs- oder Universalienrealismus,
b) der sog. Konzeptualismus,
c) der sog. Nominalismus.
In dieser Arbeit soll nach einer Kurzdarstellung von zwei mittelalterlichen Stellungnahmen zum Universalienproblem (Teil I) das Wiederaufleben des alten Streits in der Gegenwartsphilosophie, v.a. innerhalb der Grundlagenforschung der Mathematik, charakterisiert werden. Die Position des Ch. S. Peirce († 1914) nimmt dabei eine gewisse Sonderstellung ein, da sie einerseits manche Überlegungen der späteren analytischen Philosophie vorwegnimmt und andererseits im Gegensatz zu dieser eine metaphysische Grundlegung für notwendig hält. Da sich Peirce ausdrücklich auf Duns Scotus bezieht, verspricht seine Auffassung interessante Lichtblicke für die Beurteilung des originellen scotischen Ansatzes geben zu können (Teil II).
In W. v. O. Quine hat der Nominalismus seinen vielleicht schärfsten Verteidiger gefunden. Deshalb soll hauptsächlich auf die Position Quines eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT:
- Einleitung
- Teil I: Das Universalienproblem im Mittelalter.
- 1. Die Universalienlehre des Duns Scotus.....
- 2. Ockhams Kritik am Realismus.
- Teil II: Die Stellungnahme des Ch. S. Peirce zum Universalienproblem……………………….
- 1. Die Einwände gegen den Nominalismus
- 2. Peirce's scotistischer Universalienrealismus..
- 3. Der Universalienrealismus als Pragmatismus.
- Teil III: Der Nominalismus bei W.v.O. Quine…………….
- I. Vorbemerkungen
- a) Die Wiederkehr des Universalienstreits in der modernen Mathematik und. Logik. Die Antinomien der Mengenlehre
- b) Die Positionen des Platonismus, Realismus, Konzeptualismus und Nominalismus als Stellungnahmen zum Antinomieproblem
- c) Allgemeines und ideales Sein
- 2. Der Nominalismus W.v. O. Ouines ..
- 3. Einige kritische Fragen an Quines Nominalismus.......
- Literaturverzeichnis .......
- 1. Quellen...
- 2. Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit widmet sich dem Universalienproblem in der Gegenwartsphilosophie, indem sie die Positionen von Charles Sanders Peirce und Willard Van Orman Quine aufzeigt und analysiert. Die Arbeit dient als Weiterführung eines Teilaspekts der Diplomarbeit des Autors über den Personbegriff des Johannes Duns Scotus und untersucht die systematische Bedeutung des realistischen Denkens des Doctor subtilis im Kontext moderner philosophischer Ansätze. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Auseinandersetzung mit den Positionen von Peirce und Quine gelegt, die in dieser Arbeit als paradigmatisch für die Debatte über das Universalienproblem in der Gegenwart betrachtet werden.
- Die Relevanz des Universalienproblems in der Geschichte der Philosophie.
- Die unterschiedlichen Positionen zum Universalienproblem: Realismus, Konzeptualismus und Nominalismus.
- Die Position von Charles Sanders Peirce als Vertreter des Universalienrealismus.
- Die Position von Willard Van Orman Quine als Vertreter des Nominalismus.
- Die Bedeutung der modernen Mathematik und Logik für das Universalienproblem.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Universalienproblem ein und erläutert die zentrale Fragestellung: Worin liegt die Berechtigung, von Vielem ein Eines und Einziges auszusagen? Die verschiedenen Lösungsansätze des Realismus, Konzeptualismus und Nominalismus werden vorgestellt.
- Teil I: Das Universalienproblem im Mittelalter: Dieser Teil der Arbeit beleuchtet die Universalienlehre des Duns Scotus und die Kritik des William von Ockham am Realismus. Die verschiedenen Argumentationslinien werden dargelegt und die Bedeutung des Universalienproblems für die mittelalterliche Philosophie wird herausgestellt.
- Teil II: Die Stellungnahme des Ch. S. Peirce zum Universalienproblem: Hier wird die Position von Charles Sanders Peirce zum Universalienproblem untersucht. Seine Einwände gegen den Nominalismus, seine scotistische Interpretation des Universalienrealismus und die Bedeutung des Pragmatismus für seine Sichtweise werden beleuchtet.
- Teil III: Der Nominalismus bei W.v.O. Quine: Der dritte Teil der Arbeit widmet sich dem Nominalismus von Willard Van Orman Quine. Die Bedeutung des Universalienstreits in der modernen Mathematik und Logik wird erörtert, die Positionen von Platonismus, Realismus, Konzeptualismus und Nominalismus im Kontext der Antinomien der Mengenlehre werden dargestellt. Schließlich wird Quines Nominalismus im Detail analysiert und kritisch hinterfragt.
Schlüsselwörter
Universalienproblem, Realismus, Nominalismus, Konzeptualismus, Duns Scotus, William von Ockham, Charles Sanders Peirce, Willard Van Orman Quine, Pragmatismus, moderne Mathematik, Logik, Mengenlehre, Antinomien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Universalienproblem?
Es ist die philosophische Frage, ob Allgemeinbegriffe (Universalien) eine eigene Realität besitzen oder lediglich Namen für Gruppen von Einzeldingen sind.
Was unterscheidet Realismus, Konzeptualismus und Nominalismus?
Realisten glauben an die reale Existenz von Allgemeinem; Konzeptualisten sehen sie als Konstrukte des Geistes; Nominalisten halten sie für bloße Namen.
Welche Position vertritt Charles S. Peirce?
Peirce vertritt einen „scotistischen Universalienrealismus“, den er mit seinem Pragmatismus verknüpft und als metaphysisch notwendig erachtet.
Warum ist W.v.O. Quine für den Nominalismus wichtig?
Quine gilt als einer der schärfsten modernen Verteidiger des Nominalismus, insbesondere im Kontext der Logik und Mathematik.
Wie hängt die Mengenlehre mit dem Universalienstreit zusammen?
Die Antinomien der Mengenlehre führten in der modernen Mathematik zu einer Wiederkehr des Streits über die Existenz abstrakter Entitäten.
- Arbeit zitieren
- Dr. Axel Schmidt (Autor:in), 1986, Das Universalienproblem in der Gegenwartsphilosophie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162597