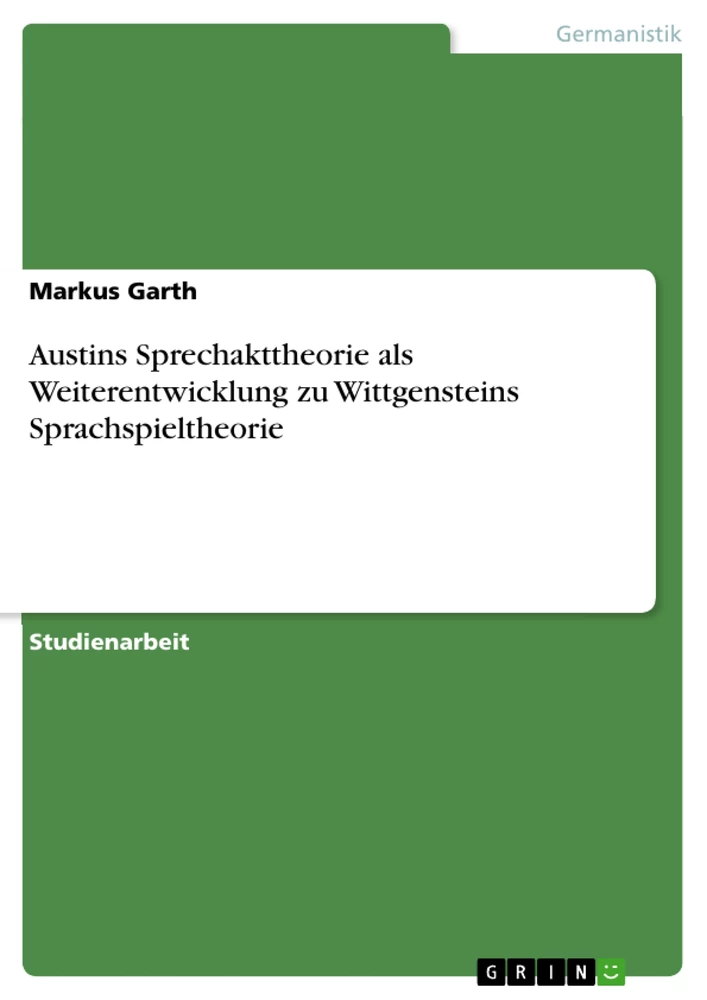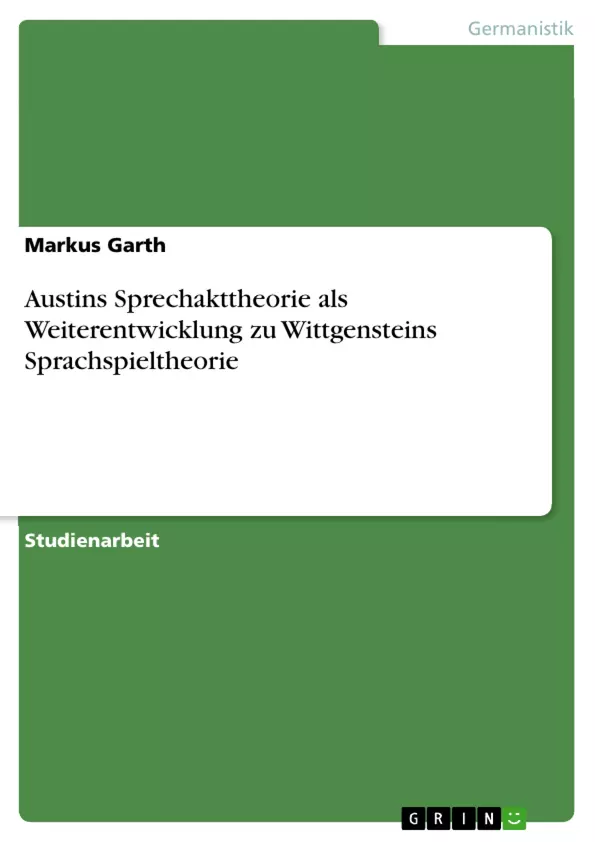1. Einleitung
Diese Arbeit behandelt die Frage, ob Austins Sprechakttheorie eine Weiterentwicklung zu Wittgensteins Sprachspieltheorie darstellt. Zunächst wird allgemein Wittgensteins Sprachspieltheorie erörtert, die mit einigen Verweisen auf seine frühere Theorie der Sprache angereichert ist, welche den Sinn von Äußerungen auf den deskriptiven Teil beschränkt ließ. Danach wird insbesondere das Sprachspiel als Lebensform beleuchtet. Es wird ersichtlich, dass Wittgenstein die Sprache als lebendig erachtet, weshalb eine gründliche Analyse der Bedeutung nach ihm unmöglich ist. Desweiteren wird der Begriff der Familienähnlichkeiten geklärt, welcher eng mit der Unschärfe von Sprache verwoben ist.
Im zweiten Teil wird Austins Position dargelegt. Während Kapitel 2.2.1. eine kurze Einleitung darstellt, widmet sich das nächste Kapitel Austins Erarbeitung der konstativen wie performativen Äußerungen. Da er diese Aufteilung jedoch für problematisch hält, entwickelt er die Sprechakttheorie, in der er die Sprache in lokutionäre, illokutionäre und perlokutionäre Akte aufteilt. Eine Erklärung dieser Akte wird in Kapitel 2.2.4. erörtert. Im dritten Teil werden beide Positionen miteinander verglichen. So wird zunächst angeführt, dass beide Wissenschaftler ein anderes Ziel mit ihren Theorien verfolgen. Während Wittgenstein den autonomen und unzerlegbaren Charakter der Sprache betont, versucht Austin durch Sprachanalysen eine Ordnung in die Bedeutung der Sprache heranzutragen. Dennoch lassen sich bereits bei Wittgenstein Anzeichen für alle drei Sprachakte in der Sprachspieltheorie finden. Dies wird in Kapitel 2.3.2. belegt, indem zu jedem Sprachakt ein passendes Zitat von Wittgenstein angeführt wird. Im letzten Kapitel wird schließlich die Hauptfrage beantwortet, ob die Sprechakttheorie die Sprachspieltheorie weiterentwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Wittgensteins Position
- Einleitung in die Philosophie Wittgensteins
- Wittgensteins Sprachspieltheorie
- Das Sprachspiel als Lebensform und der Begriff der Familienähnlichkeiten
- Austins Position
- Einleitung in Austins Grundposition von Sprache
- konstative und performative Äußerungen
- lokutionärer, illokutionärer, perlokutionärer Akt
- Vergleich der Theorien
- Ein Vergleich der Theorien Wittgensteins und Austins
- Austins Sprechakte auf die Sprachspieltheorie angewendet
- Stellt die Sprechakttheorie eine Weiterentwicklung der Sprachspieltheorie dar?
- Wittgensteins Position
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Austins Sprechakttheorie eine Weiterentwicklung von Wittgensteins Sprachspieltheorie darstellt. Zu diesem Zweck wird zunächst Wittgensteins Sprachspieltheorie im Detail erörtert, bevor Austins Position dargelegt und die beiden Theorien im Anschluss miteinander verglichen werden.
- Wittgensteins Sprachspieltheorie und deren Bezug zur Lebensform
- Der Begriff der Familienähnlichkeiten in Wittgensteins Philosophie
- Austins Unterscheidung zwischen konstativen und performativen Äußerungen
- Die drei Ebenen des Sprechakts nach Austin: Lokution, Illokution und Perlokution
- Vergleich der Zielsetzung und der methodischen Ansätze von Wittgenstein und Austin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Verhältnis zwischen Austins Sprechakttheorie und Wittgensteins Sprachspieltheorie vor. Kapitel 2.1.1. bietet eine Einleitung in Wittgensteins Philosophie, wobei besonders auf seine Sprachauffassung im Tractatus logico-philosophicus und die darauf folgende pragmatische Wende in seinen späteren Werken eingegangen wird. Kapitel 2.1.2. erläutert Wittgensteins Sprachspieltheorie und die Bedeutung der Sprache als Teil einer Lebensform. Kapitel 2.1.3. behandelt den Begriff der Familienähnlichkeiten und deren Relevanz für die Unschärfe von Sprache. Kapitel 2.2.1. stellt Austins Grundposition von Sprache vor. Kapitel 2.2.2. untersucht die konstativen und performativen Äußerungen nach Austin. Kapitel 2.2.3. beschreibt die drei Ebenen des Sprechakts: Lokution, Illokution und Perlokution. Kapitel 2.3.1. vergleicht die Theorien von Wittgenstein und Austin und zeigt deren unterschiedliche Zielsetzungen auf. Kapitel 2.3.2. illustriert, wie Austins Sprechakttheorie auf die Sprachspieltheorie angewendet werden kann. Kapitel 2.3.3. widmet sich der Beantwortung der Hauptfrage, ob die Sprechakttheorie eine Weiterentwicklung der Sprachspieltheorie darstellt.
Schlüsselwörter
Sprachspieltheorie, Sprechakttheorie, Wittgenstein, Austin, Lebensform, Familienähnlichkeiten, konstative Äußerungen, performative Äußerungen, Lokution, Illokution, Perlokution, Pragmatik.
Häufig gestellte Fragen
Stellt Austins Sprechakttheorie eine Weiterentwicklung von Wittgensteins Sprachspieltheorie dar?
Die Arbeit untersucht diese Frage und kommt zu dem Schluss, dass Austin versucht, Ordnung in die Bedeutung der Sprache zu bringen, während Wittgenstein ihren unzerlegbaren Charakter betont.
Was bedeutet „Sprachspiel als Lebensform“ bei Wittgenstein?
Wittgenstein sieht Sprache als lebendiges Element menschlichen Handelns. Ein Sprachspiel ist untrennbar mit den praktischen Tätigkeiten und der Kultur (der Lebensform) verwoben.
Was versteht Wittgenstein unter dem Begriff „Familienähnlichkeiten“?
Der Begriff beschreibt die Tatsache, dass Wörter keine festen Definitionen haben, sondern durch ein Netz sich überschneidender Ähnlichkeiten verbunden sind, was die Sprache „unscharf“ macht.
Wie unterteilt Austin die Sprache in seiner Sprechakttheorie?
Austin unterscheidet zwischen lokutionären (das Sagen von etwas), illokutionären (das Tun beim Sagen) und perlokutionären Akten (die Wirkung des Gesagten).
Was ist der Unterschied zwischen konstativen und performativen Äußerungen?
Konstative Äußerungen beschreiben Tatsachen (wahr/falsch), während performative Äußerungen eine Handlung vollziehen (gelungen/misslungen), wie zum Beispiel ein Versprechen.
Finden sich Austins Sprachakte bereits bei Wittgenstein?
Ja, die Arbeit belegt durch Zitate, dass bereits in Wittgensteins Sprachspieltheorie Anzeichen für alle drei von Austin später definierten Sprachakte zu finden sind.
- Citation du texte
- Markus Garth (Auteur), 2008, Austins Sprechakttheorie als Weiterentwicklung zu Wittgensteins Sprachspieltheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162634