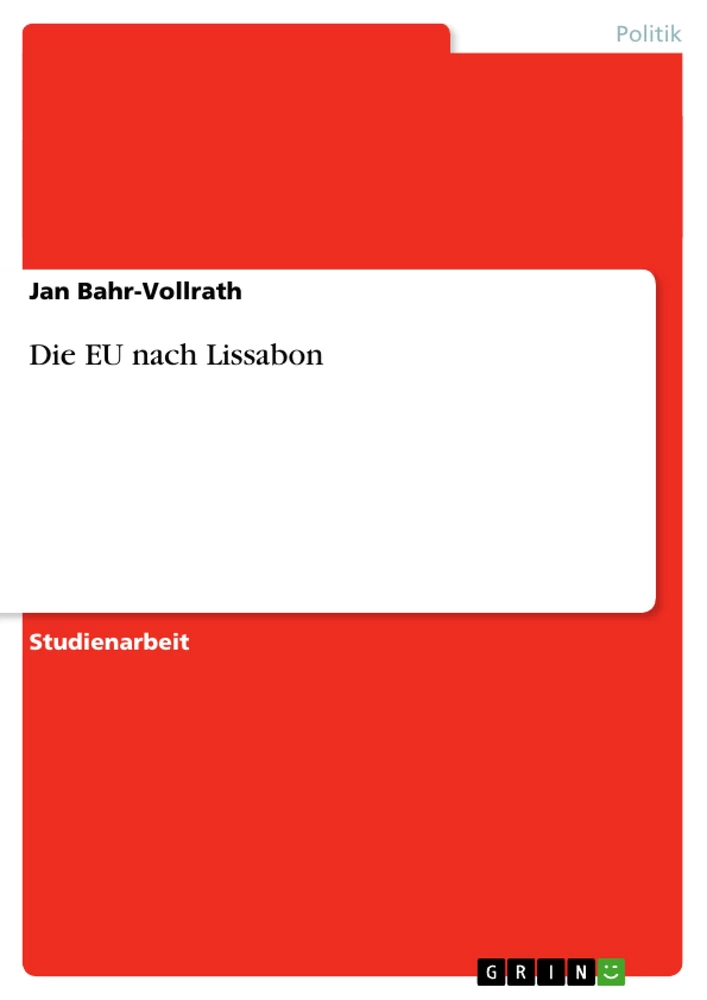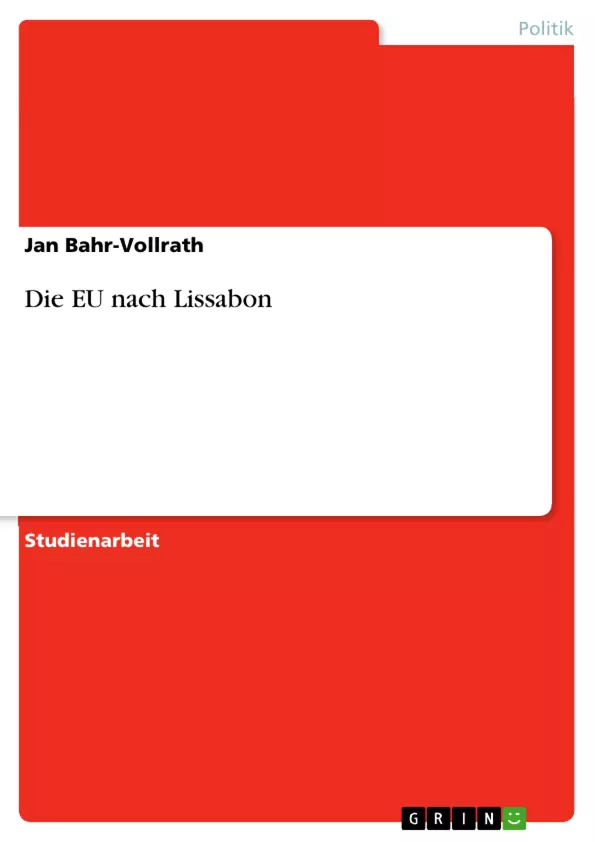Diese Einsendeaufgabe habe ich als Prüfungsleistung im Rahmen meines Fernstudiums „Europäisches Verwaltungsmanagement (M.A.)“ verfasst. Sie knüpft inhaltlich an meine ebenfalls veröffentlichte Diplomarbeit mit dem Titel „Nach dem irischen Nein: Der Vertrag von Lissabon in der Kritik der britischen Presse“ an und richtet dabei insbesondere den Blick in die Zukunft, nachdem der Vertrag von Lissabon am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist.
Die Arbeit gliedert sich wie folgt:
- kontroverse Begriffe zur Charakterisierung der EU (Internationale Organisation, Bundesstaat, Staatenverbund nach dem Maastricht-Urteil des BVerfG, Staatenverbund nach dem BVerfG-Urteil zum Vertrag von Lissabon)
- Darstellung der Grenzen Europas (geografisch, historisch-kulturell und geistesgeschichtlich)
- Sollte die EU-27 noch erweitert werden?
- In wie weit erfüllt die Türkei die Beitrittskriterien?
- Welche Vorteile brächte ein EU-Beitritt der Türkei für beide Seiten?
- Ausblick hinsichtlich einer möglichen Finalität der EU
Dabei komme ich zu folgenden Ergebnissen: Die Nachteile einer weiteren EU-Erweiterung überwiegen. Die EU sollte sich daher zum jetzigen Zeitpunkt primär auf die Konsolidierung der Finanzen der Mitgliedsstaaten und die innere Stabilität konzentrieren. Ihre Außenorientierung sollte die EU auf Alternativen wie die Europäische Nachbarschaftspolitik und privilegierte Partnerschaften beschränken. Vor allem aber sollte sie Rohstoff- und energiepolitische Interessen insbesondere in einer zu vertiefenden strategischen Partnerschaft mit Russland verfolgen.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Schuldenkrise u.a. in Griechenland, Irland und Portugal und der erst kürzlich von Irland beantragten Hilfe aus dem Euro-Rettungsfonds sind die Vorteile eines EU-Beitritts der Türkei zwar nach wie vor theoretisch stichhaltig, jedoch der Beitritt selbst in absehbarer Zeit nicht realistisch.
Im Hinblick auf die Finalität der EU bin ich der Meinung, dass nach dem gescheiterten Verfassungsvertrag und nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Vertrag von Lissabon sich die EU mittelfristig nicht zu einem Bundesstaat entwickeln kann. Eine erheblich tiefergehende Integration ist nur zwischen Deutschland, Frankreich, den Benelux-Staaten und ggf. anderen Integrationswilligen überhaupt denkbar.
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Aufgabenstellung
1 Charakterisierung der EG/EU
1.1 Internationale Organisation
1.2 Bundesstaat
1.3 Staatenverbund nach dem Maastricht-Urteil des BVerfG
1.4 Staatenverbund nach dem BVerfG-Urteil sum Vertrag von Lissabon
2 Sollte die EU-27 noch erweitert werden?
2.1 Grensen Europas
2.2 Vorteile einer weiteren Erweiterung
2.3 Probleme einer weiteren Erweiterung
2.4 Fasit
3 EU-Beitritt der Türkei
3.1 In wie weit erfüllt die Türkei die Beitrittskriterien?
3.2 Vorteile eines EU-Beitritts für die Türkei
3.3 Vorteile eines EU-Beitritts der Türkei für die EU
4 Finalität der EU
4.1 Integrationstheorien
4.2 Meinungen in Rechtsprechung, Literatur und Politik
4.3 Ausblick
Literaturverzeichnis
Zeitungsartikel
Tnternetquellen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Ural als Ostgrense Europas
Abbildung 2: Europa-Varianten in der geographischen Literatur
Abbildung 3: Tektonische Platten bewegen die Welt
Abbildung 4: Europaratsmitglieder
Abbildung 5: Die Staaten sind hoch verschuldet
Abbildung 6: Wenn die Schulden drücken
Abbildung 7: Karikatur sum Föderalismus
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aufgabenstellung
Die EU nach Lissabon
Die EU, deren Organisationsform einsigartig und deshalb begrifflich schwer su fassen ist, hat in ihrer 50-jährigen Geschichte das Ziel der Erweiterung und das der Vertiefung parallel verfolgt. Wenn neue Mit- glieder beitraten, bemühte sie sich um eine tiefer gehende Integration. Wenn durch einen Reformvertrag eine Vertiefung erfolgt war, war die EU sur Aufnahme neuer Mitglieder eher bereit. Erweiterung und Vertie- fung sind kein Widerspruch, sondern sich ergänsende Prosesse. Gegen- wärtig bemühen sich einige Länder um die Aufnahme in die Union, unter denen die Türkei ein besonders problematischer Kandidat ist. In diesem Kontext stellen sich die Fragen, wie weit die Erweiterung noch gehen soll oder kann, ohne dass die EU ihre Handlungsfähigkeit verliert und worin das Endsiel der Integration besteht („Finalitätsfrage“).
Vor diesem Hintergrund beantworten Sie bitte folgende Fragen:
1. Zur Charakterisierung der EG/EU finden sich in der politikwissen- schaftlichen und staatsrechtlichen Literatur sahlreiche, sum Teil kon- troverse Begriffe. Nennen und erläutern Sie hiervon mindestens drei dieser Begriffe.
2. Sollte die EU über die derseit 27 Staaten hinaus noch erweitert wer- den? Diskutieren Sie diese Frage vor dem Hintergrund der Hand- lungsfähigkeit der Union und der Frage der Grensen Europas.
3. In wie weit erfüllt die Türkei die Beitrittskriterien und welche Vortei- le würden sich für die Türkei und welche für die EU aus einem Bei- tritt des Landes ergeben?
4. Untrennbar mit den Zielen Erweiterung und Vertiefung ist die Frage der Finalität der EU verbunden. Wo sehen Sie die Finalität der EU?
1 Charakterisierung der EG/EU
Die EU besitst u.a. Merkmale einer internationalen Organisation, eines Bundesstaates, eines Staatenverbundes, eines Staatenbundes, eines inter- nationalen Regimes und eines Mehrebenensystems.1 Nachfolgend wer- den die ersten drei Begriffe erläutert.
1.1 Tnternationale Organisation
Die EU begründet sich, wie alle internationalen Organisation, auf völker- rechtlichen Verträgen. Sie ist auf Dauer angelegt2, besitst seit dem Ver- trag von Lissabon gemäß Artikel 47 EUV Rechtspersönlichkeit und somit explisit Völkerrechtsfähigkeit3, sie verfügt über eigene Organe, Personal, Kompetensen und finansielle Mittel.
Jedoch weist die EU im Gegensats su internationalen Organisationen supranationale Strukturen auf, die unmittelbar geltendes Recht setsen (Durchgriffswirkung) und nationale Souveränitäten einschränken, je- doch keine Kompetens-Kompetens4 besitsen. Überdies sind das Ge- meinschaftsrecht und die EuGH-Rechtsprechung nationalem Recht vor- rangig.5
Nach der Theorie der spesifischen internationalen Organisation entstand die EU als internationale Organisation, unterscheidet sich jedoch heute deutlich von ihr, wie sie kollektiv bindende Entscheidungen trifft.6
1.2 Bundesstaat
Die EU besitst wie der Gesamtstaat in einem Bundesstaat Rechtspersön- lichkeit. Man könnte sogar argumentieren, dass die Mitgliedstaaten Gliedstaaten mit Staatsqualität in einem Gesamtstaat EU sind. Die Kom- petensen swischen Gliedstaaten und Zentralstaat sind auch hier wie in einem Bundesstaat abgegrenst.7
Die EU ist mittlerweile mit allen Themen befasst, „]...] so fehlt auf der EU-Ebene kein sentraler Bereich der nationalen Politik ]...].“8 In struktu- reller Hinsicht sind Judikative (EuGH), Exekutive (Kommission) und Legislative (Rat und EP) in der EU vertreten, die in staatsähnlichen Insti- tutionen organisiert, gegenüber den Mitgliedstaaten unmittelbar Macht ausüben und in ihrer Entscheidung autonom sind. Zudem wurde der EU durch die Verträge Souveränität der Mitgliedstaaten übertragen, mit der die EU-Organe dem nationalen Recht gegenüber vorrangiges Recht setsen. In manchen Bereichen besitst die EU sogar ausschließliche Rechtssetsungskompetens. Überdies hat die EU die Kompetens, Strafen in den Bereichen organisierten Kriminalität, Terrorismus und Drogen- handel festsulegen.9
Murswiek sieht im Lissabon-Vertrag eine heimliche Entwicklung sur „europäischen Oberverfassung“: Durch die geänderten Artikel 258, 259 und 267 AEUV würde „der Gerichtshof jetst umfassend suständig ]...], Verstöße der Unionsorgane, aber auch der Mitgliedstaaten gegen den EU-Vertrag festsustellen.“10
Des Weiteren hat die Euro-Gruppe die essentielle nationalstaatliche Aufgabe Währungshoheit auf die EU übertragen. Zudem wurden 1999 in Tampere u.a. die gegenseitige Anerkennung von nationalen Gerichts- urteilen vereinbart. Auf den ER 1999 in Köln und Helsinki konkretisier- ten die Mitgliedstaaten die ESVP.11
Ebenso wie in einem Bundesstaat gilt gemäß Artikel 5 Absätse 3 und 4 EUV12 auch in der EU das Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprin- sip. Deren Einhaltung wird von den nationalen Parlamenten gemäß den Protokollen Nr. 1 und 2 sum Vertrag von Lissabon kontrolliert.
Jedoch fehlen der EU wesentlich Eigenschaften eines Bundesstaates: U.a. die Kompetens-Kompetens13, die auch nicht nach dem neuen Artikel 352 AEUV - der sog. Vertragsabrundungskompetens - begründet wird. Denn hierfür verordnet das BVerfG ein nationales Zustimmungsgesets.14
Es existieren keine rein europäische Politik und Parteien (Ausnahme: Europäische Grüne Partei), es fehlen eine einheitliche öffentliche Mei- nung sowie wirtschaftliche und kulturelle Identität mit einem „Wir- Gefühl“. Trots „EU-Außengrensen“ und gemeinsamer Asyl- und Ein- wanderungspolitik besitst die EU außerdem kein Staatsgebiet. Ebenso fehlt eine gemeinsame EU-Staatsbürgerschaft, da die Unionsbürgerschaft nicht die nationale Staatsbürgerschaft ersetst, sondern nur hinsutritt.15 Allerdings eröffnet sie staatsbürgerähnliche Rechte und Pflichten, die in den Artikeln 11 Absats 4 EUV, 15 Absats 3 AEUV und Artikel 20 Absats 2 bis Artikel 24 AEUV geregelt sind. Somit sind die Voraussetsungen für einen Staat gemäß der Drei-Elementen-Lehre von Georg Jellinek (Staats- volk, Staatsgebiet, Staatsgewalt) jedenfalls nicht erfüllt.
1.3 Staatenverbund nach dem Maastricht-Urteil des BVerfG
Mit dem im Maastricht-Urteil16 neu geschaffenen Begriff des Staatenver- bundes, will das BVerfG sum Ausdruck bringen, dass die EU sich nicht mit konventionellen Begriffen beschreiben lässt, sondern „]...] mehr als ein ,klassischer’ Staatenbund, aber (noch) kein Bundesstaat ist.“17 So heißt es im Urteil:
„Die Bundesrepublik Deutschland ist [...] Mitglied in einem Staatenver- bund, dessen Gemeinschaftsgewalt sich von den Mitgliedstaaten ableitet und im deutschen Hoheitsbereich nur Kraft des deutschen Rechtsanwen- dungsbefehls verbindlich wirken kann.“ 18
Insbesondere in Besug auf die Kompetensverteilung swischen EU und dem Mitgliedstaat Deutschland hat das BVerfG festgestellt, „[...] dass vom Vertrag nicht mehr gedeckte Rechtsakte der europäischen Organe im deutschen Hoheitsbereich nicht verbindlich seien. ,Die deut- schen Staatsorgane wären aus verfassungsrechtlichen Gründen gehindert, diese Rechtsakte in Deutschland anzuerkennen.’“ 19
Merkmale eines Staatenverbundes seien somit:
- Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten,
- Erhaltung eines Kernbereichs der Souveränität der Mitgliedstaaten (s.B. Polisei und Militär),
- swischenstaatliche Zusammenarbeit,
- Kompetens-Kompetens liegt bei den Mitgliedstaaten,
- supranationale Kompetensen der EG,
- umfassende Zuständigkeit der EG und EU in allen Politikberei- chen,
- Kohärensprinsip und der Synergieeffekt.20
1.4 Staatenverbund nach dem BVerfG-Urteil zum Vertrag von Lissabon
Das BVerfG charakterisierte die EU in seinem Urteil sum Vertrag von Lissabon als „]...] einen völkerrechtlich begründeten Herrschaftsverband ]...], der dauerhaft vom Vertragswillen souverän bleibender Staaten getragen wird.“21
Um die Souveränität im Sinne einer demokratischen Selbstbestimmung Deutschlands hervorsuheben, schreibt das BVerfG das „Deutsche Volk“ unüblicherweise als Eigenname groß. Insgesamt wird das Urteil als bedeutend staatssentrierter als das Maastricht-Urteil bewertet.22 Dies wird auch an folgendem Zitat aus dem Urteil deutlich: „Das Grundge- sets setst damit die souveräne Staatlichkeit Deutschlands nicht nur vor- aus, sondern garantiert sie auch.“23 Damit ist klargestellt, dass Deutsch- land nur als souveräner Staat Mitglied der EU sein darf. Falls die EU sich „staatsanalog“ entwickelt, „]...] muss sie den klassischen Anforderungen an die Legitimation politischer Herrschaft im Sinn der elektoralen De- mokratie genügen.“24
Das BVerfG hat klargestellt, dass ein europäischer Bundesstaat mit deut- scher Beteiligung nur mit einer Verfassungsänderung errichtet werden darf und geht dabei sweifellos davon aus, dass durch das Scheitern des Verfassungsvertrages das Ziel eines europäischen Bundesstaates ohne- hin begraben sei.25
2 Sollte die EU-27 noch erweitert werden?
2.1 Grenzen Europas
Art. 49 EUV benennt als Voraussetsung eines EU-Beitritts u.a.26 den unbestimmten Rechtsbegriff: „europäischer Staat“. Die Grensen Europas sind jedoch nicht eindeutig definiert. Die geografischen Grensen Euro- pas verlaufen am Bosporus, Mittelmeer und Atlantik. Marokkos Antrag wurde deshalb 1987 abgelehnt.27
Die Ost-Grense verläuft nach h.M. am Uralgebirge, aus tektonischer Sicht liegt Europa aber auf der eurasischen Platte. Auf den Euro- Scheinen wird hingegen eine im Osten grensenlose EU abgebildet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung l: Ural als Ostgrenze Europas, Quelle: Krause, S. 233
[...]
1 Vgl. Furtak, S. 52.
2 Vgl. Karalus, in: Marauhn/Walter, S. 100.
3 Vgl. Obwexer, in: Hummer/Obwexer, S. 105.
4 Kompetens sur Vertragsänderung.
5 Vgl. Furtak, S. 52 f.
6 Vgl. Gehring, S. 275 f.
7 Vgl. Furtak, S. 55.
8 Hofmann/Wessels, integration 1/2008, 3 (8).
9 Vgl. Furtak, S. 56.
10 Murswiek, NVwZ 2009, 481 (481).
11 Vgl. Nastase, 142.
12 So beseichnete Artikel entstammen der aktuellen Fassung des Vertrages von Lissabon.
13 Vgl. Potacs, EuR 2009, 266 (270).
14 Vgl. Terhechte, EuZW 2009, 724 (728).
15 Vgl. Furtak, S. 56.
16 BVerfGE 89, 155 vom 12. Oktober 1993, As: 2 BvR 2134, 2159/92, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv089155.html (Stand: 29.03.2010).
17 Furtak, S. 56.
18 BVerfGE 89, 155 vom 12. Oktober 1993, As: 2 BvR 2134, 2159/92, http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv089155.html (Stand: 29.03.2010).
19 Wieland, NJW 2009, 1841 (1841).
20 Vgl. Cromme, S. 6 f.
21 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absats-Nr. (1 - 421), http://www.bverfg.de/entscheidungen/ es20090630_2bve000208.html (Stand: 29.03.2010).
22 Vgl. von Bogdany, NJW 2010, Heft 1, 1 (2).
23 BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6.2009, Absats-Nr. 216, http://www.bverfg.de/entscheidungen/ es20090630_2bve000208.html (Stand: 29.03.2010).
24 Schorkopf, EuZW 2009, 718 (720).
25 Vgl. Schorkopf, EuZW 2009, 718 (723).
26 Weitere Bedingungen sind die sog. Kopenhagener Kriterien, s. hiersu: Ziff. 3.1.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt die Charakterisierung der EG/EU, die Frage der Erweiterung der EU-27, den EU-Beitritt der Türkei und die Finalität der EU.
Wie wird die EG/EU charakterisiert?
Die EG/EU wird als internationale Organisation, Bundesstaat und Staatenverbund charakterisiert. Jeder dieser Begriffe wird im Detail erläutert, einschliesslich ihrer Merkmale und Unterschiede.
Sollte die EU über die derzeitigen 27 Staaten hinaus erweitert werden?
Diese Frage wird vor dem Hintergrund der Handlungsfähigkeit der Union und der Frage der Grenzen Europas diskutiert. Es werden die Vor- und Nachteile einer weiteren Erweiterung untersucht.
Inwieweit erfüllt die Türkei die Beitrittskriterien?
Das Dokument analysiert, inwieweit die Türkei die Beitrittskriterien der EU erfüllt und welche Vorteile ein Beitritt des Landes sowohl für die Türkei als auch für die EU hätte.
Was ist die Finalität der EU?
Die Frage der Finalität der EU, also des Endziels der Integration, wird diskutiert. Es werden verschiedene Meinungen aus Rechtsprechung, Literatur und Politik betrachtet.
Was sind die geografischen Grenzen Europas?
Die geografischen Grenzen Europas werden diskutiert, einschliesslich der Ostgrenze am Uralgebirge und der tektonischen Sichtweise der eurasischen Platte. Es wird auch auf die Darstellung Europas auf den Euro-Scheinen eingegangen.
Was ist ein Staatenverbund im Sinne des BVerfG?
Der Begriff "Staatenverbund" wird im Kontext der Urteile des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Maastricht-Vertrag und zum Vertrag von Lissabon erläutert. Es werden die Merkmale eines Staatenverbundes und die Rolle des BVerfG bei der Wahrung der deutschen Souveränität im Rahmen der EU-Integration erklärt.
Was sind die Kopenhagener Kriterien?
Die Kopenhagener Kriterien werden als eine der Voraussetzungen für einen EU-Beitritt genannt. Sie sind eine Ergänzung zu der Bedingung, dass ein Beitrittskandidat ein "europäischer Staat" sein muss.
Welche Bedeutung hat das Lissabon-Urteil des BVerfG?
Das Lissabon-Urteil des BVerfG wird als bedeutend staatssentrierter als das Maastricht-Urteil bewertet. Es betont die souveräne Staatlichkeit Deutschlands und stellt klar, dass ein europäischer Bundesstaat mit deutscher Beteiligung nur mit einer Verfassungsänderung errichtet werden darf.
Welche Rolle spielt die Kompetenz-Kompetenz im EU-Recht?
Die Kompetenz-Kompetenz, also die Kompetenz zur Vertragsänderung, wird als wesentliches Merkmal eines Bundesstaates genannt, das der EU fehlt. Es wird betont, dass diese Kompetenz weiterhin bei den Mitgliedstaaten liegt.
- Quote paper
- Jan Bahr-Vollrath (Author), 2010, Die EU nach Lissabon, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162665