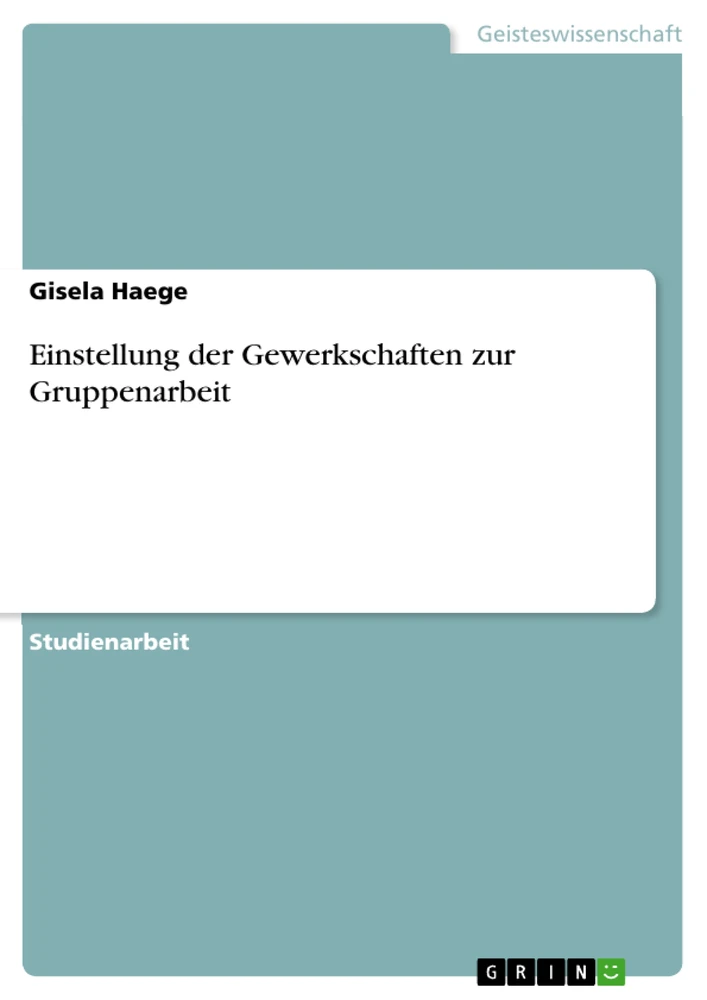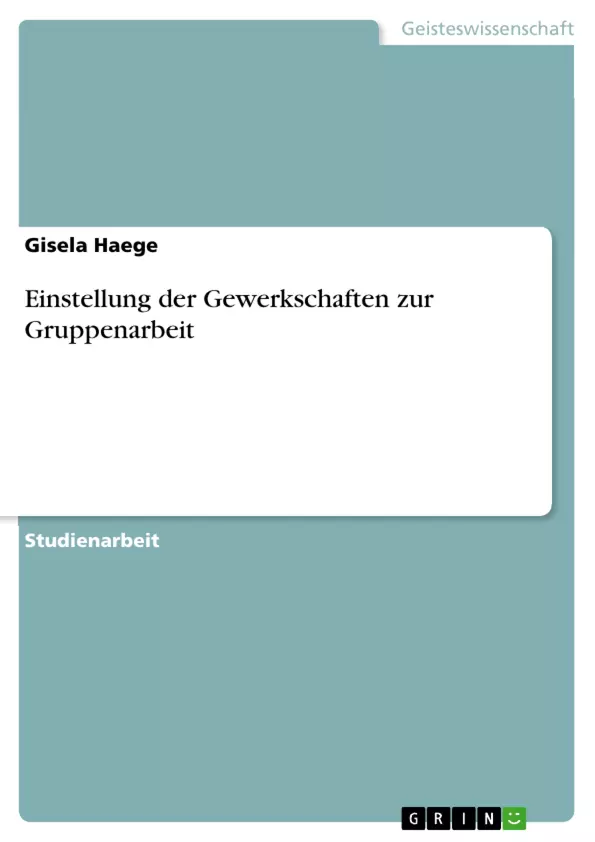Tayloristische Methoden (...) waren (vgl. zum Folgenden (Trautwein 1980, S.151-152) unter den ehemals vorherrschenden Bedingungen -expandierende Absatzmärkte, große Serien und eine Arbeiterschaft, die bereit war, diese Arbeiten auszuführen, da es sonst keine anderen Arbeitsformen gab- erfolgreich. Die Menschen wurden nach und nach zu Anhängseln von Maschinen und Anlagen. Dagegen steht bei der Einführung von Gruppenarbeit der Mensch im Mittelpunkt. Die herkömmlichen Arbeitssysteme waren nicht mehr in der Lage, auf die veränderten Bedingungen auf den Absatzmärkten zu reagieren: Fließband und vorgeschaltete Teilefertigung eignen sich nur für große Losgrößen und reagieren gegenüber Veränderungen auf seiten des Produktes und der Beschäftigten (Fehlzeiten) ausgesprochen schwerfällig und kostspielig. Für Abhilfe sorgt erhöhte Flexibilität in der innerbetrieblichen Organisation des Arbeitsprozesses. Die Stellung des Menschen im Taylorismus führte ebenfalls zu personellen Problemen in Form hoher Fluktuations- und Abwesenheitsraten.
Arbeitsgruppen mit der dadurch implizierten Selbststeuerung der Beschäftigten sind unter den heutigen wirtschaftlichen Umständen eine Bedingung für die Optimierung der Arbeitsabläufe, Erschließung neuer Leistungsreserven, Erhöhung der Flexibilität der Technik und Organisation sowie Senkung der indirekten Kosten der Produktion (Kosten der Fluktuation und Motivationskrisen). Dies sind Effekte, die durch bisherige tayloristische Arbeitssysteme nicht zu erreichen waren (vgl. Trautwein 1980, S.152).
Die Gewerkschaften schlugen schon in den 70er und 80er Jahren die Einführung von Gruppenarbeit vor, was jedoch von den Unternehmen abgelehnt wurde.
Im folgenden Kapitel wird die Einstellung der Gewerkschaften zur Gruppenarbeit, in dieser Seminararbeit in der Form von teilautonomen Gruppen, vorgestellt. In den beiden darauffolgenden Kapiteln wird auf mögliche Gefahren von Gruppenarbeit für die Arbeitnehmer hingewiesen. Nach dem Eingehen auf Qualitätszirkel, einer weiteren Form von Gruppenarbeit, im fünften Kapitel und dem Vorstellen der rechtlichen Möglichkeiten der betrieblichen Interessenvertretung nach dem Betriebsverfassungsgesetz wird im siebten Kapitel anhand eines positiven Fallbeispiels gezeigt, daß es auch Gruppenarbeit im Sinne der Gewerkschaften schon in der betrieblichen Praxis gegeben hat. Im achten Abschnitt wird die Einstellung der Gewerkschaften zur Gruppenarbeit noch einmal abschließend dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung:
- 2 Einstellung der Gewerkschaften zu Gruppenarbeit
- 3 Verhältnis zwischen den Rechten der teilautonomen Arbeitsgruppen und der Interessenvertretung nach Betriebsverfassungsgesetz
- Autonomiegrad und Integration von Tätigkeiten
- Entlohnung
- Gruppensprecher
- Gruppenbesprechungen
- Gruppe und Hierarchie
- Mögliche Regelungspunkte in Vereinbarungen können sein:
- 4 Negatives Fallbeispiel für Gruppenarbeit
- 5 Einstellung der Gewerkschaften zu Qualitätszirkeln
- 6 Rechtliche Möglichkeiten der Interessenvertretung nach dem Betriebsverfassungsgesetz
- 7 Positives Fallbeispiel für Gruppenarbeit
- 8 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Einstellung der Gewerkschaften gegenüber der Einführung von Gruppenarbeit, speziell teilautonomen Arbeitsgruppen, in Unternehmen. Sie untersucht die Chancen und Risiken dieser Arbeitsform für die Arbeitnehmer und beleuchtet das Spannungsverhältnis zwischen den Rechten der Arbeitsgruppen und der Interessenvertretung durch Betriebsräte.
- Die Entwicklung und Begründung der Gruppenarbeit im Kontext tayloristischer Arbeitsmethoden.
- Die Sichtweise der Gewerkschaften auf die Prinzipien von Selbstregulation und Selbstbestimmung in Gruppenarbeit.
- Mögliche Gefahren und Chancen für Arbeitnehmer durch Gruppenarbeit wie Selbstausbeutung, Gruppendruck, Leistungsverschärfung und Unterlaufen der Interessenvertretung.
- Die Rolle von Qualitätszirkeln als einer weiteren Form der Gruppenarbeit und ihre Einordnung in den Kontext der Gewerkschaftspositionen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Interessenvertretung im Betriebsverfassungsgesetz im Hinblick auf die Interessen der Arbeitnehmer in Gruppenarbeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Einführung von Gruppenarbeit als Reaktion auf die strukturelle Wirtschaftskrise und die Veränderung der Absatzmärkte. Es stellt die Kritik an tayloristischen Arbeitsmethoden und den Bedarf nach erhöhter Flexibilität im Arbeitsprozess heraus. Das zweite Kapitel definiert Gruppenarbeit und stellt die Sichtweise der Gewerkschaften auf teilautonome Arbeitsgruppen vor, die sich durch Selbstregulation und Selbstbestimmung der Beschäftigten auszeichnen. Es werden Chancen und Risiken für Arbeitnehmer, wie erweiterte Tätigkeitsfelder, größere Verantwortung, aber auch die Gefahr der Selbstausbeutung und des Gruppendrucks, beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich dem Verhältnis zwischen den Rechten der teilautonomen Arbeitsgruppen und der Interessenvertretung durch Betriebsräte. Es untersucht Themen wie Autonomiegrad, Integration von Tätigkeiten, Entlohnung, Gruppensprecher und die Rolle von Hierarchie in Gruppenarbeit. Das vierte Kapitel präsentiert ein negatives Fallbeispiel für Gruppenarbeit, welches auf die potentiellen Nachteile dieser Arbeitsform aufmerksam macht. Im fünften Kapitel werden die Einstellungen der Gewerkschaften zu Qualitätszirkeln, einer weiteren Form von Gruppenarbeit, analysiert.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Themen Gruppenarbeit, teilautonome Arbeitsgruppen, Gewerkschaftspolitik, Arbeitsorganisation, Betriebsverfassungsgesetz, Selbstregulation, Selbstbestimmung, Interessenvertretung, Chancen und Risiken für Arbeitnehmer, Selbstausbeutung, Gruppendruck, Qualitätszirkel, Taylorismus und die Auswirkungen auf die Arbeitswelt.
Häufig gestellte Fragen
Warum befürworten Gewerkschaften die Einführung von Gruppenarbeit?
Gewerkschaften sehen in Gruppenarbeit eine Chance zur Überwindung des Taylorismus. Sie fordern mehr Selbstbestimmung, Selbstregulation und eine Humanisierung der Arbeitswelt, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht.
Was sind die Gefahren von Gruppenarbeit für Arbeitnehmer?
Es bestehen Risiken wie Selbstausbeutung durch hohen Gruppendruck, Leistungsverschärfung und die Gefahr, dass die offizielle Interessenvertretung (Betriebsrat) durch gruppeninterne Absprachen unterlaufen wird.
Wie stehen Gewerkschaften zu Qualitätszirkeln?
Qualitätszirkel werden oft kritischer gesehen als teilautonome Gruppen, da sie häufig nur punktuell ansetzen und weniger echte Autonomie über den Arbeitsprozess bieten.
Welche Rolle spielt das Betriebsverfassungsgesetz?
Das Gesetz bietet den rechtlichen Rahmen für die Mitbestimmung. Gewerkschaften betonen, dass die Rechte der teilautonomen Gruppen die Kompetenzen des Betriebsrates nicht einschränken dürfen.
Was unterscheidet Gruppenarbeit vom Taylorismus?
Während der Taylorismus auf strikte Trennung von Kopf- und Handarbeit sowie starre Hierarchien setzt, fördert Gruppenarbeit die Integration verschiedener Tätigkeiten und die Eigenverantwortung der Beschäftigten.
- Quote paper
- Gisela Haege (Author), 1996, Einstellung der Gewerkschaften zur Gruppenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1628