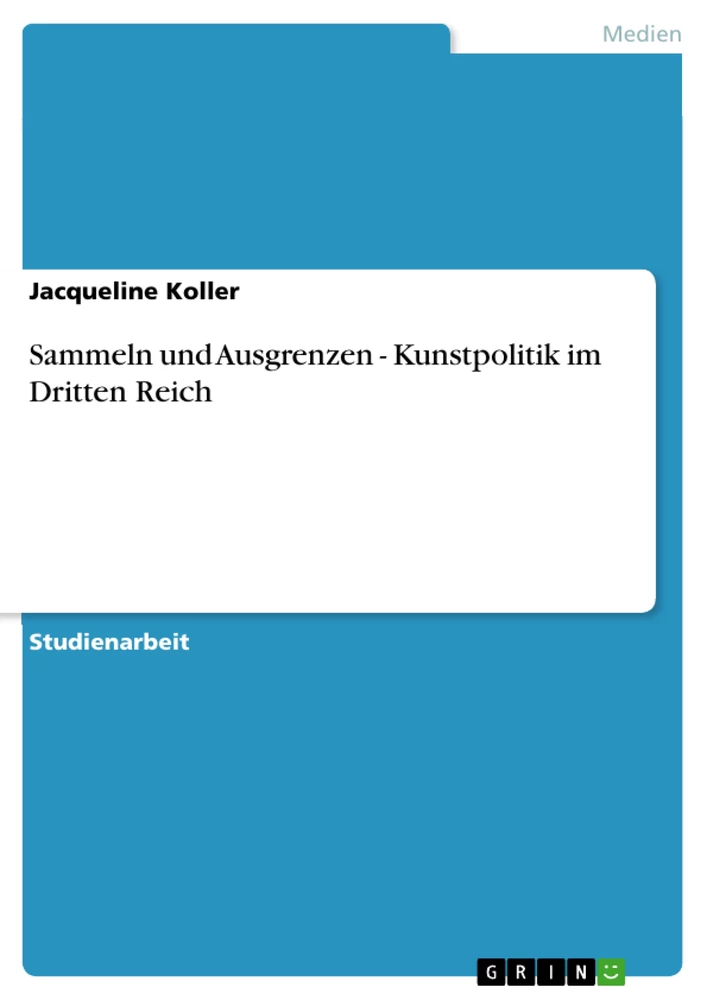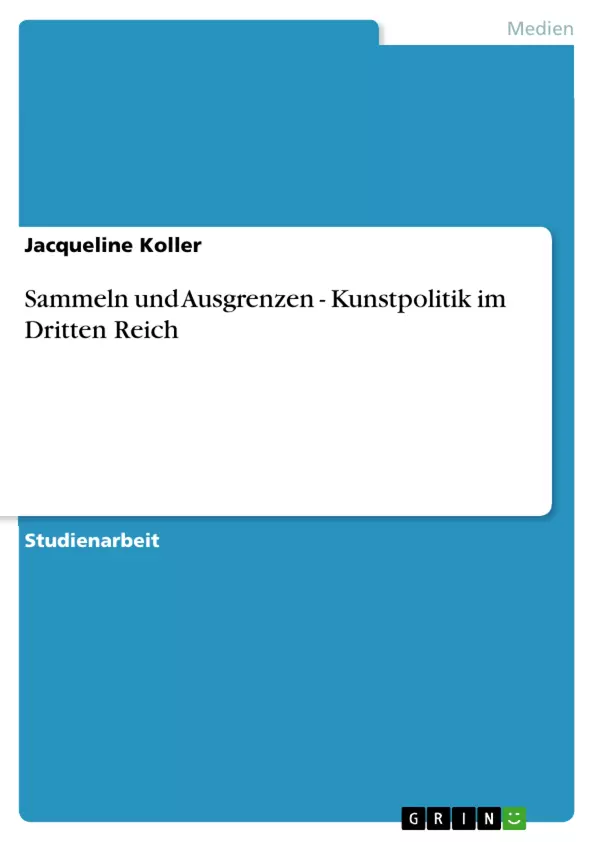Adolf Hitler hat sich schon früh für Kunst interessiert und sich intensiv mit ihr beschäftigt, d.h. Gemäldegalerien besucht und kunsthistorische Bücher gelesen, v.a. die sehr nationalistischen Schriften von Friedrich Pecht1 – er wollte sogar selbst als Künstler tätig sein. „Jeder weiß, dass er als junger Mann Maler werden wollte. Weniger bekannt ist, dass er eine hochrangige Gemäldesammlung besaß und seinen Lebensabend als Kunstfreund inmitten einer Gemäldegalerie verbringen wollte.“2 Sein Weg zum Künstler sollte scheitern: Hitler wurde zweimal von der Akademie in Wien abgelehnt, doch verstand er sich selbst „nicht als gescheitert, sondern als „verkannt“. Einem Topos der zeitgenössischen Künstlerliteratur gemäß war Verkanntsein und insbesondere eine Ablehnung durch die Akademie aber ein wesentliches Kriterium für Genialität.“3 Und gerade diese Ansicht, die Hitler übernahm, war verheerend – Er sah sich als Genie. Seinen Aufstieg fand das „Genie“ dann dennoch nicht in der Kunst, sondern in der Politik. Doch nahm Hitler die Kunst mit in seine Herrschaft. Innerhalb des Nationalsozialismus avancierte sie zu einem äußerst wichtigen Bereich – nicht nur in der Politik. Hitler hatte ab 1933 die Macht, seine private Kunstanschauung zu einer öffentlichen zu machen, indem er einfach alles ungewollte ins Abseits drängte und verbot. Außerdem konnte er sein Künstlerdasein doch noch ausleben, indem er Bauprojekte plante und mitausführte. In den Rängen der NS-Spitze wurde Kunst gesammelt und untereinander verschenkt. Die vorliegende Arbeit will aufzeigen, was die nationalsozialistische Kunstpolitik bewirkte, was von Seiten der Nationalsozialisten an Kunst gesammelt und was ausgegrenzt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Bedeutung von Kunst in Hitlers Leben...
- Sammeln und Ausgrenzen – Kunstpolitik im Dritten Reich...
- Sammeln
- Private Sammlungen.….…………….
- Offizielle Linie
- Ausgrenzen...
- Sammeln
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Kunstpolitik des Dritten Reichs, wobei sie insbesondere die beiden zentralen Aspekte „Sammeln“ und „Ausgrenzen“ beleuchtet. Die Arbeit analysiert, welche Rolle Kunst im Leben Hitlers spielte und wie er seine private Kunstanschauung in eine öffentliche umwandelte. Sie untersucht die Sammlungsaktivitäten der Nationalsozialisten, sowohl in privaten als auch in offiziellen Kontexten, und beleuchtet die Ausgrenzung und Verfolgung von „entarteter“ Kunst.
- Hitlers Kunstgeschmack und die Entstehung seiner Sammlung
- Die Rolle des „Sonderauftrag Linz“ und des „Führermuseums“
- Die „Gleichschaltung“ der Kunst und die Verfolgung „entarteter“ Kunst
- Die Ausstellung „Entartete Kunst“ in München 1937
- Die Folgen der NS-Kunstpolitik für Künstler und Kunstwerke
Zusammenfassung der Kapitel
Bedeutung von Kunst in Hitlers Leben
Dieser Abschnitt beleuchtet Hitlers frühe Faszination für Kunst, seine gescheiterten Versuche als Künstler und seine spätere Rolle als Förderer und Verfechter einer bestimmten Kunstauffassung. Hitlers ambitionierte Pläne für ein „Führermuseum“ in Linz und seine Sammlungsstrategie werden ebenfalls vorgestellt.
Sammeln und Ausgrenzen – Kunstpolitik im Dritten Reich
Sammeln
Hier werden private Sammlungen von NS-Größen wie Hitler, Göring und Goebbels sowie die offizielle Kunstpolitik des Regimes analysiert. Es wird darauf eingegangen, wie Kunst für Propaganda und Imagepflege genutzt wurde und welche Rolle die „Großen Deutschen Kunstausstellungen“ spielten.
Ausgrenzen
Dieser Teil befasst sich mit der Verfolgung von „entarteter“ Kunst durch die Nationalsozialisten. Es wird auf die Definition von „Entarteter Kunst“, ihre Ausgrenzung aus öffentlichen Museen und Galerien und die Folgen für Künstler sowie die Ausstellung „Entartete Kunst“ 1937 eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bereiche Kunstpolitik, Sammeln und Ausgrenzen im Dritten Reich, „Entartete Kunst“, Hitler, „Führermuseum“, „Sonderauftrag Linz“, Gleichschaltung, Propaganda, und NS-Kunst.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Hitlers privater Kunstgeschmack die NS-Politik?
Hitler erhob seine private Vorliebe für klassische, nationalistische Kunst zur Staatsdoktrin und ließ moderne, „ungewollte“ Kunst systematisch verbieten und ausgrenzen.
Was war der „Sonderauftrag Linz“?
Dies war ein Projekt zum Aufbau des „Führermuseums“ in Linz, für das im großen Stil Kunstwerke gesammelt und oft auch geraubt wurden.
Was verstanden die Nationalsozialisten unter „Entarteter Kunst“?
Als „entartet“ galt alles, was nicht dem NS-Ideal entsprach, insbesondere Expressionismus, Dadaismus und Werke jüdischer Künstler, die als „zersetzend“ diffamiert wurden.
Welchen Zweck hatte die Ausstellung „Entartete Kunst“ 1937?
Die Ausstellung in München sollte moderne Kunst lächerlich machen, die Bevölkerung gegen diese Stilrichtungen aufhetzen und die staatliche Ausgrenzung rechtfertigen.
Welche Rolle spielten private Sammlungen von NS-Größen wie Göring?
NS-Spitzen wie Göring und Goebbels sammelten exzessiv Kunst für private Zwecke und zur Imagepflege, oft durch die Aneignung von jüdischem Besitz oder Museumsbeständen.
- Quote paper
- Jacqueline Koller (Author), 2010, Sammeln und Ausgrenzen - Kunstpolitik im Dritten Reich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162864