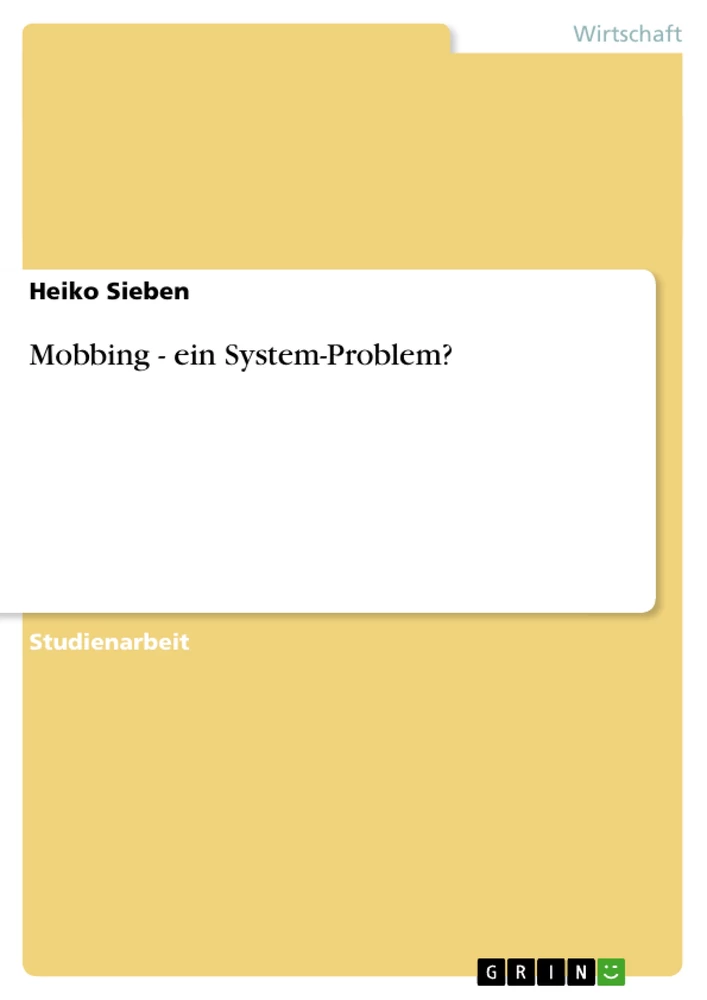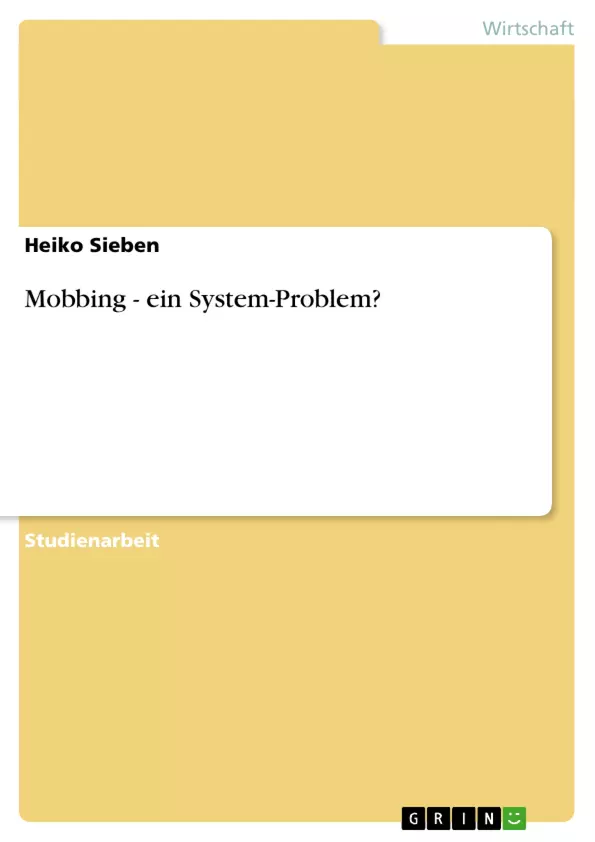[...] Solche, sich zu Mobbing entwickelnde, Konfliktprozesse treten im Betriebsgeschehen
nicht wahllos oder zufällig auf, sondern sind auf bestimmte Arbeitsplatzbelastungen
zurückzuführen, die sich aus strukturellen, sozialen und persönlichen Bedingungen ergeben. Bereits diese kurzen Ausführungen lassen erahnen, dass es sich bei Mobbing um ein
komplexes Phänomen handelt, das nur schwerlich aus einer einzigen Perspektive heraus betrachtet
werden kann. Komplexität erfordert eine ganzheitliche Betrachtungsweise des zu diskutierenden Gegenstandes. Vor allem mit dem Blick auf das Wechselspiel von Individuen,
Organisationsstrukturen und -dynamiken stellt der systemtheoretische Ansatz für die Untersuchung
des Phänomens Mobbing eine nützliche Sichtweise dar.
In dieser Arbeit soll die Bedeutung des systemtheoretischen Denkens für das Phänomen
Mobbing am Arbeitsplatz herausgearbeitet werden. Im ersten Teil wird zunächst die
Entwicklung des systemischen Denkens im 20. Jahrhundert skizziert. Anschließend wird der
Systembegriff näher beschrieben. Dabei werden soziale Systeme als Systeme handelnder
Personen betrachtet. Dementsprechend werden Merkmale und Funktionsweisen von sozialen
Systemen dargestellt. Neben dem Merkmal der Systemzugehörigkeit und der Systemfunktionalität
stellt das Prinzip der Zirkularität ein entscheidendes Charakteristikum von sozialen
Systemen dar. Mit der Darstellung des Konstruktivismus, der eng mit dem systemtheoretischen
Denken verbunden ist und einem kurzen Zwischenfazit endet der erste Teil dieser Arbeit.
Im zweiten Teil geht es um die Erklärung des Phänomens Mobbing. Dabei wird nach einer
Definition des Begriffes Betrieb zunächst auf die Bedeutung der Arbeit in unserem Kulturkreis
hingewiesen. Anschließend wird der Mobbingbegriff für die vorliegende Arbeit festgelegt.
Am Ende wird ebenfalls ein kurzes Zwischenfazit gezogen.
Im dritten Teil erfolgt die Zusammenführung der beiden vorangegangenen Teile. Hier wird
das Phänomen Mobbing aus der systemtheoretischen Perspektive als System-Problem, als
systemische Interaktion und darüber hinaus als komplexe Wirklichkeitskonstruktion verstanden.
Im abschließenden Fazit wird das Arbeitsergebnis reflektiert und die Methode einer systemischen
Organisationsentwicklung vorgestellt, die auf allen betrieblichen Ebenen ansetzt, um
Mobbing gar nicht erst entstehen zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Systemtheoretische Betrachtungen
- 2.1 Entwicklung des systemtheoretischen Denkens im 20. Jahrhundert
- 2.2 Grundlagen systemtheoretischen Denkens
- 2.2.1 Was ist ein System? – Begriffserklärung und Definitionen
- 2.2.2 Merkmale und Funktionsweisen sozialer Systeme
- 2.2.2.1 Merkmale der Systemzugehörigkeit
- 2.2.2.2 Merkmale der Systemfunktionalität
- 2.2.2.3 Prinzip der Zirkularität
- 2.2.3 Konstruktivismus
- 2.3 Zwischenfazit
- 3. Das Phänomen Mobbing im Betrieb
- 3.1 Definition des Begriffes Betrieb
- 3.2 Bedeutung der Arbeit
- 3.3 Mobbing - Begriffserklärung und Definitionen
- 3.4. Zwischenfazit
- 4. Mobbing aus systemtheoretischer Sicht
- 4.1 Mobbing als System-Problem
- 4.2 Mobbing als systemische Interaktion
- 4.3 Mobbing – eine komplexe Wirklichkeitskonstruktion
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Seminararbeit ist es, die Bedeutung des systemtheoretischen Denkens für das Phänomen Mobbing am Arbeitsplatz herauszuarbeiten. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des systemischen Denkens im 20. Jahrhundert und beschreibt den Systembegriff sowie Merkmale und Funktionsweisen von sozialen Systemen. Darüber hinaus wird das Phänomen Mobbing im Betrieb definiert und aus systemtheoretischer Sicht als System-Problem, systemische Interaktion und komplexe Wirklichkeitskonstruktion betrachtet.
- Entwicklung des systemtheoretischen Denkens im 20. Jahrhundert
- Grundlagen systemtheoretischen Denkens
- Mobbing als Phänomen im Betrieb
- Mobbing aus systemtheoretischer Sicht
- Systemische Organisationsentwicklung zur Prävention von Mobbing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit dem Phänomen Mobbing und seinen Auswirkungen auf die Gesundheit von Arbeitnehmern und die Betriebsergebnisse. Die Arbeit stellt die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise von Mobbing dar und argumentiert für den systemtheoretischen Ansatz als nützliche Sichtweise.
Kapitel 2 widmet sich der Entwicklung des systemtheoretischen Denkens im 20. Jahrhundert und beschreibt den Systembegriff sowie Merkmale und Funktionsweisen sozialer Systeme. Das Prinzip der Zirkularität und der Konstruktivismus werden als wichtige Bestandteile des systemischen Denkens vorgestellt.
Kapitel 3 erläutert den Begriff des Betriebes und die Bedeutung der Arbeit. Anschließend wird der Mobbingbegriff definiert und die Problematik des Phänomens Mobbing im Betrieb beleuchtet.
Kapitel 4 untersucht das Phänomen Mobbing aus systemtheoretischer Sicht. Mobbing wird als System-Problem, als systemische Interaktion und als komplexe Wirklichkeitskonstruktion betrachtet.
Schlüsselwörter
Mobbing, Systemtheorie, soziales System, Zirkularität, Konstruktivismus, Betrieb, Arbeit, systemische Interaktion, Wirklichkeitskonstruktion, Organisationsentwicklung
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Mobbing als "System-Problem" betrachtet?
Mobbing entsteht oft aus dem Wechselspiel von Individuen, Organisationsstrukturen und Gruppendynamiken, nicht nur durch persönliche Fehlleistungen einzelner Personen.
Was bedeutet "Zirkularität" im Kontext von Mobbing?
Zirkularität beschreibt, dass Handlungen in einem sozialen System wechselseitig aufeinander reagieren und sich so Mobbing-Prozesse in Kreisläufen verstärken können.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus?
Er erklärt, dass Mobbing eine komplexe Wirklichkeitskonstruktion der Beteiligten ist, bei der Wahrnehmung und Realität individuell geformt werden.
Wie kann man Mobbing systemisch vorbeugen?
Durch eine systemische Organisationsentwicklung, die auf allen betrieblichen Ebenen ansetzt, um belastende Arbeitsplatzstrukturen frühzeitig zu verändern.
Sind soziale Systeme nur Gruppen von Personen?
Im systemtheoretischen Sinne werden soziale Systeme als Systeme handelnder Personen betrachtet, die durch Kommunikation und funktionale Merkmale definiert sind.
- Citar trabajo
- Heiko Sieben (Autor), 2003, Mobbing - ein System-Problem?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16287